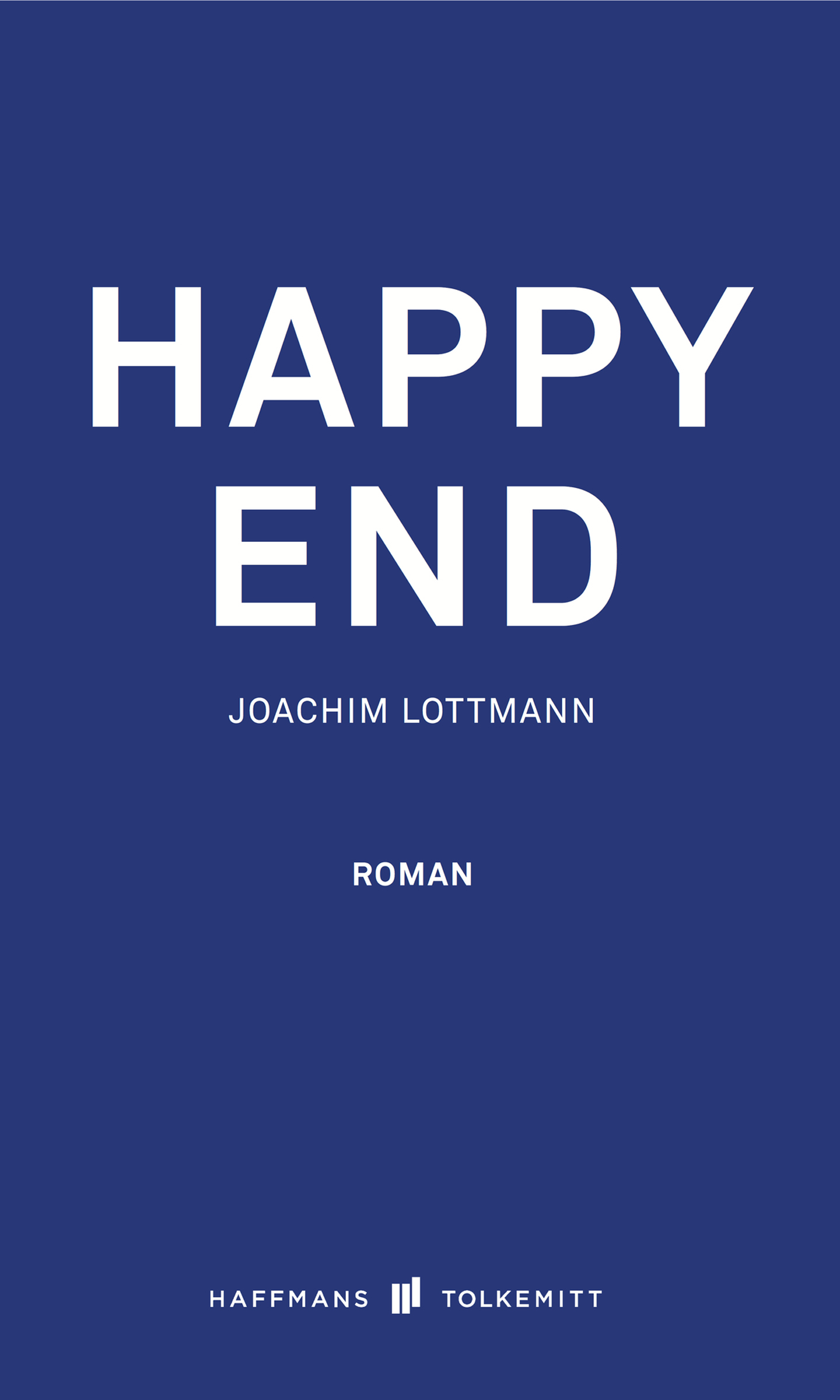9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Das ist kein Buch, das ist das Leben.« Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung Soll er eher etwas Autobiographisches schreiben oder doch lieber einen DDR-Roman? Der namenlose Ich-Erzähler aus Mai, Juni, Juli streift durch eine deutsche Metropole, es ist Mitte der 80er Jahre und alle reden von Pop, Sex und Seele. Er will ein »großer Schriftsteller« werden, aber noch kommt er schlecht aus dem Bett und leidet an Depressionen. Es vergehen Wochen, Monate, und schon wieder ist ein Tag verloren, weil er kein Schreibmaschinenpapier zur Hand hat. Doch immerhin weiß er, was alles nicht vorkommen darf: keine verdammt gute Literatur, keine Monomanie, keine Exzesse, kein Tiefgang, keine geschmäcklerische Yuppie-Schreibe. Für die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung gehört Mai, Juni, Juli zu den »anderen Klassikern« – den Büchern, die nicht im Kanon von Marcel Reich-Ranicki auftauchen, aber eine tiefe Spur im Gedächtnis einer heutigen, jüngeren Generation hinterlassen haben. Nicht zuletzt, weil es am Anfang dessen steht, was später unter dem Label Pop-Literatur subsumiert wurde, eine Abrechnung mit der nicht enden wollenden deutschen Nachkriegsliteratur: wütend, respektlos und ein wenig großkotzig.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 336
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Joachim Lottmann
Mai, Juni, Juli
Ein Roman
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Joachim Lottmann
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Joachim Lottmann
Joachim Lottmann geboren 1959 in Hamburg, studierte Theatergeschichte und Literaturwissenschaft in Hamburg. 1987 erschien sein literarisches Debüt »Mai, Juni, Juli«, das als erster Roman der deutschen Popliteratur gilt. Lottmanns zweiter Roman »Deutsche Einheit« kam 1999, seitdem folgten sechs weitere Bücher bei KiWi, am erfolgreichsten »Die Jugend von heute« (2004), »Der Geldkomplex« (2009) und »Endlich Kokain« (2014). 2010 nahm Lottmann den Wolfgang-Koeppen-Preis entgegen. Der Autor schreibt u.a. für taz, FAS und Welt und lebt in Wien.
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
»Das ist kein Buch, das ist das Leben.« Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung
Soll er eher etwas Autobiographisches schreiben oder doch lieber einen DDR-Roman? Der namenlose Ich-Erzähler aus Mai, Juni, Juli streift durch eine deutsche Metropole, es ist Mitte der 80er Jahre und alle reden von Pop, Sex und Seele. Er will ein »großer Schriftsteller« werden, aber noch kommt er schlecht aus dem Bett und leidet an Depressionen. Es vergehen Wochen, Monate, und schon wieder ist ein Tag verloren, weil er kein Schreibmaschinenpapier zur Hand hat. Doch immerhin weiß er, was alles nicht vorkommen darf: keine verdammt gute Literatur, keine Monomanie, keine Exzesse, kein Tiefgang, keine geschmäcklerische Yuppie-Schreibe.
Für die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung gehört Mai, Juni, Juli zu den »anderen Klassikern« – den Büchern, die nicht im Kanon von Marcel Reich-Ranicki auftauchen, aber eine tiefe Spur im Gedächtnis einer heutigen, jüngeren Generation hinterlassen haben. Nicht zuletzt, weil es am Anfang dessen steht, was später unter dem Label Pop-Literatur subsumiert wurde, eine Abrechnung mit der nicht enden wollenden deutschen Nachkriegsliteratur: wütend, respektlos und ein wenig großkotzig.
KiWi-NEWSLETTER
jetzt abonnieren
Impressum
Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KGBahnhofsvorplatz 150667 Köln
© 1987, 2003, 2017, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln
Alle Rechte vorbehalten
Covergestaltung: Barbara Thoben, Köln
Covermotiv: © Dieter Brandenburg
ISBN978-3-462-31718-3
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt. Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen der Inhalte kommen. Jede unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Alle im Text enthaltenen externen Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Inhaltsverzeichnis
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
Quellkopf
8. Kapitel
9. Kapitel
Pixie
11. Kapitel
Nachwort
Es war in der Zeit, als ich unbedingt ein Schriftsteller sein wollte. Eine schreckliche Zeit. Morgens kam ich nicht aus dem Bett, und abends hatte ich Depressionen. Dazwischen zersprang mir der Kopf. Oft saß ich einen halben Tag lang vor einer Mauer von Nichts, einem zugehängten Fenster, vor meinem Schreibtisch und dachte: Ich bin ein Schriftsteller.
Dieser Gedanke gefiel mir wie überhaupt der Zustand. Was konnte nicht alles werden! Alles war offen. Jeden Moment konnte die Idee meines Lebens durch mein weiches Bewußtsein zucken, und hurtig mochten die bereiten Finger alles zu Papier bringen. Der Roman, der alles veränderte. Ja, ich war davon überzeugt, ein großer Schriftsteller zu sein, wenn ich nur anfing.
Und selbst wenn ich nicht anfing – die bloße Existenz der Möglichkeit des Schriftstellerseins schien mir jeder anderen Existenz überlegen zu sein. Vor mir lag die Welt. Fünf Milliarden Menschen faßte ich ins Visier. Ich wog die Staaten, maß ihre Führer, stellte zum Beispiel Vermutungen über die psychologischen Gesetze innerhalb der Ehe des libyschen Revolutionsführers an. Er hatte eine kräftige, schöne Frau, die ihm sieben Kinder schenkte. Dann ging ich zum Kühlschrank, öffnete ihn, wohl aus lieber Gewohnheit, und blickte auf den einzigen Gegenstand, der da immer verwahrt wurde, eine leere Packung Billigmargarine. Ich glaube, die Marke hieß ›Blauband‹. Dann machte ich Kaffee und schlafwandelte zurück zum Schreibtisch, um weiter ›nachzudenken‹. Übermannten mich die ewigen Kopfschmerzen, zog ich mich ins Bett zurück, um ›ein bißchen auszuruhen‹. Ich schlief dann ein Stündchen, um ›geistig wieder frisch zu werden‹ und anschließend um so energischer ›weiterarbeiten‹ zu können. Ich durfte die Welt ja nicht allzu lange warten lassen.
Unfaßbar, aber das ging nun schon einen ganzen Winter lang so, und der Frühling war auch schon fast vorbei. Die Depressionen wurden abends immer stärker, und wenn tagsüber die Sonne schien, machte mich der Gedanke verzweifelt, andere Menschen würden draußen herumlaufen, während ich das Recht dazu nicht mehr hatte. Wer nichts schafft, darf auch nicht herumlaufen. Die Vögel piepsten und tirilierten, aber ich traute mich nicht, wenigstens das Fenster von dem abdichtenden Versteckvorhang zu befreien – denn dann hätte man mich beobachten können, wie ich ›arbeitete‹, also Kaffee trank und ›nachdachte‹.
Wenn es aber regnete und ich einmal kurz davor war, tatsächlich um ein Haar den Gedanken zum Jahrhundertroman zu haben, er mir nur knapp entkommen war und jederzeit zurückkehren konnte, blickte ich auf die bereits gefechtsklare Schreibmaschine und jubelte.
Ich bin ein Schriftsteller!
Ich bin ein Schriftsteller!
Gut, daß das niemand beobachten konnte. Ein Schriftsteller mußte im geheimen arbeiten. Er mußte die nichtsahnende Welt bestehlen. Niemals durfte er im Vorwege preisgeben, was er auf der Pfanne hatte. Scheinbar arglos lebte er unter den Menschen, gleichgültig fast, um dann zu Hause, hinter dem Fenstervorhang, loszuschlagen.
Daß ich kein Geld mehr hatte, versteht sich von selbst. Wer wirklich einmal über längere Zeit kein Geld hatte, weiß, daß sich diese Frage von selbst löst. Irgendwann gibt es die Frage nicht mehr, man freut sich des Lebens und versteht nicht, daß andere soviel Aufhebens davon machen. Alles dreht sich um, und hat man einmal zwanzig Mark, hat man zum erstenmal WIRKLICH Geld. Man ist dann um zwanzig Mark reicher als alle anderen.
Dumm war nur, daß ich somit, da geldlos, nicht die Cafés aufsuchen und einen Kaffee unter Menschen trinken konnte. Da ich dies nicht konnte, hatte ich kein Ziel, auf das ich hätte zulaufen können beim Spazierengehen, so daß es mir fast unmöglich war, das Haus zu verlassen. Ich wohnte in jener Zeit in einem kleinen Stadthaus inmitten der Innenstadt, dessen einziger Mieter ich war. Ich wohnte unter dem Dach, praktisch in der dritten Etage, während die anderen Etagen leerstanden und ich somit keine Nachbarn und andere Mieter kannte. Das war schön, für meine großen Zwecke wie geschaffen. Das Haus gehörte mir allein, und ich liebte es, denn es war anständig, zuverlässig, uneitel, aus einem Zeitalter der ehrbaren Kaufleute, die allerdings recht kleinwüchsig gewesen sein mußten – im Treppenhaus mußte man den Kopf einziehen, die Stufen waren handtuchschmal, das Geländer in niedlicher Kinderhöhe reichte kaum höher als bis zu den Knien. Über dem Dachboden, den ich bewohnte, befand sich, da das Haus hochgiebelig war, noch ein weiterer, noch kleinerer Dachboden, den ich von meinem Schreibtisch aus mittels Leiter und Luke erreichen konnte; es war nur ein einziger, vom zusammenlaufenden Dach umschlossener, muffiger Raum, der mit und ohne Sonne vor Staub flirrte und in dem sich seit 1795 nichts verändert hatte.
Man hatte mir also erlaubt, in diesem Haus im Dachstuhl zu ›wohnen‹, und das war für meine Schriftstellerexistenz das wichtigste. Alle anderen Schriftsteller mußten nämlich, in diesem Jahrhundert, schrecklich viel Miete bezahlen, was sie dazu zwang, ehrlose Arbeiten für Zeitungen auszuführen, wodurch sie ihr Urteil, ihren Blick für das Universum, ihre Liebe zu den Menschen verloren. Dachte ich. Kein Wunder also, daß es RICHTIGE Schriftsteller gar nicht mehr gab, daß ich der letzte war oder, wenn man so will, der erste. Denn nach mir, da war ich mir ganz sicher, nach meinem riesigen Erfolg, würden es mir Hunderte und Tausende nachmachen; sie würden sich der Existenz mit Haut und Haaren aussetzen und auf das Feuilleton pfeifen. Sie würden in alten Häusern wie gebannt auf ihre Schreibmaschinen starren.
Manchmal, es ging ja nicht anders, aber wirklich ganz selten, schickte ich mich dennoch nach draußen. Es waren Expeditionen ins Tierreich, Fahrten zum Nordpol, vor allem Tests nach dem Motto ›Wie lange hält es ein Mensch unter Wasser aus, ohne einzuatmen‹: Die ersten Meter gestalteten sich schwierig, wackelig, die Kamera rutschte hin und her, Gegenstände versperrten den Weg, plötzliche Menschen rannten über einen hinweg und fluchten, Gesichter erschraken. Dann kamen hundert, zweihundert Meter, die ganz gut gingen. Frische Luft, das Federn der eigenen Schritte, die wiedergewonnene Orientierung. Aber dann begann ich mich zu quälen. Meine Haut war so fahl, der Gang so ungelenk, das Jackett so schäbig; todkrank sah ich aus, wie mir der erstbeste zufällige Blick in einen Schaufensterspiegel zeigte, wenn es mir nicht schon die erschrockenen entgegenkommenden Gesichter bewiesen. Ja, monatelanges Vegetieren machte einen Menschen unfrisch, das merkte ich dann immer wieder. Sport hätte ich treiben müssen, ein wenig Gymnastik! Doch wenn ich das tat – ich hatte es ausprobiert –, konnte ich anschließend nicht so gut ›arbeiten‹. Kein Gedanke kam mir in den Kopf, stundenlang, so erschöpfte mich die kleinste Anstrengung inzwischen. Klar, daß mir die ›Arbeit‹ wichtiger war als ein geckenhaftes Aussehen. So blieben die Exkursionen peinvoll, übrigens nicht nur deshalb. Spazierengehen ist, egal in welcher Verfassung, sinnlos, solange man niemanden bei sich hat. Nun hatte ich herausgefunden, daß mich das Gespräch mit anderen Menschen von der ›Arbeit‹ ablenkte; ergo ging ich alleine, hatte nichts als das reine, ausschließliche, Meter für Meter mit Sinnlosigkeiten gespickte Spazierengehen. Es war, als schwämme man gegen den Strom. Alle Menschen waren eingeflochten in ihre Gespräche und intersozialen Zusammenhänge, agierten, lösten ein, strebten zu, waren in Bewegung, liefen mit Volldampf ihren Stundenplan ab, der wiederum Teil ihres Jahresplans und Lebensplans war. Sie lachten und lebten. Nur ich guckte mit großen, zittrigen Augen zu, stieß mit Leuten zusammen, war im Weg, bekam keine Luft zum Schnaufen. Regelmäßig geriet ich nach zwanzig Minuten in regelrechte Panik, war zu warm angezogen, lief schwitzend zurück, ließ mich in ein Taxi fallen, hatte Angst vor dem Taxifahrer. Wenn ich dann endlich wieder in meinem alten Fachwerk-Dachstuhl war und die Tür doppelt abgeschlossen hatte, nahm ich mir stets vor, endlich zügig zu ›arbeiten‹, damit ich schnellstens berühmt wurde und besser zu den Menschen da draußen paßte. Wenn sie erst meine Bücher kauften und läsen, würden sie mich mit ›Hallo‹ begrüßen und mich in Gespräche ziehen, anstatt sich vor mir zu erschrecken.
So saß ich am Schreibtisch und dachte nach.
Ich dachte zum Beispiel über meine Kopfschmerzen nach; ob es eine Katastrophe sei, daß mir die Aspirintabletten ausgegangen waren, und ob der Kopf wohl explodieren würde, wenn ich Kaffee trank. Möglich war auch, daß der Kopf gerade dann ex- oder implodierte, wenn ich keinen Kaffee zu mir nahm. Schlimmer wurde es auf jeden Fall. Aber hätte ich mich schonen sollen? Faul im Bett liegen sollen wie ein einfacher Arbeitnehmer? Das konnte ich mir als Schriftsteller nicht erlauben. Ich mußte am Schreibtisch ausharren und nachdenken.
Ich riß ein paar Zuckertütchen auf, die ich bei einem Schnellrestaurant amerikanischen Zuschnitts, gleich um die Ecke, gestohlen hatte, und süßte den Kaffee. Die Augen schmerzten. Das Licht fiel trübe in die zugehangene Bude, verlor sich irgendwo oberhalb des Fensters, verharrte unwillig an der Decke, ohne Notiz von mir zu nehmen. Natürlich saß ich direkt vor dem Fenster, mit meinem Schreibtisch und meiner Schreibmaschine, während hinter meinem Rücken die Dunkelheit gähnte. Ach, ich fühlte mich nicht gut. Es war ein Elend, Schriftsteller zu sein und keinen Erfolg zu haben. Immer wieder rieb ich an meinen schmerzenden Augen herum, preßte den Kopf zwischen die Fäuste, rief:
»Kopfschmerzen, geht weg!«
Doch dann kam mir die eine und die andere Idee. Warum sollte ich nicht einen Roman über den ›Neger‹ Billerbeek schreiben? Nein, nein, schon der Name war unmöglich. Ich würde ihn natürlich anders nennen, aber trotzdem; wer so hieß, konnte nicht besonders interessant sein. Was wußte ich überhaupt von ihm? Nichts, nur daß er ein verbranntes Gesicht hatte – vielleicht hatte er auch nur als Kind die Pocken gehabt, aber ging das heutzutage noch so verheerend aus? – und daß er, bei diesem Gesicht, das immerzu zu grinsen schien, eine viel zu schöne Freundin besaß. Tatsächlich unternahm er nichts, um dem Eindruck des ewigen Grinsens entgegenzuarbeiten; zweifellos mochte er es, daß alle Welt dachte, er grinse viel. Genau das war der Punkt, wo mein Roman einsetzen mußte!
Doch andererseits – wer wollte darüber etwas lesen? Die Feuilletonisten würden derlei nicht zur Kenntnis nehmen – ein Behinderter, über den sich der Autor lustig zu machen schien, nein. Wenn sich Billerbeek in dem Roman wiedererkannte, war er traurig. Die schöne Freundin würde ihn verlassen, würde mich wütend in meiner staubigen Dachkajüte besuchen. Dagegen war nichts zu sagen, aber der Grinser selbst würde auf leisen Sohlen stumm grinsend auf mich zukommen und mit knarriger Leierstimme fragen: »Du hast geschrieben?«
So war er, er sprach nie in ganzen Sätzen. Wenn ich wenigstens dabei berühmt wurde! Aber, der Frühling war noch immer da, die Luft draußen strich köstlich frisch um die Haut, wenn ich nur wollte. Sicher gingen dann auch die Kopfschmerzen weg. Ich mußte nur jemanden haben, der mit mir spazierenging. Hatte ich denn keine Freunde mehr? Nein, hatte ich nicht, als Schriftsteller schon ganz bestimmt gar nicht, auch nicht diesen Menschen in München, dessen Bücher ich las, der aber von mir nichts wußte, da meine Bücher noch nicht erschienen waren.
Neben der Schreibmaschine stand, auch wenn es sich nie meldete, ein rabenschwarzes Porzellan- oder Bakelit- oder Bleizementtelefon; ein schweres Ding, das man kaum heben konnte. Der Hamburger Dichter Klopstock hatte es 1795 hier installiert, in diesem Raum, in dem ich mich befand. Anfangs hatte ich noch Aufträge bekommen – natürlich nur ganz wenige, aber dennoch lukrative. Ein Mann rief an und sagte, ich solle über dieses oder jenes schreiben. Das tat ich dann und bekam drei Wochen später schrecklich viel Geld. Der Mann rief kein zweites Mal an, und die Sachen wurden Gott sei Dank nicht veröffentlicht – denn das hätte meinen Namen und meine Schriftstellerkarriere zerstört. In Deutschland, und ich weiß nicht, ob es in anderen Ländern ähnlich ist, darf man als Schriftsteller nicht für bestimmte Schweine-Zeitungen schreiben. Tut man es und der Name steht darunter und wird in jedes Dorf getragen, ist es vorbei mit den bürgerlichen Ehrenrechten: Kein anständiger Mensch gibt einem dann noch die Hand. Da ich das wußte, hoffte ich, es würden andere als diese Zeitungen einmal anrufen. Aber nein, es waren immer die gemeinen Schweineblätter. Um nun nicht gedruckt zu werden, schrieb ich ganze Romane für die unseriösen Auftraggeber, gezwirbelte Exkurse, die sie nicht mehr retten, nicht mehr redigieren konnten. Seltsamerweise überwiesen sie trotzdem hohe Honorarsummen – offenbar war es ihr Prinzip, Geld zu zeigen, im Sinne von ›Flagge zeigen‹. Der schreibende Mensch sollte immer gezeigt bekommen: Hier gibt es Geld, unter allen Umständen. Heute und in hundert Jahren. Du mußt nur weich werden.
Schließlich rief niemand mehr an. Obwohl kurz darauf Hunger und Elend in mein Leben einzogen, dankte ich Gott, daß ich die Leute los war, denn nun stand meiner Schriftstellerkarriere nichts mehr im Weg. Mir mußte nur noch das richtige Thema einfallen – kein Problem für einen so klar denkenden Geist wie mich.
Sollten doch andere auf den beginnenden Sommer hereinfallen! Ich hatte genug gehabt von der Welt, schon in frühen Jahren. Mädchen? Frauen? Hatte ich alles hinter mir. Wir mußten alle einmal sterben. Jugend? Ich war nicht mehr jung, ich machte mir nichts vor, war abgeklärt und weise. Dieses lächerliche Jungseinwollen! Dieses Den-Tod-nicht-wahrhaben-Wollen! Eine Frau ist eine Frau, hat ein russischer Dissidentenschriftsteller einmal gesagt, ich hatte das gerade in einer Fachzeitschrift gelesen. Ja, ich las normalerweise diese Fachzeitschriften nicht, genausowenig das Feuilleton. Aber diese Zeitschrift kam mir irgendwie angenehm textlastig vor, ich guckte hinein und las aufs Geratewohl ein Interview mit dem Dissidentenschriftsteller. Da stand, er sei kein Dissident, Dissidenten gebe es gar nicht, nur Simulanten. Es gebe auch keine Lager in Rußland, sondern einen netten Geheimdienst, der ihm zum Beispiel ein Ticket in die Vereinigten Staaten besorgt habe. Dann fragte die Interviewerin ungefähr folgendes: Herr Schriftsteller, Sie haben so viele Frauen und Ehen gehabt, ist da Ihre Einstellung zu Frauen nicht zwangsläufig zynisch und gleichgültig geworden? Der Mann sagte nun, eine Frau sei eben eine Frau und er habe das Jahr 1976 überlebt, als ihn ›Helena‹ (oder so ähnlich) verließ. Ja, er sei so stark gewesen, daß er damals NICHT Selbstmord gemacht hatte! Er sah die Frau triumphierend an. Im übrigen, fuhr er leise fort, glaubte er inzwischen nur noch an sich.
Ja, das verstand ich! So waren wir, die Schriftsteller. Natürlich gab es noch kleine Unterschiede. So glaubte ich noch zusätzlich an die Polizei, an Deutschland, an die Geschichte und die weiterwirkende Kraft der Sozialdemokratie, an den Bundestag, die Tagesschau und sogar an die Freundschaft mit unserem französischen Nachbarn.
Nur mit den Frauen war ich fertig, wie der Kollege. Wenn es nun aber gerade DARAN lag, daß mir der erste Roman nicht glücken mochte? Vielleicht ging es nur um den Anfang, um den ERSTEN Roman, danach konnte ich ja die Frauen wieder Frauen sein lassen! Einmal noch ein kleines Abenteuer, eine kleine Inspiration – und die Karriere brach sich Bahn. Ein Kuß einer Fremden, unter blühenden Apfelbäumen, im Monat Mai, und das Gehirn war startklar. Sicher ging es nur darum. Das Gehirn war bloß blockiert, brauchte einen kleinen Stoß von außen. Ja, ja! So war es.
Die Kopfschmerzen dröhnten scheußlich durch die Birne, kreisten irrläufernd um die inneren Augäpfel; höchste Zeit, daß das aufhörte. Da konnte ja kein vernünftiger Mensch arbeiten! Wenn ich draußen nur jemanden fand, der mich bald küßte – Lust auf lange Debatten verspürte ich wirklich nicht. Zuletzt hatte ich in dieser Hinsicht Pech gehabt. Ich erinnerte mich durchaus an eine öffentliche Veranstaltung, die ich aufgesucht hatte; nur vierzehn Tage war das her. Ich redete wohl eine gute Stunde mit einem jungen Mädchen, aber hatte es mich geküßt? Nicht in tausend Stunden. Ich hätte es noch mit ganz anderen Mitteln versuchen können, und es wäre doch nur zu weiteren Gesprächen gekommen. Das Mädchen hatte mich sogar, nach Ende der Stunde, gefragt, ob sie mich nicht besser siezen solle.
Noch zu zwei weiteren Mädchen hatte ich in jener Zeit einen flüchtigen Kontakt gehabt, ohne daß ich geküßt wurde. Einmal telefonierte ich in einer Extra-Telefonzelle für Behinderte. Ich tat das immer, denn noch nie hatte ich es erlebt, daß ein Behinderter tatsächlich solch eine Zelle benutzte. Ich war immer der einzige, humpelte simulierend heran, während vor den anderen Zellen Leute warteten und Schlange standen. Nach meinem Anruf humpelte ich wieder weg, und die Zelle blieb leer. An dem Tag nicht. Ich sah verblüfft, daß, während ich telefonierte, ein hübsches Mädchen auf das Ende MEINES Behindertenanrufs wartete. Und behindert war es nicht, das Mädchen. Als ich sie zur Rede stellte, merkte ich, daß es sich um eine Amerikanerin handelte. So sagte ich:
»This is a telephone cell for people with only one leg.«
Sie fragte, warum ich dann dort telefonieren dürfe.
So kamen wir ins Gespräch. Vielleicht gefiel es mir, daß sie mich spontan für das Gegenteil eines Krüppels gehalten hatte – tatsächlich besaß ich eine Pferdegesundheit, trotz der vielen Depressionen und Kopfschmerzen. Es war an jenem Tag ein Reaktorunfall in der Sowjetunion geschehen – natürlich kein schwerer, aber die Nachrichten waren voll davon. Ich hatte plötzlich die Idee, daß die Amerikanerin, die kein Deutsch konnte, noch nichts davon gehört hatte. Ich sagte also:
»By the way: did you hear about the nuclear holocaust in Russia this morning?«
»What?«
Ich erklärte es ihr in bombastischen Worten. Dreißig Millionen Russen seien verseucht, die meisten wahrscheinlich vom sicheren Tod gezeichnet, der Rest fliehe wie eine in Panik geratene Rinderherde gen Westen.
»Oh no!«
O doch. Das Kernkraftwerk sei wie eine Bombe hochgegangen, der Reaktorkern habe sich in den Planeten gefressen und durchdringe die Erdkugel wie ein glühendes Zehnpfennigstück eine Eistorte. So redete ich weiter, einfach, weil das Thema dazu einlud. Eine hochradioaktive Wolke wandere nach Skandinavien und Westeuropa. In Finnland müßten bereits alle Menschen in den Kellern bleiben.
Nun wollte sie wissen, ob die Wolke auch nach Amerika komme. Ich winkte ab und lachte. Nein, Amerika sei sicher, aber es habe keinen Zweck, sich um einen Flug zu bemühen. Selbstverständlich seien alle Flüge zum rettenden anderen Kontinent längst ausgebucht. Ich betrachtete sie und dachte schon, es müsse sich um ein amerikanisches Fotomodell handeln. Sie begann mir zu gefallen, obwohl sie nichts Liebenswertes an sich hatte. Doch dann sagte sie, das sei ja schrecklich, fast so schlimm wie die Sache mit den Terroristen.
Ich verabschiedete mich enttäuscht, denn sie war offensichtlich nicht wirklich zu beeindrucken. Wenn man einen Menschen nicht beeindrucken konnte, konnte man auch auf keinen Kuß hoffen, was mir damals natürlich fern lag zu erwägen. Also, die dritte Begegnung gab es mit einer Französin. Ich war mit ihr zusammengerumpelt, weil sie mit einem Walkman versehen autistisch wie ich durch die Innenstadt tappelte. Da sie sehr schön war, sagte ich:
»Ich freue mich, daß ich dich kennenlerne!«
Sie sah mich unschlüssig an, und da ich so erwartungsfroh vor ihr stehenblieb, sagte sie, ohne jede Begeisterung, ich wolle wohl gerade irgend etwas trinken gehen?
»Ja, das ist eine gute Idee.«
Wir gingen ein paar Schritte bis zum nächsten Straßencafé, tranken einen Espresso, und ich stellte fest, daß ich mein ganzes Französisch verlernt hatte. Das Radebrechen war nicht ergiebig, so daß diese junge Frau nach höflichen zehn Minuten für uns beide zahlte und ging. Immerhin: Gerade weil ich nichts verstand, war die Herausforderung gewaltig. Nie hatte mich etwas so sehr angestrengt. In früheren Jahren gab es diese geselligen Psycho-Spiele, etwa ›kollektives Schweigen mit Anfassen‹, oder ›Eine Minute nonstop in die Augen sehen, lautlos, bei gleichzeitiger Berührung der Nasen‹, und daran mußte ich nun denken. Nein, ohne Sprache lief es nicht.
Ich ging weiter durch die Stadt, es wurde heißer und heißer, bis ich traurig wurde und den Weg zu meiner Dachwohnung einschlug. Unterdessen überlegte ich aber, ob ich nicht doch einen ganz legalen Besuch bei der Freundin von Billerbeek machen sollte – immerhin war sie nicht weit entfernt. Das hatte auch nichts mit dem Roman zu tun, den ich womöglich über ihren Freund, den alten ›Neger‹, verfaßte. Ich tat es sowieso nicht, keine Bange, mein Verleger hielt nichts von dem Stoff, soweit kannte ich ihn. Weder schrieb ich über den ›Neger‹, der natürlich kein Neger war und nur ein mißgestaltetes Gesicht hatte, noch interessierte ich mich für seine Freundin; die beiden Menschen hatten ohnehin nichts Interessantes an sich, sie wohnten nur in der Nähe, als einzige, so wahr mir Gott helfe, wirklich als einzige. Ich hatte mit ihnen nichts zu tun, nur abends, wenn die Geschäfte schlossen, die Banken- und Versicherungskomplexe sich leerten, die Innenstadt wie tot dalag, gab es in der ganzen Straße nur noch den Neger und seine Freundin. Einmal war ich vor lauter Einsamkeit einfach zu ihnen gelaufen. An dem Tag nun, als ich mit der Französin ins Schwitzen gekommen war, ging ich wieder hin. Nur für eine Minute. Ich wollte nicht sofort in meine stickige Schreibstube hinauf. Und womöglich war der Neger nicht da, wohl aber seine unversehrte Freundin, ein liebreizendes Mädchen übrigens, gegen das man nichts haben konnte. Ich näherte mich dem rußgeschwärzten, im Putz abblätternden Vorderhaus.
Wenn Billerbeek einmal ein Kind bekam, hatte es vielleicht das gleiche verbrannte Gesicht wie er. Dem Mädchen würde man auf den Kopf zusagen: Du hast das Kind von Billerbeek! Ich überlegte, ob ich daraus nicht einen Thriller machen könnte. ›Die Rache des Fratzenmannes‹. Womöglich war der arme Junge innerlich bis an die Halskrause mit Rachegefühlen gegen die Welt angefüllt, war voller Haß, so mild er auch schien, äußerlich. Im Grunde interessierte mich das Mädchen aber mehr. ›Die Frau des Fratzenmannes‹. Das war die Madame-Bovary-Schiene, das lief unter Weltliteratur. Die thrillermäßige Hochliteratur oder eine Trilogie: ›Die Heimkehr des Fratzenmannes‹, ›Fratzenmanns Sohn‹ und eben ›Die Frau des Fratzenmannes‹. Da gab es viele Möglichkeiten. Für eine Sekunde glaubte ich, bereits auf der Fährte zum Romandurchbruch zu sein, indem ich nur die paar Schritte zur Kellerwohnung Billerbeeks weiterging.
Im Innenhof dämmerten nutzlose Ziegel, Reifen, alte Fahrräder, ein Vorkriegsmotorrad. Die Fenster in Kniehöhe waren zugenagelt, vermörtelt, versunkene Türen aus der Römerzeit zugemauert, weil ohnehin von den Jahrhunderten überwuchert. Der Boden hatte einst zwei Meter tiefer gelegen, also da, wo Fratzenmann Billerbeek jetzt wohnte, lebte, auf Rache sann. Ein schöner Stoff: sich vorzustellen, wie er von hier aus die Welt eroberte, ein krimineller Grundstücksspekulant wurde – immer mit seiner hübschen Frau als Visitenkarte, die er aber des Nachts bis aufs Blut quälte, die er mit nicht vorstellbarer Brutalität hörig und unglücklich machte! Bis zu dem Tag, da sie das stumme Grinsen ihres Mannes bereits wahnsinnig macht und sie beschließt, aus dem Fenster zu springen. Es ist derselbe Tag, an dem sie entdeckt, daß ihr Kind, ebenso verunstaltet wie der Mann, eine Eigenschaft geerbt hat, die ebenso unheimlich ist wie die äußerliche Verbrennung. Aber welche? Ich konnte nicht weiter darüber nachdenken, denn der Holzverschlag zum einzig intakten Fenster, das auch als Türe diente, öffnete sich.
Hinter einem mehrfach geteilten kleinen Glasfenster erblickte ich, von einer nackten 25-Watt-Glühbirne angestrahlt, wie in einem Wachsfigurenkabinett den seltsam kahlen Schädel von Billerbeek, der mich wohl schon längere Zeit bemerkt hatte und mich stumm angrinste. Ich kletterte durch das Fenster nach drinnen.
Billerbeeks Grinsen steigerte sich zu einem langsamen Lachen.
»Hm – hm – hm – hm!«
Er bot mir Kaffee an und stellte die üblichen Fragen. Strenggenommen war Billerbeek mein einziger wirklich häßlicher Freund. Ihm fehlten Lippen, Augenbrauen, Falten, Haare, Zähne. Er hatte das zwar alles, wirkte aber so, als wäre er ein Brandopfer. Seine Gesichtshaut bestand nur aus Narben. Wenn er stumm grinste, hatte er immer die Zunge draußen, die langsam die scheinbar verbrannten Lippen ableckte. Freilich – weniger sensiblen Menschen fiel das alles gar nicht auf. Sie hielten ihn für einen schlanken, großgewachsenen jungen Mann; einen grundguten dazu.
Billerbeek drehte gerade Zigaretten auf Vorrat, mit so einer Zigarettendrehmaschine.
»Da komm’ ich auf neun Pfennig das Stück. Das lohnt sich.« Offiziell war er also Student, in Wirklichkeit aber Zigarettendrehmeister. Er drehte die Dinger, auf einem Schemelchen sitzend, mit dreifach umeinandergeschlungenen Beinen, wie eine afrikanische Negerfrau vor dem Kral es gemacht hätte. So zierlich-unbeweglich, als hätte er noch eine Vase auf dem Kopf. Dann stellte ich wiederum die üblichen Fragen, während er die zuletzt aufmerksam gedrehte Zigarette in schweren Zügen rauchte, wobei seine Hand zwischen den Zügen auf seinem Knie zu liegen kam und dort schier stundenlang, als wäre sie aus Stein, verharrte. Schließlich fragte ich, wo seine Freundin abgeblieben sei. Mit schnarrender Stimme, ohne die geringste Anteilnahme, grinsend, klärte er mich darüber auf, daß sie nicht mehr da war.
»Nach Mün … chen. Zu … rückgefah … ren.«
Das ruinierte mir natürlich den ganzen Roman. Ohne Frau war der Fratzenmann nur noch die Hälfte wert, ganz abgesehen davon, daß mich die Frau sowieso mehr interessiert hatte, rein literarisch, aber auch menschlich. Ich ging.
Er gab mir die Hand und grinste auf die übliche Weise. Hatte uns drinnen eine funzelige 25-Watt-Birne leuchten müssen, stach mir nun die helle Sonne in die Augen. Um über den Verlust der Nachbarin hinwegzukommen – sie war einfach zu schön für ihn, so war die Welt, da gab es keinen Platz für Romane –, lief ich noch mal die Fußgängerzone ab, den Rathausplatz rauf und runter. Nachdem ich Billerbeek ausgiebig verflucht hatte, der weder mich noch seine Freundin inspirierte, ging ich stöhnend auf mein Zimmer.
Dort hielt es mich nicht lange. Nach ein paar trüben Gedanken über die Verhäßlichung der Städte – sollte ich nicht einen Roman über die Häßlichkeit der autofeindlichen Neugestaltung der Innenstadt schreiben? – zog es mich wieder genau da hin, in die häßliche neugestaltete Innenstadt. Ich setzte mich auf eine Bank einer Bushaltestelle, direkt in der größten Einkaufsstraße. Autos durften hier nicht mehr fahren, dafür wehte Unrat – Pappbecher, Servietten, Damenstrümpfe, Zeitungsprospekte – über den ausgewalzten Trottoir. Menschen rauschten vorbei, Massen, ganze Belegschaften, Kleinstädte, zellulitische Jahrgänge, Bundesländer, Erdteile. Das ausgehende Jahrhundert in seiner scheußlichsten Form dampfte vor meinen kranken Augen vorbei. Mir schienen sie nun alle wabblig und speckig zu sein, in hellblauen Schlüpfern steckend, die dicken Frauen; ich konnte gar nichts anderes mehr sehen.
In dem Moment aber verfing sich meine ohnehin diffuse Wahrnehmung bei einem vermeintlich gutaussehenden Mädchen. Wieder mal. Ich starrte ihr ins hübsche Gesicht. Sie ging sehr aufrecht, wie eine Giraffe, und drohte schon im Gewühl der Erdteile zu verschwinden, als ich aufsprang und hinterherlief. Nun war sie allerdings noch fast ein Kind, sechzehn vielleicht, und ich schämte mich. Vor allem: Würden ihr nicht bereits viele seltsame Männer heimlich folgen? Und mich sehen? Ich drehte mich um. Da war wirklich einer. Peinlich berührt, bog ich in ein Fotofachgeschäft ein. In ziemlicher Entfernung folgte ich nun dem Mann, einem jungen Bankangestellten mit Anzug und Aktenkoffer sowie englischen Gesichtszügen; einem Hübschling also, gegen den ich keine Chance besaß. Der Junge war auch gut erzogen, angenehm schüchtern, das sah man sofort, und für das Mädchen der ideale Sympath zum Knuddeln und Liebhaben, einer, der ihr sonntags das Kleinkraftrad putzte, die Vespa wohl. Tja, da konnte man sich ja für das bezaubernde Giraffenkind freuen! Doch – der junge Mann lenkte seine Schritte in eine Seitenstraße und schied plötzlich aus. Ich war mit einem Mal der einzige Bewerber, was mich verlegen machte. Die Unbekümmertheit war weg. Ich näherte mich dem Mädchen, das in eine Boutique eintrat, also in eine moderne Mädchenboutique, in der ich nichts verloren hatte. Ich ging trotzdem mit hinein.
Auf drei Stockwerken, die wiederum durchbrochen-durchlässig und durchgehend dekoriert wie ein einziger großer, turmhoher Raum waren, flirrte mir der Tand entgegen, den junge Mädchen aus guten Häusern offenbar gern befühlen und befingern. Dieses hier lebte zwischen den tausend Flauschpullovern und Moderöcken wie ein Fisch im Aquarium, das erkannte ich schnell. Das würde hier dauern. Mißtrauisch beobachtete ich sie aus den Augenwinkeln. Als ich gehen wollte, verirrte ich mich zwischen Spiegeln, Halogenlampen und Kleiderständern.
Wieder draußen, setzte ich mich auf einen neugestalteten Betonpoller vor dem Eingang. Mein Roman über die mißratene Innenstadt ging mir noch mal durch den Kopf.
Ausgangspunkt mußte sein, daß alles immer häßlicher wurde. Man konnte zum Beispiel an den über einen Zeitraum von fünfundzwanzig Jahren regelmäßig gedrehten James-Bond-Filmen gut die allgemeine Häßlichwerdung der Welt beobachten und ablesen. Teilweise an denselben Drehplätzen gedreht, gab es, je nach Drehjahr, unterschiedliche Grade der Verrottung.
Ein Wort kam mir in den Sinn, und damit starb der Roman: Umweltzerstörung. Nein, einen solchen Roman konnte ich nicht beginnen, lieber wollte ich mich an der Verrottung laben und die neue Massen- und Freßgesellschaft preisen in satten Farben. Der Biertölpel in klirrender Nietenmontur, der gerade auf mich zugetorkelt kam, er sollte hochleben. Ein Öko-Roman, nein danke. Zu retten gab es ohnehin nichts mehr. Alle historischen oder auch nur schönen Quadratmeter bei uns, in jeder Stadt, jeder Kreisstadt, jedem Dorf, jedem Weiler, waren fußgängerzonenartigen Bepollerungen zum Opfer gefallen, postmodernem Scheiß. Wo eben noch Geschichte atmete und roch, lärmte nun billiger Basalt, quietschten Disneylandfarben, fraßen sich Frittenbuden in die Gemäuer, verdienten Fools und falsche Feuer-Schlucker mit postmoderner Phantasie ihr Geld, neben Blaskapelle und Bierausschank, Feuerwehr, Schützenverein und Freier Theatergruppe! Aber andererseits – war es nicht undemokratisch, so zu denken? War es nicht das größte Verbrechen, massenfeindlich zu sein? Hatten nicht die Reichen nach wie vor alle Schönheit dieser Erde, freie Privat-Strände, saubere Ländereien, Schiffe und Schlösser? Schlösser, in denen die Geschichte ungestört atmete bis zum jüngsten Tag? O ja.
Noch einmal ging ich hinein in die Mädchenboutique. Das Mädchen schnupperte unverändert an den pastellhellen Sommerpullovern und schien ganz in ihrer Tätigkeit aufzugehen. War das nicht eigentlich recht langweilig? Würde ich bei ihr zu Hause nicht binnen weniger Tage den Feitstanz bekommen? Der erste Abend mochte noch schön sein, auch der erste Morgen. Man würde im Garten ihrer Eltern auf einer Schaukelbank sitzen und den Bäumen beim Blühen zusehen. Die Bienen würden brummend von Blüte zu Blüte fliegen. Stunden würde das so gehen. Aber dann – ich wagte nicht weiterzudenken. Diese Mädchen waren so unsicher und hilflos. Sie hatten nichts in der Hand, stürzten in einen Abgrund des Nichts. Schon nach der ersten Nacht standen sie mit dem Rücken zur Wand – furchtbar. Ich entfernte mich rasch und stürmte zur Straße.
Mädchen, da kannte ich mich aus. Ha! Da konnte es keine Enttäuschungen mehr geben, außerdem mußte ich jetzt meinen ersten großen Roman schreiben. Ich lief mit langen Schritten in Richtung Dachwohnung. Zuletzt hatte ich ein Mädchen gehabt, das dachte immer, ich wollte ihr etwas vorwerfen. Wenn ich sagte, wieviel Uhr ist es, antwortete sie pampig, dafür könne sie doch nichts, daß es schon soundso viel Uhr sei. Oder erst sei. Oder, und nun wurde sie wirklich böse, ich wolle sie wohl loswerden, wenn ich ständig ostentativ nach der Uhrzeit frage. Wenn ich das abstritt, war sie endgültig eingeschnappt, denn sie meinte, ich hielt sie für unwissend und dümmlich. Herzzerreißend klagte sie dann, ja ja, sie habe unrecht, denn sie habe ja IMMER unrecht, immer und ewig, denn sie sei dumm und unwichtig. Dieses würde ich denken, denn sonst würde ich ihr nicht andauernd widersprechen. Und so weiter. Ja, ich kannte mich aus mit Mädchen. Alles, was noch kommen konnte, konnten nur Wiederholungen sein. Lieber bereitete ich mich auf den Tod vor, der ja auf alle Menschen wartete, als daß ich unreifen Küken beim Weichpulloverschnuppern zusah. Alles zu seiner Zeit! Erst das Leben, dann die Literatur, schließlich der Tod. Und überhaupt: Ganz am Ende, beim zweitenmal in der Boutique, war mir aufgefallen, daß das langbeinige Füllen wohl schöne lange Beine hatte, aber auch, wenn es zu Boden guckte, ein leichtes Doppelkinn. Das Kinn selbst war nicht besonders ausgeprägt, nicht gerade fliehend, aber auch bestimmt nicht selbstbewußt-willensstark. Genau das aber hätte ich gerne gehabt.
In der Dachwohnung lastete schon jetzt eine Sommerhitze, die es draußen noch nicht gab. Im Nu heizte das sich erwärmende Holz die stickige Luft auf – schlechte Voraussetzungen für einen Schriftsteller, der mächtig nachdenken mußte. Ich setzte mich schwitzend an den Schreibtisch und starrte auf das fleckige Leinentuch, das das Fenster zuhängte.
Die Vögel hörte ich von dieser Position aus stärker als draußen. Draußen waren überhaupt keine mehr. Man gaukelte mir etwas vor, den Frühling nämlich, den es zwar gab, aber sicher nicht SO SCHÖN. Oder doch? Nachts gab es nun immer schwere, warme Gewitter, viel Wasser, das da runterkam und Luft und Erde schwängerte, versuppte, feuchtete und den Grünbestand zum unkontrollierten Wuchern brachte. Junge Leute fuhren mit neuartigen Enduros darüber, das waren leichtgewichtige Geländemotorräder.
Ach, es war ein blödes Leben, das ich als Schriftsteller führen mußte! Ich lebte ohne Spaß, ohne Lachen. Verständlich, daß andere nicht die Kraft besaßen, sich durchzubeißen wie ich. Der Kopf war leider nicht so klar wie sonst, leichte Kopfschmerzen arbeiteten hinter der Stirn, und ich beschloß, mich erst ein bißchen auszuruhen. Ich schlief ein Stündchen und fühlte mich dann tatsächlich frischer.
Beim Einschlafen hatte ich noch mein Herz vor Angst schlagen gehört, so laut, daß ich es für dumpfe Schritte im mittelalterlichen Treppenhaus hielt. Aber dann hatte ich alle Kümmernisse im Schnellverfahren weggeschlafen. Jetzt oder nie, rief ich aus, wollte ich meinen Roman festlegen, per Dekret. Ohne nachzudenken, wollte ich meinen Zeigefinger in die Luft stoßen und von da auf die Tastatur der Schreibmaschine. Welche Themen standen zur Auswahl? Noch nicht viele, ich mußte noch sammeln. Also … vielleicht … etwas über Arme und Reiche? Irgendwo hatte ich gerade gelesen, die Reichen im Lande seien, nach dem Wegsterben alter Führungseliten, schamlos geworden – hier in Deutschland, woanders nicht. Aber wie sollte ich das nachprüfen? Mir fiel ein, daß es in der ›DDR‹ keine Prostitution gab, also auch keine Zuhälter, bestochenen Polizisten, Mörder, keine muskelbepackten Gorillas, die unglücklichen Töchtern einheizten und sie ängstigten. Das war ein interessanter Ausgangspunkt; ich mußte mich einmal ins Herz einer DDR-Bürgerin hineinversetzen. So eine Frau ging sicher vollkommen angstfrei durch die hübschen Straßen von Halle oder Leipzig, während sie hier, im freien Westen, an einem schwülen Frühsommerabend, gleich von Kriminellen aller Art bedroht wurde. Die DDR war, das war die einfache Erklärung, der Staat der Frauen. Seltsam, daß das noch keiner entdeckt hatte. Ich mußte nach Halle fahren, dort ein halbes Jahr bleiben und dann mein Buch vorlegen: ›Staat der Frauen‹.
Die Verleger hätten die Hände vor dem Kopf zusammengeschlagen: Nichts galt in jener Zeit, als ich unbedingt Schriftsteller hatte werden wollen, weniger als der Ostblock. Eine Art von Antikommunismus lag in der Luft, der hundertfach stärker war als jener zu Zeiten des Kalten Krieges. Das Moskauer Regime schien auf eine ähnlich grundsätzliche Weise besiegt zu sein wie der Faschismus am 8. Mai 1945 – alles floh weit weg und beteuerte, nie etwas damit zu tun gehabt zu haben: die Politiker, Journalisten, Modeschreiber und Feuilletonisten. Mein DDR-Roman hätte somit den gleichen ›Erfolg‹ wie ein Roman über Adolf Hitler als Tierfreund. Nein, ich mußte ein Thema wählen, das im Trend lag.
Vielleicht etwas Autobiographisches? Nein, lieber wollte ich das lassen, nein, nein. Alles Nette hatte ich vergessen, und alles Fürchterliche war mir verständlicherweise unangenehm. Aber die Leute verlangten danach! Konnte ich mich dem entziehen, wo ich doch Schriftsteller war? Gewiß nicht. Ich begann zu stochern. War da nicht eine frühe Schwester gewesen, oder zwei Brüder … der Vater Kriegsspätheimkehrer, das heißt, das ging nicht, das würde ja eher auf den Großvater gepaßt haben. Also noch einmal. Das Wirtschaftswunder, doch Erhard mußte gehen, und Kennedy wurde ermordet. Adenauer kam und brachte alles wieder in Schwung, vor allem die Erfassungsstelle für Wiederholungstäter gesamtdeutscher Verbrechen, sein Atomminister sorgte für alles Mögliche, bis zur Spiegelaffäre. Augstein wurde Außenminister unter einem sozialdemokratischen Kanzler, und ich kam auf das Gymnasium. Nein, das interessierte niemanden.
Mein Leben. Ich erinnerte mich noch, als sei es erst gestern gewesen, als mein Onkel Sowieso zum erstenmal mit einem Spielzeugauto der Marke XY nach Hause kam. Kindheit war das letzte. Ich hatte einmal eine Autobiographie Schnitzlers gelesen: Da konnte sich der Mann auch an nichts erinnern. Da war es schon besser, ich hielt mich an die jüngere bis jüngste Vergangenheit. Es war doch erst wenige Jahre her, da hatte ich Freunde und Freundinnen besessen – über die könnte ich nun berichten, ohne mich anstrengen zu müssen. Andererseits – wenn alle Welt amerikahörig geworden war, mußte ich nach Amerika fahren und vor Ort berichten. Wen interessierten schon meine ehemaligen Freunde, die ohnedies recht wunderlich und idiotisch daherkamen? In Amerika konnte ich atemlos über die neuesten Errungenschaften in Politik, Leben, Unterhaltung und Lifestyle erzählen: neue Farben, neue Stoffe, neue Drinks, neue Begriffe. Doch dann dachte ich: Ein Schriftsteller sollte sich allerdings mehr an Zeitloses halten. Ich war doch kein blöder Journalist! Meinen Roman mußte man auch in hundert Jahren noch lesen können. Außerdem: Wer gab mir das Geld, nach Amerika zu fahren? Der Verleger! Den mußte ich von meinem Thema überzeugen! So einfach war das. Schließlich galt es als gesichert, daß ich ein Talent zum Schreiben hatte – jeder, der meine seltsam literarischen Artikel für die Schweineblätter in die Hand bekam, erkannte das widerspruchslos an. Ja, schreiben konnte ich. Millionen konnten schreiben, aber nur ich war, darüber hinaus, ein echter Schriftsteller.
Ja, ja, ja, ja. Soweit war alles klar. Womöglich reichte es auch, nach England zu fahren. England war nicht so teuer und auch ganz interessant.
Ich machte mir ein eiskaltes Tuch, das ich mittels eines kalten Schals um die Stirn band; das sollte die aufkeimenden Kopfschmerzen zurücktreiben. Der alte Schal muffelte, das Tuch war eher laukalt als eiskalt, nur vom Leitungswasser gekühlt. Nun, ich war froh, daß ich überhaupt diesen einen Wasserhahn mit Leitungswasser besaß.
Weiter! Ich fuhr also nach England und berichtete über meine idiotischen Ex-Freunde. England war schon deswegen gut, weil – tja, das ist eine kleine Geschichte. Einmal also hatte mich, Ende gut, alles gut, eine Zeitung angerufen, die nicht zu dem Schweineblätterkonzern gehörte und für die man als Ehrenmann schreiben durfte, ohne anschließend geächtet zu sein. Die Leute, verschnarchte Feuilletonisten von vorgestern, baten mich um einen Meinungsartikel. Nun haßte ich es, Meinungen herzustellen, denn als Schriftsteller mochte ich stets erzählen, anstatt zu räsonnieren. Meiner Ansicht nach war eine Schilderung jeder Meinung überlegen. Meinungen waren etwas für unsichere Leute mit einem Minderwertigkeits- oder auch Bildungskomplex. Klar. Natürlich sagte ich das nicht, sondern machte mich freudig an die Arbeit. Am nächsten Morgen hatten die Zeitungsleute zweieinhalb Pfund wohlfeile Meinung im Briefkasten; jedoch, sie meldeten sich nicht. Erst vier Wochen später, wie es die Art dieser Honoratioren war, bekam ich Antwort. Sehr schön, lobte eine sonore Altherrenstimme, aber es müsse noch einmal überarbeitet werden. Ich bekam also die Sachen zurück.