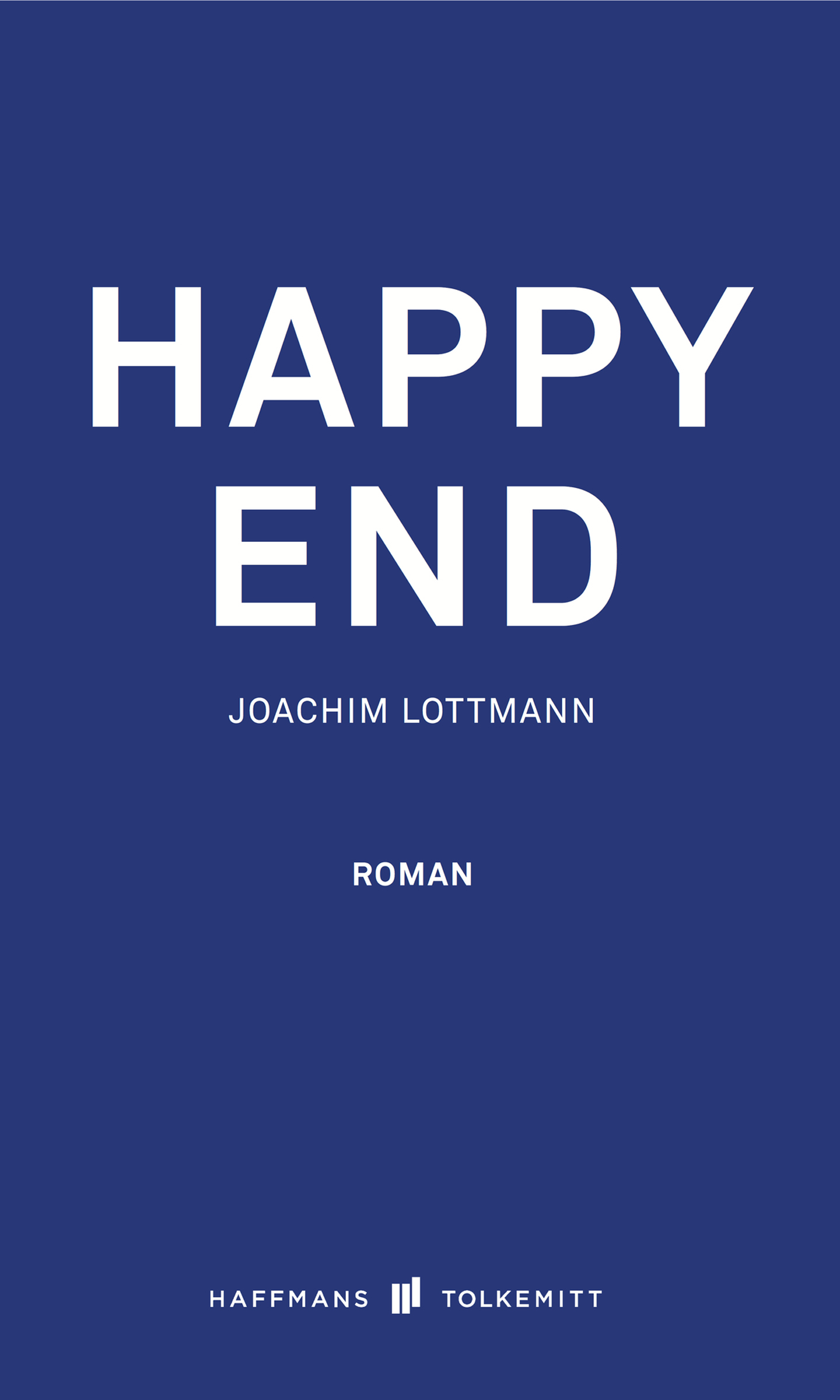
14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Haffmans & Tolkemitt
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Johannes Lohmer hat es geschafft. Jahrzehntelang hat er als Schriftsteller um Anerkennung gekämpft, jetzt ist er endlich im Literaturbetrieb angekommen: Die Leserschaft liebt ihn, das Feuilleton singt sein Lob. Zu allem Überfluss findet er in Wien auch noch die Frau seines Lebens. Doch das Glück ist der Tod jedes ernsthaften Schriftstellers, das weiß Lohmer nur zu gut. Er würde liebend gern aufs Schreiben verzichten, wenn es nicht einen Ruf zu wahren gälte - vor Kollegen und Journalisten, vor dem Hausverlag und nicht zuletzt vor der Ehefrau. So beschließt Lohmer, den Schein des Schriftstellers zu wahren und macht sich daran, aufs Geratewohl einen Text in den Computer zu hacken. Was entsteht, ist ein grandios komischer Monolog wider Willen - über alles und nichts, über das Leben, die Liebe und die Literatur - sowie über seine verflixte Aufgabe, nebenbei einen würdigen Nachfolge-Preisträger für den renommierten Wolfgang-Koeppen-Preis zu bestimmen, was sich als schwieriger herausstellt als zunächst gedacht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Joachim Lottmann
Happy End
Joachim Lottmann
Happy End
Roman
Deutsche Erstausgabe
1. Auflage, Mai 2015
© 2015 Haffmans & Tolkemitt GmbH,
Inselstraße 12, D-10179 Berlin.
www.haffmans-tolkemitt.de
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das Recht der mechanischen, elektronischen oder fotografischen Vervielfältigung, der Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen, des Nachdrucks in Zeitschriften oder Zeitungen, des öffentlichen Vortrags, der Verfilmung oder Dramatisierung, der Übertragung durch Rundfunk, Fernsehen oder Internet, auch einzelner Text- und Bildteile, sowie der Übersetzung in andere Sprachen.
Lektorat: Heiko Arntz, Wedel.
Umschlaggestaltung: Natalie Dietrich/metaphor.me
Produktion von Urs Jakob,
Werkstatt im Grünen Winkel, CH-8400 Winterthur.
Satz: Fotosatz Amann, Memmingen.
E-Book Konvertierung durch Calidad Software Services, Puducherry, Indien
ISBN 978-3-942989-091-6
»Was ist der ultimative Flash?
Hundert Tage Alkohol?
Ein Jahr Kokain?«
Es gibt ja diesen Fall von diesem, äh, amerikanischen Dramatiker, Henry Miller, oder Arthur Miller, der mit Marilyn Monroe verheiratet war und danach nicht mehr schreiben konnte. Oder, nein, der sich von Marilyn scheiden ließ und irgendwann eine andere Frau gekriegt hat, und die war dann seine große Liebe, und mit der war es so toll, daß er nie mehr schreiben konnte. Mit der ist er heute noch zusammen. Also, wenn er noch leben sollte, wie es ja im Märchen immer heißt: wenn sie nicht gestorben sind. Sollte er/sie schon gestorben sein, konnte ich es nicht mitkriegen, denn Arthur Miller hat ja seit einem halben Jahrhundert nichts Vernünftiges mehr aufs Papier gebracht. Er hat natürlich weiter fleißig geschrieben, bestimmt sogar noch mehr als vorher, denn mit Fleiß kompensiert man immer das versiegende Talent, aber es war alles komplett wertlos. Sogar seine Biographie – bestimmt hieß sie ›Leben mit Marilyn‹ – war völlig reizlos. Über Marilyn stand nichts drin, was von Interesse wäre, denn er wollte seine neue Frau nicht kränken. Tja, und so ist dieser Schriftsteller zwar glücklich geworden, aber mögen konnte ich ihn trotzdem nicht mehr. Ich fand immer, daß dieses Schicksal auch mir bevorstehen würde. Einmal würde ich, ja, auch ich, der Liebesunfähige, einen Menschen finden, egal ob Frau oder Mann, der mich erlöste. Warum ich das dachte? Es war so eine bestimmte Ahnung. Die Frucht aller Beobachtungen von Kindesbeinen an. Es mußte für alle Rechnungen des Lebens logischerweise zumindest theoretisch ein Ergebnis geben. Die Tatsache, daß scheinbar die meisten Menschen dieses Ergebnis nicht mehr rechtzeitig in Erfahrung brachten, störte mich nicht. Sie starben einfach zu früh. Aber daß ich lange, sehr lange leben würde, stand für mich immer fest. Ich hatte Zeit. Deswegen war ich ja Schriftsteller geworden. Niemand hat soviel Zeit im Leben wie ein Schriftsteller. Bücher waren mir nie wichtig an diesem Beruf, die Zeit war es. Und was soll ich sagen, eines Tages passierte es: Ich fand die sogenannte Frau meines Lebens. Also wirklich jetzt. Die Frau, ich muß gar nicht ausweichend sagen der Mensch, nein, ganz und gar die Frau, mit der die Liebe plötzlich klappte, fiel wie vom Himmel direkt in meine Arme. Vielleicht sollte ich es nicht so kitschig ausdrücken, schließlich stehen mir als Berufsautor auch weniger verbrauchte Worte zur Verfügung. Also, ich werde das später erzählen, wie ich meine Frau kennenlernte, wie wir geheiratet haben, wie wir uns vom ersten Moment an gut verstanden, wie wir niemals, tatsächlich niemals Beziehungsgespräche führen mußten oder Dritte unsere Loyalität füreinander stören konnten. Nein, im Moment will ich nur sagen, daß ich glücklich bin und nicht mehr schreiben kann. Denn eines dürfte klar sein: Wer im Schnitt sechs Stunden am Tag gern mit einem bestimmten anderen Mitbürger redet, der hat keine Veranlassung, auch nur noch eine einzige Zeile zu schreiben. Warum sollte er? Man schreibt, was man nicht sagen kann. Kann man alles sagen, fällt der Grund zum Schreiben weg. Da man dennoch weiterleben und Geld verdienen muß, macht man es wie Arthur Miller: Man übt sich in der biederen Kunst des Scheinschreibens. Unter falschem Etikett drechselt man nichtsnutzige Werke und kassiert dafür fette Vorschüsse. Die reichen immer für ein Jahr oder zwei. Den Ruhm aus früheren Büchern kann einem keiner nehmen, es ist wie der lebenslange Ehrensold des Bundespräsidenten. Auch die Kritiker machen das falsche Spiel mit. Denn nun hat man ja endlich die Muße und den Frieden, mit ihnen essen zu gehen und Freundschaft zu schließen. War man früher wütend, verzweifelt, engagiert und machte sich überall Feinde, kann man nun fünfe gerade sein lassen und allen Dummköpfen der Branche recht geben. Man will nichts mehr geändert haben, denn das Leben ist so schön geworden! Tja, so ging es auch mir, und niemand bekam mit, daß ich gar nicht mehr schreiben konnte. Dafür war ich zum ersten Mal seit Ewigkeiten reich. Zuletzt hatte ich als Student soviel Geld in der Tasche gehabt, als Sproß einer reichen Hamburger Politikerfamilie. Dazwischen lagen viele Jahrzehnte der schriftstellertypischen Not.
Nicht mehr schreiben können ist eine feine Sache. Denn es bedeutet in Wirklichkeit, nicht mehr schreiben zu müssen. Jeder echte Schriftsteller tut es ja ganz und gar aus Getriebenheit. Das ist eine altbekannte Wahrheit, so platt wie zutreffend. Es gibt zwar unendlich viele Deutsche, die Manuskripte herstellen und dafür die über tausend jährlichen Buchpreise erhalten, und sie sind kein bißchen getrieben und schreiben auch nur Mist, aber das ignorieren wir noch nicht mal. Wir wollen hier nicht rumschimpfen. Das interessiert uns, das echte. Das von echten Schriftstellern. Das sind immer die, die keine Preise kriegen. Wie gesagt, nicht mehr schreiben zu müssen ist fein. Man darf nun einfach nur tippen. Das ist das, was ich gerade mache. Meine liebe Frau liegt auf dem Sofa und denkt, ich würde schreiben. Dabei klappere ich nur lustig auf den Tasten des kleinen feuerwehrroten Laptops herum. Ich habe der Welt nichts mitzuteilen. Gewiß, es könnte ein Problem sein, nichts mehr mitzuteilen zu haben, der Stadt und dem Erdkreis, den Kollegen und den Kritikern, und aus diesem Problem könnte sich ein Leiden einstellen und so weiter, aber das wäre gelogen. Ich leide nicht, ich bin sogar immens froh, endlich nicht mehr zu leiden. What the fuck soll daran falsch sein? Man muß das große Ganze im Blick haben, den Sinn. Mein Leben hat auf den letzten Metern noch einen Sinn bekommen, und der Literaturbetrieb kann mich mal. Mit anderen Worten: Meine Frau liest gerade ›Imperium‹ von Christian Kracht und fühlt sich wohl. Sie hat heute einfach blaugemacht, ist nicht zur Arbeit gegangen. Mit mir ist der Tag ja viel schöner, auch wenn ich nicht mit ihr rede, sondern schreibe. Also zum Schein schreibe. Für sie ist es ja kein Schein. Sie denkt, ich schreibe wirklich. Wie die Frau in ›Shining‹, die immer hört, wie Jack Nicholson in die Tasten haut. Ein großes Werk entsteht, denkt sie. Der Mann in ›Shining‹ hat immer nur einen Satz getippt, immer denselben, was ich anstrengend finde. Viel angenehmer ist es, so verspielt und sinnfrei zu klimpern wie ich jetzt. Das hat den Vorteil, daß die von mir durch Freundschaft korrumpierten Kritiker später das Buch theoretisch sogar können, bevor sie ihre wohlwollenden Stellungnahmen verfassen.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!





























