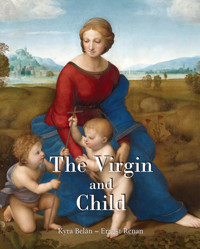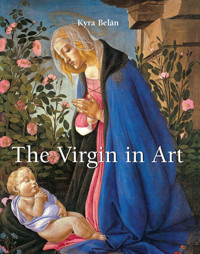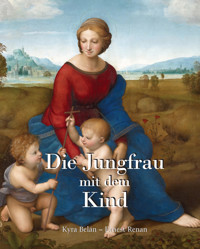
18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Parkstone International
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Christus und die Jungfrau gehören seit dem Mittelalter zu den Lieblingsthemen der Künstler. Maria wurde oft mit dem Jesusknaben in einer religiösen Szene, die eine Mutter und ihrem Sohn, manchmal von anderen Protagonisten begleitet,darstellt. Ursprünglich distanziert und formal, wird die Beziehung zwischen ihnen seit dem Ende des Mittelalters mit Zärtlichkeit und auch menschlicher ausgedrückt. Wir finden jedoch viele Darstellungen, auf denen nur der erwachsene Jesus repräsentiert ist. Cimabue, Jean Fouquet, Quentin Metsys, Botticelli, Da Vinci, Raphael, Rubens und viele andere gehören zu den berühmten Künstlern, die sich mit diesen Themen auseinandergesetzt haben. Dieses Buch besteht aus 300 Bildern mit detaillierten Bildunterschriften und einem vertieften Text.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 417
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Kyra Belán – Ernest Renan
Die Jungfrau
Autoren:
Kyra Belán
Ernest Renan
Layout:
Baseline Co. Ltd
Ho-Chi-Minh-Stadt, Vietnam
© Confidential Concepts, worldwide, USA
© Parkstone Press International, New York, USA
© Image Barwww.image-bar.com
Weltweit alle Rechte vorbehalten.
Soweit nicht anders vermerkt, gehört das Copyright der Arbeiten den jeweiligen Fotografen, den betreffenden Künstlern selbst oder ihren Rechtsnachfolgern. Trotz intensiver Nachforschungen war es aber nicht in jedem Fall möglich, die Eigentumsrechte festzustellen. Gegebenenfalls bitten wir um Benachrichtigung.
ISBN: 978-1-68325-647-2
Die Jungfrau von Vladimir, erstes Drittel des 12. Jahrhunderts. Tempera auf Holz, 104 x 69 cm. Staatliche Tretjakow-Galerie, Moskau.
Inhaltsverzeichnis
Die Jungfrau in der Kunst
Einführung
Vom frühen bis zum späten Mittelalter
Die Renaissance
Das Barock
Das 18. und 19. Jahrhundert
Das 20. Jahrhundert
Schlussworte
Christus in der Kunst
Die Ursprünge der Geschichte Jesu Christi
Kindheit und Jugend Jesu
Jesus als Lehrer
Jesus als Messias
Die letzten Tage und der Tod Jesu
Werk und Vermächtnis Jesu
Bibliografie
Abbildungsverzeichnis
Anmerkungen
Die Jungfrau in der Kunst
Maria als Sophia auf dem Löwenthron, um 1150. Buchmalerei. Bodleian Library, Oxford, England.
Einführung
Das Bild der Madonna ist seit fast 2000 Jahren in der Kunst der westlichen Welt fest verankert. In all diesen von europäischem Geist geprägten Kulturen verkörpert die Madonna in reinster Form bedingungslose Liebe und wird als mitfühlende und versöhnende Nährmutter aller Christen verstanden. Sie wird aber auch als die liebende Mutter und als Beschützerin der gesamten Menschheit gesehen. Die Marienverehrung beruht auf dem Glauben, dass nur Maria allein Schmerz, Leidenschaften und Glück der Menschen wirklich verstehen kann; sie verzeiht, vermittelt, tröstet und ist das Bindeglied zwischen den Menschen und ihrem Gott. Sie wurde als Königin des Himmels, Mutter aller Menschen und als die Verkörperung des Mitleidens verehrt, darüber hinaus verkörpert sie Selbstlosigkeit, Demut und Fürsorge und steht für die weibliche Spiritualität in der Christenheit. Sie wird auch als „Jungfrau Maria“, „Unsere Liebe Frau“, „Himmelskönigin“ und „Gesegnete Mutter Gottes“ verehrt.
Durch viele Jahrhunderte hindurch hat die Madonna Tausende von Künstlern inspiriert, die unzählige Stunden an ihrer Darstellung gearbeitet haben und dabei verschiedene Stile, Materialien und Techniken verwendeten. Dieser riesige Fundus von Kunstwerken stellt ein wichtiges kulturelles Erbe dar und repräsentiert eine noch heute die Welt beherrschende gesellschaftliche Macht. Madonnenbilder füllen Kunstmuseen, Galerien, Paläste und private Sammlungen. Die im Lauf der Jahrhunderte entstandenen Bilder der Jungfrau Maria sind Ausdruck der wechselnden Auslegungen von Glaubensinhalten, Mythen, Ikonografie und Symbolik der Marienverehrung in der Gegenwart liefern die immer wieder auftauchenden Meldungen über Marienerscheinungen auf der ganzen Erde und ihre auffällige Präsenz im Internet.
Lehrer und Schüler, Orant und Kind, 3. Jahrhundert. Wandmalerei in einer Lünette. Katakomben von Priscilla, Rom.
Marienbilder sind vielen Menschen auf diesem Planeten vertraut. Die Rolle der Frau in der Gesellschaft, die sich im Lauf der Jahrhunderte ständig veränderte, an Bedeutung verlor oder zunahm, hatte direkten Einfluss auf die Rolle der Madonna, die ebenfalls auf immer neue Weise verstanden und interpretiert wurde. Der Streit um Marias göttliche Natur, die zum Dogma erhoben wurde, um ihre traditionellen oder geheimen Symbole und deren Ursprünge dauert unter Theologen, Philosophen und Soziologen auch im neuen Jahrtausend an. Wenn auch moderne Künstler nicht länger verpflichtet sind, religiöse Bilder zu schaffen, werden viele, besonders Frauen, häufig von Marias traditioneller oder im heutigen Sinn offener verstandenen Rolle inspiriert. Bei der Schaffung ihrer Werke entscheiden sie sich oft für neue künstlerische Ausdrucksformen.
Die Geschichte der Theologie im Lauf der Jahrhunderte zeigt die ständigen Wandlungen der Präsenz Marias. Wissenschaftler stimmen darin überein, dass es im Frühchristentum auch andere herausragende Gestalten weiblicher Spiritualität gab, wie die Hl. Sophia, die als der weibliche Aspekt des komplexen christlichen Gottes verstanden wurde. Hagia Sophia stellte die göttliche Weisheit dar und wurde als kongenialer Schöpfergott, zusammen mit dem Vater, dem Sohn und Heiligen Geist verehrt. Im frühen Christentum wurde besonders in Osteuropa der Heilige Geist als weiblich verstanden. Dem entsprach häufig die Verehrung des weiblichen Aspekts des Göttlichen in der Gestalt der Sophia.[1] In dem Maße, wie die Popularität der Jungfrau Sophias innerhalb des Klerus und der von ihm nach und nach verankerten Dogmen verblasste, nahm die Popularität der Jungfrau Maria, der Mutter Gottes, stetig zu. Eines der frühen, noch vorhandenen Bilder von Maria wurde im 2. oder 3. Jahrhundert gemalt und befindet sich in der Krypta der Verschleierten Madonna in den Katakomben von Priscilla in Rom. Dieses Bild stellt sie zusammen mit einer in der Mitte des Bildes stehenden, weiblichen Figur dar, vielleicht ein frühes Bild von Sophia. Eine Figur, möglicherweise Jesus mit Jüngern, ist rechts von der betenden Figur im Mittelpunkt angeordnet. Die Jungfrau Maria, mit dem Kind auf dem Arm, befindet sich links von der stehenden Figur.
Im 6. Jahrhundert stabilisierte sich die Bedeutung der Mutter Gottes in der religiösen Dogmatik in ganz Europa, einschließlich des Byzantinischen Reichs. Diese Bestätigung dämmte die Bedrohung durch eine konkurrierende Religion ein, die der großen Göttin Isis in Ägypten. In den ersten Jahrhunderten nach Christus wurde das Bild Marias oft mit dem Bild dieser ägyptischen Göttin, deren Kult bereits mehrere tausend Jahre bestanden hatte, gleichgestellt und sogar mit ihm verwechselt. Wie die Madonna hatte auch Isis einen göttlichen Sohn, Horus, und die Künstler bildeten sie oft ab, das Kind zärtlich auf dem Schoß haltend und ihm die Brust reichend. Eines ihrer wichtigsten Merkmale war die Darstellung als stillende Mutter – sie war wie Maria eine mitfühlende und liebende Gottheit, von der Sorge für die Anliegen der Menschen erfüllt.[2]
Isis, Muttergöttin der Welt, ihren Sohn Horus stillend, 200-100 v. Chr. Kupferlegierung und Bronze, Höhe: 27 cm. The Fitzwilliam Museum, University of Cambridge, Cambridge.
Jungfrau und Kind, 9. Jahrhundert. Mosaik. Hagia Sophia, Istanbul.
Die Mythen von Maria und von Isis weisen viele Analogien auf. Beide haben ihren Sohn auf ungewöhnliche Weise empfangen und der Glaube an ihre unermessliche Liebe und ihr offenes Ohr für die Nöte und Gebete ihrer Anhänger vereint sie. Beide werden als Beschützerinnen von Frauen in Elend und Kummer gesehen und beide haben zahlreiche Wunder bewirkt. Viele der Maria geweihten Heiligen Stätten wurden dort errichtet, wo in früheren Zeiten die der Isis gewidmeten Tempel gestanden hatten. Die meisten Menschen sahen keine großen Unterschiede zwischen den beiden weiblichen Gottheiten. Frühe christliche Marienverehrer verstanden ihre Madonna als eine neue Verkörperung der alten Gottheit Isis.
Die Religion der Gottheit Isis bestand mindestens viertausend Jahre lang. Neue Erkenntnisse legen jedoch die Annahme nahe, dass diese Gottheit über einen Zeitraum von mehr als sechs Jahrtausenden verehrt wurde. Obwohl ursprünglich nur eine ägyptische Gottheit, wurde Isis im größten Teil der antiken Welt, die sogar einen bedeutenden Teil Europas mit einschloss, verehrt. Sie war die Tochter einer älteren ägyptischen Gottheit, der Himmelsgöttin Nut und wurde auch als eine jüngere Version der beiden ägyptischen Gottheiten verstanden, die ihr vorausgingen: Hathor und Sekhmet. Wie die Große Sekhmet war Isis eine Sonnengöttin, und wie Hathor besaß sie die Kraft des Mondes. Zur Darstellung ihrer mannigfaltigen Aspekte benutzten die Künstler eine Vielzahl von Symbolen, zu denen auch Pflanzen und Tiere gehörten. Zahlreiche frühe Symbole der Isis wurden später in die Ikonografie der Jungfrau Maria aufgenommen. Um das Jahr 431 erklärte das Konzil von Ephesos die Jungfrau im Byzantinischen Reich zur Theotókos oder Gottesgebärerin. Dieses Ereignis inspirierte eine immer größere Zahl von Künstlern, Marienbilder zu schaffen. Viele dieser Darstellungen wurden jedoch später im 7. und 8. Jahrhundert aufgrund des theologischen Streits innerhalb der Christenheit zerstört, nur einige wenige blieben auf wunderbare Weise verschont. Der Klerus der Ostkirche erkannte seine Kaiser als Kirchenführer an, und im Jahr 726 rief Leo III., ein byzantinischer Kaiser, eine Bewegung, die als Bildersturm (Ikonoklasmus) bezeichnet wird, ins Leben. Die Anhänger dieser Bewegung fürchteten, dass die Bevölkerung lediglich die Ikonen verehre anstelle der in ihnen enthaltenen religiösen Ideen.
Und im 8. Jahrhundert konnte die Bewegung der Bilderstürmer im Byzantinischen Reich dann alle Heiligenbilder verbannen, weil sie der festen Überzeugung waren, die Gläubigen würden die Bilder selbst zu Götzen erheben anstatt den ihnen zugrunde liegenden spirituellen Werten zu huldigen. Diese Entscheidung wurde im folgenden Jahrhundert jedoch zurückgenommen und man begann mit neuer Inbrunst, der Jungfrau Maria gewidmete Ikonen zu schaffen.[3] Neben der Gottheit Isis wurden in der frühen Christenheit Statuen oder Ikonen anderer heidnischer Göttinnen oft zu Bildern Marias umgedeutet. Eine von ihnen war die griechische Göttin Demeter die ebenfalls ein Kind hatte, Persephone oder Core, die wiederauferstehende Frühlingsgöttin. Ein andere solche Göttin war Artemis/Diana aus der griechisch-römischen Welt. Kybele, ursprünglich aus dem Nahen Osten stammend, wurde auch oft als eine frühe Version Marias angesehen.
Der Kult jeder dieser Göttinnen blickt auf eine lange Geschichte zurück. Ihnen zu Ehren wurden komplexe Rituale zelebriert und zahlreiche Tempel errichtet. Vielleicht der interessanteste unter ihnen war der Göttin Artemis geweiht und befand sich in Ephesos. Selbst heute noch werden seine Ruinen besonders verehrt, Beweis für die große Liebe und den Respekt, die der Göttin von ihren Anhängern während der letzten tausend Jahre entgegengebracht wurde. Die außergewöhnliche Statue, die sie als Große Mutter darstellt, bedeckt von Früchten und Tieren, ihren Attributen, bezeugt ihre Rolle als Nährmutter der Menschheit in ganz Europa und dem Nahen Osten während der Antike. Die als Schöpfergöttin verehrte Kybele, von Anatolien aus in das Römische Reich eingeführt, wurde in einem Tempel verehrt, der sich an dem Ort befand, an dem heute der Petersdom steht. In jener Zeit wiesen die frisch etablierten patriarchalischen Gesellschaften noch deutlich erkennbare, in ihrer Struktur noch fest verwurzelte matriarchalische Komponenten auf.
Demeter, Korngarben und Mohnkapseln haltend zwischen Schlangen, 3. bis 2. Jahrhundert v. Chr. Terrakotta. Museo Nazionale delle Terme, Rom.
Kybele mit einer Taube und Patera, 3. bis 2. Jahrhundert v. Chr. Museo Archeologico Nazionale, Reggio Calabria, Italien.
Frauen besaßen daher noch beachtliche Rechte und Machtbefugnisse, und so wurden auch in den Religionen weibliche spirituelle Kräfte verehrt. In diesen Gesellschaften wurden Gottheiten beiderlei Geschlechts mit gleicher Inbrunst und Ehrfurcht angebetet. Eine Reihe dieser Göttinnen und Götter aus den Religionen der Antike wurden später populäre christliche Heilige, denen viele Kirchen geweiht wurden.
Gräbt man noch tiefer, erscheint hinter den von Künstlern der heidnischen Welt zur Verehrung ihres Muttergottes geschaffenen Bildern und Tempeln eine andere, noch ältere Schicht von Kunstwerken der Menschen aus vorgeschichtlicher Zeit. Erhalten gebliebene frühe Bilder der Großen Göttin des europäischen Neo- und Paläolithikums sind in Stein gehauen. Marija Gimbutas, Archäologin und Verfasserin mehrbändiger Werke zur Geschichte der prähistorischen matriarchalischen Kulturen in Europa, beschreibt detailliert die Gesellschaften, die Bilder der Muttergöttin hervorbrachten. Die prähistorischen Gesellschaftssysteme waren matriarchalisch. Die Bilder des Schöpfergotts waren weiblich und bringen den Glauben der Menschen an eine Gesellschaftsordnung zum Ausdruck, die von den Frauen dieser Kulturen organisiert und getragen wurde. Bei Grabungen wurde eine Fülle von Bildern, die diese uralten, religiösen Glaubenssysteme verkörpern, entdeckt und können in bedeutenden Museen überall auf der Welt betrachtet werden.
Als frühestes dieser Bilder gilt Die Venus(Göttin) von Willendorf, datiert um etwa 35.000 v. Chr. Diese prähistorischen Bilder der Göttin sind die entferntesten Vorläuferinnen Marias. Unter der strengen patriarchalischen Ordnung der letzten beiden Jahrtausende sind die Frauen im Vergleich zu den Männern das unterworfene und untergeordnete Geschlecht. Daher war es im christlichen Dogma nicht möglich, den Glauben an eine weibliche Göttin aufrechtzuerhalten. Dennoch behielt die Madonna ihren geheimen göttlichen Status, häufig ablesbar an den symbolischen Botschaften, die Künstler in ihr Bild hineinlegten. Mit der Verbreitung der westlichen Kultur in den letzten fünf Jahrhunderten wurden viele neue, der Maria geweihte Tempel an früheren Kultstätten der Muttergottheiten autochthoner Kulturen errichtet.
Nach der Eroberung Amerikas lieferten Marienbilder aus Ländern wie Mexiko und Peru einen bedeutenden künstlerischen Beitrag. Wie ihr europäisches Gegenstück stellten diese Bilder die Heilige Jungfrau als Schwarze Madonna dar, die man für besonders mächtig und wundertätig hielt. Auf dem neuen Kontinent trat die Jungfrau Maria häufig an die Stelle der früheren regionalen Muttergöttin und wurde die Schutzpatronin einer bestimmten Region oder eines ganzen Landes.
Zusätzliche Symbole, die ursprünglich die alteingesessenen Götter verkörperten, wurden in die marianische Ikonografie aufgenommen. Das hatte zur Folge, dass die späteren Bewohner dieser Länder die Jungfrau Maria als die christliche Gottesmutter und gleichzeitig als den eingeborenen Muttergott früherer, von den Eroberern unterworfener Zivilisationen sahen. Alles deutet darauf hin, dass die Rolle der Madonna sich immer noch weiterentwickelt. Die Überlieferung, die Ursprünge, das Dogma, die Mythen und die ständig wachsende Sammlung von Symbolen und Archetypen sind immer noch mit der rätselhaften Gestalt der Jungfrau Maria verbunden. Als weiblicher Prototyp von Spiritualität und Vollkommenheit wird die Madonna überdauern.
Dieses Buch hält für den Leser die bedeutendsten Kunstwerke bereit, die im Lauf der Jahrhunderte zu Ehren Marias geschaffen wurden. Diese Kunstwerke wurden von vielen verschiedenen Individuen geschaffen, die von unterschiedlichen Standpunkten aus und in der ihnen jeweils zur Verfügung stehenden Bildsprache versuchten, die Gefühle und Überzeugungen ihrer Kulturen hinsichtlich der Großen Mutter zu vermitteln und zu erklären.
Artemis von Ephesos, 150-199 n. Chr. Alabaster, Höhe: 130 cm. Museo Archeologico Nazionale di Napoli, Neapel.
Die Venus (Göttin) von Willendorf, um 35.000 bis 25.000 v. Chr. Naturhistorisches Museum, Wien.
Simone Martini, Madonna (Die Verkündigung), 1340-1344. Tempera auf Holz, 30,5 x 21,5 cm. Eremitage, Sankt Petersburg.
Vom frühen bis zum späten Mittelalter
Die ersten Marienbilder fanden vermutlich während des 2. und 3. Jahrhunderts Eingang in die frühchristliche Ikonografie. In dieser Epoche der Menschheitsgeschichte verloren die Frauen zunehmend die ihnen noch verbliebenen gesellschaftlichen Rechte und Machtansprüche; Überreste des alten Matriarchats fielen der herrschenden patriarchalischen Ordnung zum Opfer. Die offiziell anerkannten Evangelien des neuen Testaments wurden von Männern für ein patriarchalisches Gesellschaftssystem verfasst, und diese Texte enthielten nur sehr spärliche Hinweise auf die Madonna. Weder Maria noch ihr Sohn Jesus hinterließen schriftliche Zeugnisse und die unveröffentlichte Fassung des ersten offiziellen Evangeliums, vermutlich von Markus geschrieben, wurde im Jahr 66 n. Chr. vervollständigt. Die zweite offizielle Fassung des Evangeliums wurde offenbar von Lukas im Jahr 80 n. Chr. niedergeschrieben, ihr folgte wenig später die Fassung von Matthäus. Es ist jedoch auch durchaus möglich, dass die Fassung von Johannes, die etwa aus dem Jahr 37 n. Chr. stammt, tatsächlich die erste war, da sie mehr Einzelheiten enthält; was wiederum den Schluss zulässt, dass diese Fassung die realen Vorkommnisse im Leben Marias und ihres Sohns aus größerer zeitlicher Nähe wiedergibt.[4] Diese Berichte, und hier vor allem die Geschichte Jesu, erwähnten seine Mutter nur selten und konnten alle jene Menschen, die sich trotz der Trivialisierung der Frauen durch das Patriarchat verzweifelt nach einer weiblichen, göttlichen Gestalt sehnten, um sie zu verehren und anzubeten, nicht befriedigen. Das Verlangen nach einer mächtigen, jedoch verzeihenden Großen Mutter ließ sich nicht zum Schweigen bringen und die Göttinnen der alten Religionen wie Isis, Kybele, Demeter, Aphrodite und Athene wurden weiter verehrt. Der Kult der Isis war vermutlich am weitesten verbreitet und stellte eine starke Bedrohung für die junge christliche Religion dar. Ihr fehlte eine eigene Große Mutter, die in den frühen Deutungen des Heiligen Geistes eine weibliche Gestalt annahm, die der Sophia als Weisheit Gottes.[5] Zu den mächtigen weiblichen Archetypen der herrschenden neuen patriarchalischen Religion trat bald die alle überragende Maria, die Gottesmutter, hinzu. Von Beginn an wurde die Madonna als Symbol für die Mutter Kirche selbst gesehen.
In der Folge wurde der Kult Marias geboren, der sich auf die kärglichen Informationen in den vier offiziell anerkannten Evangelien stützte, sowie auf Rückschlüsse, die man aus der Offenbarung und Informationen aus den apokryphen Schriften gezogen hatte.
Diese offiziell nicht anerkannten und später entstandenen Schriften, Nachahmungen der früheren Evangelien, enthielten mehr Information über das Leben Marias, ein Umstand, der auf das wachsende Bedürfnis der christlichen Anbeter hinweist, sie zu feiern und zu verehren. Durch die Zusammenführung aller aus diesen Quellen gewonnenen Erkenntnisse und die zusätzliche Ausschmückung mit volkstümlicher, oft aus den Mythen der früheren Göttinnen übernommener Mythologie, entstand schließlich der Marienkult in seinem Formenreichtum. Das wichtigste patriarchalische Argument der Jungfräulichkeit Marias und der jungfräulichen Geburt findet jedoch nur kurz in zwei der anerkannten Evangelien Erwähnung – im Matthäus- und im Lukasevangelium. Es ist möglich, dass das Wort „Jungfrau“ oder Almah, das in diesen Texten verwendet wird, nicht eine virgo intacta bezeichnete, sondern einfach ein Ausdruck für eine junge Frau war, was als Argument gegen den Beweis der jungfräulichen Geburt in den folgenden Jahrhunderten gelten kann.[6]
Die Präsenz Marias war für die allgemeine Akzeptanz des Christentums in Europa in Ost und West entscheidend; ihre Anwesenheit schuf eine Brücke zwischen den Anhängern der Religionen, die eine matriarchalische Göttin verehrten und dem neuen patriarchalischen Kult. Schrittweise entwickelte der Klerus eine komplexe marianische Lehre, um den Bedürfnissen und Wünschen der Gläubigen, diese Gottheit anzubeten und zu verehren, gerecht zu werden. In vielen Fällen blieben die offiziell verkündeten Dogmen hinter dem Volksglauben und den künstlerischen Darstellungen Marias um mehrere Jahrhunderte zurück. Die Künstler hatten jedoch immer ein offenes Ohr für die Anliegen der Menschen und entwickelten eine Sammlung von Symbolen, Archetypen und Themen, mit deren Hilfe sie die Ereignisse im Leben der Heiligen und die mit der Lehre von Maria verbundenen Vorstellungen kunstvoll interpretierten.
Georg von Antiochia zu Füßen der Jungfrau. Mosaik. Martorana, Palermo, Sizilien.
Zum christlichen Dogma der Frühzeit gehörte jedoch noch eine weitere mächtige weibliche Figur, die geheimnisvolle Sophia oder das Wort Gottes, als weibliches Element in der Schöpfung. Ihr wurden viele frühe Bilder gewidmet und Maria, die Mutter Gottes, wurde oft als Maria-Sophia dargestellt. Hinzu kam, dass die Parallelen zwischen den Bildern Marias und denen der anderen Göttinnen zur Akzeptanz des Christentums durch einen großen Teil der mittelalterlichen Bevölkerung beitrugen, der bis dahin Isis und andere weibliche Götter verehrt hatte. Diese Entwicklung einte und festigte das Christentum als herrschende Religion sowohl im östlichen wie im westlichen Europa. Die marianischen Künstler übernahmen sogleich zahlreiche Symbole der Göttinnen zu ikonografischen Zwecken und trugen so dazu bei, die Zweifel der Gläubigen zu zerstreuen, die sich fragten, ob ihre Universale Mutter etwa weniger bedeutend sei als die weiblichen Gottheiten früherer Religionen.[7]
In der Zwischenzeit wurden als Antwort auf die Forderungen der christlichen Bevölkerung nach einem weiblich-göttlichen Prinzip Ikonografie, Kult und Dogma Marias ständig erweitert und verfeinert. Den Kirchenvätern war jedoch deutlich bewusst, dass ihre asketische Religion, die Sexualität als eine Form des Bösen und Frauen mehr noch als Männer als sexuelle physische Wesen betrachtete, die Jungfräulichkeit Marias stärken und erneut bestätigen musste, um sie von den übrigen Frauen zu isolieren, die, einer verbreiteten Auffassung zufolge, als böse galten und noch weit unter den Männern rangierten. Da nur ein vollkommenes Wesen einen göttlichen Sohn hervorbringen konnte, wurde nicht nur die ewige Jungfräulichkeit der Madonna, sondern auch ihre eigene unbefleckte Empfängnis oder Geburt, frei von Erbsünde, von den gleichen Kirchenvätern diskutiert und zum Dogma erhoben, die auch verhinderten, dass Frauen zum Priestertum zugelassen wurden.[8]
Der Mythos der jungfräulichen Geburt ist nicht allein im Christentum zu finden. In vielen alten und heidnischen Religionen bringt eine Göttin ohne Hilfe eines Gottes eine Tochter oder einen Sohn hervor, ein als Parthenogenese bekanntes Phänomen. Während im prähistorischen Europa und in seinem Umkreis der Schöpfer in weiblicher Form verehrt wurde, vervielfältigte sich in späterer prähistorischer Zeit die Große Muttergöttin, indem sie die erste männliche Gottheit hervorbringt, ihren Sohn.
Die Schwarze Jungfrau von Rocamadour, um 1000 n. Chr. Walnußholz. Notre-Dame de Rocamadour, Rocamadour.
Später, bei den alten Griechen und Römern, erheben viele Helden und andere bedeutende männliche Gestalten der Geschichte Anspruch darauf, von einer Frau durch die Macht des Heiligen Geistes geboren worden zu sein. Mehrere Versionen des frühen christlichen Geburtswunders gehen auf die ersten Theologen zurück. Da das Geschlecht des Heiligen Geistes noch unklar war, wurde er in Osteuropa als Muttergöttin gesehen, die von Marias Körper Besitz ergreift bis zu dem Tag, an dem das Kind geboren wurde. Die Taube – das Symbol des Heiligen Geistes – war bei den Griechen und Römern heilig als Symbol der Aphrodite, der Göttin der Liebe. Der Genuswechsel von „sie“ zu „er“ in der lateinischen Sprache verwandelte den Heiligen Geist in einen männlichen spiritus sanctus und in Westeuropa erschienen erste Bilder des Verkündigungsthemas mit männlicher Ikonografie, die bald zur korrekten Auslegung des Dogmas erhoben wurde.
Obwohl das Wunder der Jungfrauengeburt eine lange vorchristliche Tradition hat, die Tausende von Jahren früherer Religionen umfasst, bedurfte es zur Erklärung der Menschwerdung des christlichen Gottessohnes noch weiterer Rechtfertigungen. Maria wurde zur ewigen Jungfrau erklärt, sogar in der Schwangerschaft und während der Geburt. Dieses Wunder war noch schwieriger zu erklären als das der Jungfrauengeburt. Die Katechetentreffen während der Konzilien von Trient von 1545 und 1563 hielten an diesem Glauben fest. Jahrhunderte später „enthielt sich das Zweite Vatikanische Konzil von 1964 jedoch einer Verkündigung als Glaubenssatz“.
Maria erschien im Christentum als matriarchalische Gottheit, als Mutter, die ein Kind ohne männliche Hilfe gebar. Ihre Jungfräulichkeit wurde jedoch von der patriarchalischen Kirche dazu benutzt, Frauen zu verachten und zu erniedrigen. Die nicht-jungfräuliche Gebärmutter der Frau, die Kinder hervorbringt, galt im Vergleich zu der „spirituelleren“ Rolle des Vaters bei der Reproduktion als etwas Verächtliches. Die Jungfrau des Christentums wurde als keusch verstanden, während die Parthenogenese und Jungfräulichkeit der vorchristlichen Göttinnen nicht den Verzicht auf einen männlichen Begleiter, sei er menschlich oder göttlich, implizierte. Marias jungfräulicher Status erlangte schließlich größte Bedeutung für die Kirchenführer. Er beinhaltet nicht nur die Abneigung der Kirche gegenüber der Sexualität, besonders bei Frauen, sondern eine neue Hoffnung auf die Erlösung von der Erbsünde, Erlösung von den Sünden der sexuellen Eva, die die gesamte Menschheit in ihre sündige und niedrige Existenz stürzte.
Die Jungfrau wurde in der Tat als zweite Eva angesehen, als vollkommene Erlöserin, dazu bestimmt, die Schlange der Verderbnis zu töten und die Menschheit von Evas sündiger Unbotmäßigkeit und ihrem Ungehorsam gegenüber dem patriarchalischen Gott zu erlösen. Dem Dogma zufolge war Maria ein Muster an Tugend und Gehorsam Gott gegenüber und sollte Frauen und Männer durch ihr Beispiel anspornen, ebenfalls die Jungfräulichkeit zu bewahren.
Christus, durch die Jungfrau Mensch geworden, wurde ebenfalls als jungfräulich gesehen. Beide, Maria und Jesus, waren daher zur Rettung der Menschheit vor der Verderbnis des Fleisches, der Sexualität und sogar vor dem Tod ausersehen. Die Unbefleckte Empfängnis der Jungfrau war ein anderes frühchristliches Merkmal der Reinheit und Vollkommenheit der Madonna (obwohl sie erst 1854 offiziell als Dogma verkündet wurde). Man glaubte, sie sei ohne den Makel der Erbsünde geboren, da die Menschen in ihr die Verkörperung des Heiligen Geistes und Sophias sahen. Als Mutter der Kirche hatte sie einen höheren Rang als die weltlichen Herrscher. Der Klerus erhob Maria in den Status der Königin des Himmels, der Weltherrscherin, um so den Machtanspruch der Kirche[9] selbst zu betonen.
Die Anbetung Marias brachte spezifische Themen in der bildenden Kunst hervor. Verschiedene Mythen, die bedeutsame marianische Ereignisse verherrlichten, erhielten eine klare künstlerische Form. Diese Themen behandelten Episoden aus ihrem Leben: ihre Kindheit, ihre Verlobung mit Joseph, die Verkündigung der Empfängnis ihres Sohnes Jesus durch den Erzengel Gabriel, den Besuch Marias bei Elisabeth, die Geburt Jesu oder die Weihnacht, die Flucht nach Ägypten, Marias Beweinung des toten Christus, ihren Tod, ihren Aufstieg ins Himmelreich, ihre Krönung zur Königin des Himmels und zahlreiche Erscheinungen vor Heiligen und dem Volk. Andere Bilderthemen sind: Beschützerin des Volkes, Spenderin von Fülle und Fruchtbarkeit, Maria als Sophia, Maria als Neue Eva, Maria als Himmelskönigin und Maria als Retterin und Wundertäterin, besonders in der Rolle der Schwarzen Madonna.
Diese Themen haben ihren Ursprung im Mittelalter und wurden durch viele Jahrhunderte hindurch in der Kunst in einer sorgfältig ausgearbeiteten Formensprache behandelt.
Die Schwarze Madonna
Der Kult der Schwarzen Madonna, einer wundertätigen und mitfühlenden Fürsprecherin ihres Volkes, war während der ersten Jahrhunderte des Christentums weit verbreitet und erreichte im 11., 12. und 13. Jahrhundert in Europa, besonders aber in Frankreich und Spanien, seinen Höhepunkt. Viele Originale der Ikonen wurden von ihren Standorten entwendet und durch Repliken ersetzt, die genauso verehrt wurden. Darstellungen einer schwarzen oder dunkelhäutigen Maria, häufig waren es Statuen, können auf die Verehrung der Muttergöttin zurückgeführt werden, von der sie viele ihrer Attribute und Kräfte übernommen haben. Zu den verschiedenen Erscheinungsformen dieser Göttin gehörten auch Kybele, Artemis/Diana und natürlich Isis. Alle diese Gottheiten wurden an Heiligen Stätten auf Altären verehrt und manchmal als dunkelhäutig dargestellt. Den Bildern selbst und den Orten, an denen die Tempel standen, wurden geheime, wundertätige Kräfte zugeschrieben. Eine der ältesten Statuen der Schwarzen Madonna ist Unsere Liebe Frau von Guadalupe und befindet sich in ihrem Schrein in Spanien. Berichten zufolge waren die Statue und die Weihestätte seit dem 7. Jahrhundert Gegenstand eines bedeutenden Marienkults. Dann wurde die Statue vergraben, um sie vor einer ausländischen Invasion zu schützen und erst im 12. Jahrhundert wiederentdeckt, woraufhin dort wieder ein bedeutender Wallfahrtsort entstand.[10] Die christliche Lehre jener Zeit verlieh Maria als weiblicher Gestalt den höchsten Rang innerhalb der Heilslehre. Aber die mittelalterliche Bevölkerung hatte eine andere Auffassung und glaubte schon von jeher, dass die Jungfrau göttlich sei. Der gesunde Menschenverstand sagte den Menschen, dass die Mutter eines Gottes selbst eine Göttin sein muss. Die Statue der Jungfrau von Guadalupe ist mit reich bestickten Gewändern bedeckt und zieht immer Mengen von Gläubigen an, die von ihr weitere bedeutende Wunder erwarten. Während des 16. Jahrhunderts wurde in Mexiko eine neue Version von Unsere Frau von Guadalupe gekürt und bis heute pilgern eine große Zahl von Gläubigen und Touristen zu diesem Ort mit diesem Bild. Unsere Liebe Frau Guadalupe von Mexiko-Stadt ist die offizielle Schutzherrin des mexikanischen Volks.
Eine andere mächtige und beliebte Schwarze Madonna in Spanien ist Unsere Liebe Frau von Montserrat. Die Wallfahrten zu ihrer in Katalonien liegenden Weihestätte sind seit dem frühen 12. Jahrhundert, als die Kunde von Wunderheilungen sich in Europa verbreitete, geschichtlich überliefert. Die Kirche des Jesuitenordens, in der sich das Gnadenbild befindet, ist auch heute noch ein berühmter Wallfahrtsort. Die Statue dieser Schwarzen Madonna zeigt sie auf dem Thron sitzend, ihr Kind auf dem Schoß. Ihr Haupt trägt eine Krone, sie hält den Reichsapfel in ihrer rechten Hand, sie ist die Göttin, die Königin der Welt und ihr Kind Jesus ist der kleine König.
Unsere Liebe Frau von Guadalupe, um das 7. Jahrhundert. Santa María de Guadalupe, Cáceres, Spanien.
Unsere Liebe Frau von Montserrat, frühes 12. Jahrhundert. Holz. Santa Maria de Montserrat, Katalonien, Spanien.
Schwarze Madonna von Breznichan (Böhmen), 1386. Národní Galerie, Prag.
Maria, die Gottesgebärerin (Theotókos)
Eines der frühesten Meisterwerke der Ikonografie Marias ist ein byzantinisches Mosaik, das sich in der berühmten und für Hagia Sophia gebauten und ihr geweihten Kathedrale in Konstantinopel (Istanbul) befindet. Es stellt Maria auf dem Thron sitzend dar, mit dem Jesuskind auf dem Schoß. Zwei Kaiser sind auf jeder Seite von Mutter und Kind abgebildet: Konstantin, der Gründer der Stadt, und Justinian, der die Kathedrale zu Ehren der Sophia, dem Wort Gottes, erbaute. Zu jener Zeit wurde Maria als Sophia, das Wort/der Schöpfer, angesehen, auch sie Mitschöpferin, und ihre majestätische Haltung vermittelt diese Botschaft. Maria war auch Theotókos, die Gottesgebärerin – so lautete ihr offizieller Titel nach der Verkündigung durch die Kirche auf dem Konzil von Ephesos im Jahr 431. Der goldene Hintergrund des Mosaiks symbolisiert den Himmel, ein Brauch, der von den alten heidnischen Religionen übernommen wurde.
Jungfrau mit dem Jesusknaben zwischen Konstantin und Justinian, 10. Jahrhundert. Mosaiklünette. Hagia Sophia, Istanbul.
Die Jungfrau der Großen Panagia (Orant), erstes Drittel des 13. Jahrhunderts. Tempera auf Holz, 193,2 x 120,5 cm. Staatliche Tretjakow-Galerie, Moskau.
Maria-Sophia
In Russland gab es in den ersten Jahrhunderten eine große Fülle von Bildern der Maria-Sophia, sodass die Auffassung, sie verkörpere die weibliche göttliche Komponente im christlichen Glauben, sich bis in die heutige Zeit erhalten hat. Eine Ikone aus dem 12. Jahrhundert, heute in der Tretjakow-Galerie in Moskau, ist eine der sehr zahlreichen Beispiele einer Darstellung Marias als spiritueller Herrscher Russlands. Sie wird stehend, in betender Haltung mit segnender Gebärde dargestellt. Ihr Gesicht ist strahlend und ruhig und ein Heiligenschein umgibt ihr Haupt. Der Strahlenkranz in der Ikonografie Marias geht auf frühere, die Sonnengöttinnen wie Sekhmet, Hatho, Isis oder Juno verehrenden Religionen zurück. Drei andere kreisförmige Figuren bilden ein Dreieck: das Jesuskind, eingeschlossen im Leib seiner Mutter, auch mit geöffneten Armen segnend und zwei ein Kreuz haltende Engel in den Kreisen auf jeder Seite der Großen Mutter.
Ein an die Tradition der byzantinischen Bilder aus dem Osten anknüpfendes Mosaik befindet sich in der Apsis der Kirche Santa Maria Trastevere in Rom. Es stellt Maria auf dem Thron dar, zusammen mit ihrem erwachsenen Sohn Jesus, eine Darstellungsform, die gewöhnlich dem kaiserlichen Paar vorbehalten war. Sie werden als Herrscher der christlichen Welt gezeigt. Goldmosaiken auf der Oberfläche symbolisieren das himmlische Königreich. Man nimmt an, dass dies die erste Kirche in Rom ist, die im 12. Jahrhundert Maria geweiht wurde, ein Beweis für die Bedeutung der marianischen Doktrin während dieses Jahrhunderts in Italien.
Hildegard von Bingen war eine Künstlerin des 12. Jahrhunderts, Verfasserin von mit Miniaturen versehenen Handschriften, Musikerin, Dichterin und christliche Philosophin, die ihre Zeitgenossen überragte. Sie war auch Äbtissin eines Benediktinerklosters und eine Mystikerin, die eine Reihe von Bildern von Maria-Sophia schuf.
Hildegard von Bingen, Sophia-Maria, Braut Christi und Mutter der Kirche, um 1150-1200. Otto Müller Verlag, Salzburg.
Ihr vielleicht ungewöhnlichstes Bild von Maria- Sophia ist das Bild mit dem Titel Cosmiarcha, Mitschöpferin und Mutter der Welt und der Menschheit. Dieses Bild stammt von einer Manuskriptseite ihres Werks Buch der Gotteswerke und basiert auf einer der zahlreichen Visionen der christlichen Mystikerin. Es stellt eine stehende weibliche Figur dar, mit ausgestreckten Armen einen Halbkreis bildend, der unterhalb der Arme durch einen symbolischen Mutterleib vollendet wird, in dem sich eine männliche Figur befindet. Über ihrem Haupt erscheint das Haupt von Jahwe, dem Schöpfer. In dem kreisförmigen Mutterleib befinden sich neben der eher androgynen männlichen Figur symbolische Pflanzen- und Tierfiguren. Maria-Sophia wird als die Mutter der Welt, als Mitschöpferin gesehen. Dieses Bild enthält zahlreiche philosophische und anthropologische Implikationen.
Von der später heilig gesprochenen Hildegard stammt auch das Bild Sophia-Maria, Braut Christi und Mutter der Kirche, das in ihrem Buch Scivias („Wisse die Wege“) enthalten ist. Dieses mit Miniaturen versehene Blatt einer Handschrift enthält zwei Illustrationen, die Maria-Sophia darstellen und beruht auf den Aussagen des Alten und des Neuen Testaments.
Auf der rechten Seite wird Maria-Sophia an der Seite von Christus Pantokrator („Weltherrscher“) gezeigt. Eine seiner Hände ist in segnender Gebärde erhoben. Maria-Sophia trägt eine Krone, sie ist in leuchtendem Gold gemalt und stützt den Thron, auf dem Christus sitzt. Hier stellt Maria die Kirche dar, als Mutter der Kirche. Auf der linken Seite erscheint die in Gold gemalte Madonna mit einer die Inschrift „Ich empfange und spende Leben“ tragenden Fahne. Sie hält drei Figuren, ist von den Stühle und eine Leiter tragenden Engeln umgeben und wird als die mächtige Mutter der Kirche dargestellt, die für Ordnung und Autorität steht.[11]
Hildegard von Bingen, Cosmiarcha, Mitschöpferin und Mutter der Welt und der Menschheit, um 1150-1200. Otto Müller Verlag, Salzburg.
Joachim und Anna liebkosen ihr Kind, um 1315-1320. Mosaik. Chora-Kirche (Kariye Camii), Istanbul.
Maria Platytera, um 1400. Gemälde. Museen Dahlem, Berlin.
Marias Kindheit
Ein Mosaik aus dem 14. Jahrhundert in der Chora-Kirche in Istanbul stellt ein Thema dar, das sich Jahrhunderte lang in Europa und der christlichen Welt großer Beliebtheit erfreute: die Kindheit Marias. Das Bild zeigt die Eltern Marias, Anne (oder Anna) und Joachim, die ihr Kind liebkosen. Diese zärtliche Szene stellt eine liebevolle Familie dar, mit menschlichen und göttlichen Zügen. Im 17. Jahrhundert begannen die Kirchenführer, solche Szenen zu unterbinden, aus der plötzlichen Angst heraus, Maria könne größere Aufmerksamkeit gezollt werden als Jesus.
Josephs Zweifel
Ein weniger bekanntes Thema, das im Mittelalter entwickelt wurde, ist das von Josephs Zweifeln und deren Zerstreuung durch die Verkündung von Marias jungfräulicher Geburt. Die Verfasser und späteren Herausgeber der Schriften, alle vermutlich männlichen Geschlechts, schienen irgendwie von der Jungfräulichkeit Marias besessen und diese Frage, Gegenstand häufiger kirchlicher Diskussionen, blieb ein wichtiger Faktor in der christlichen Lehre – ein Dogma, das Maria als einmalige Erscheinung vom Rest ihres Geschlechts isolierte.
Ihre Einzigartigkeit wurde oft als Argument gegen das weibliche Geschlecht in seiner Gesamtheit verwendet, um damit die Frauen leichter durch das patriarchalische System unterdrücken und diese Unterdrückung begründen zu können.
Das Bild zeigt Maria am Spinnrad, während Joseph durchs Fenster hereinschaut. Die goldene Mandorla, die über ihre Gestalt gelegt ist, zeigt ein Kind in ihrem Leib.
Die Verkündigung
Das Thema der Verkündigung wurde im Mittelalter mit großer Begeisterung behandelt. Das Thema der Voraussage ihrer wundersamen Schwangerschaft, ein bedeutendes Ereignis in Marias Leben, erfuhr infolgedessen eine starke Stilisierung: Simone Martine und Lippo Memmi malten im Jahr 1333 DieVerkündigung für den Altar von Sankt Ansanio im Dom von Siena.
Die Jungfrau sitzt vor einem goldenen Hintergrund, der ihre Spiritualität symbolisiert, der Erzengel Gabriel kniet vor ihr. Eine neben ihr stehende Vase enthält Lilien, Symbol für die Reinheit der Jungfrau und ihre unbefleckte Empfängnis.
Oben befinden sich unter gotischen Bögen mehrere Engel und Propheten, während die Seitenflügel stehende Figuren des Hl. Ansanus und der Hl. Margarete enthalten.
Das Thema der Jungfrau mit Kind war im Mittelalter sowohl in Ost- wie auch in Westeuropa beliebt. Der Stil der östlichen Ikonen, den auch die russischen Künstler pflegten, hat sich im Lauf der Jahrhunderte ein wenig gewandelt und blieb stilisiert und abstrakt.
Die Mutter Gottes „Hodegetria“ von Volyn wurde im 14. Jahrhundert vollendet und befindet sich jetzt im Nationalmuseum von Kiew. Eine melancholische Madonna – sie stellt die mitfühlende und liebende Mutter Russlands dar, die ihr Volk beschützt, aber auch an seinem Leiden Anteil nimmt.
Im 14. Jahrhundert brachte Italien eine große Zahl von Gemälden der Madonna hervor. Das Werk von Lorenzo Veneziano zeigt die Jungfrau mit Kind auf dem Thron, ein traditionelles Thema, das im Zeitalter der Renaissance und des Barock seine Blüte erlebte.
Diese Madonna hat realistischere und weichere Züge und scheint den Betrachter anzuschauen, während sich die Aufmerksamkeit des Kindes auf sie richtet. Zwischen beiden besteht eine innige Verbindung. Beide halten eine Rose, Symbol der weiblichen Göttin und der Spiritualität. Marias prunkvoller Thron ist eine Metapher für die Kirche. Sie ist zugleich die Große Mutter und die Mutter Kirche für ihr Volk.
Der Heiligenschein in Form einer Sonne und die Sterne um ihr Haupt weisen sie ebenfalls als Königin des Himmels aus.
Simone Martini und Lippo Memmi, Die Verkündigung, 1333. Tempera auf Holz, 184 x 210 cm. Galleria degli Uffizi, Florenz.
Die Mutter Gottes „Hodegetria“ von Volyn, erste Hälfte des 14. Jahrhunderts. Nationales Kunstmuseum der Ukraine, Kiew.
Lorenzo Veneziano, Die Jungfrau mit Kind, 1372. Malerei auf Holz, 126 x 56 cm. Musée du Louvre, Paris.
Die Heilige Familie
Szenen der Geburt erlangten in der christlichen Ikonografie erst im späten Mittelalter Bedeutung. Das Gemälde aus dem 14. Jahrhundert von Simone dei Crocifissi, heute in den Uffizien, Florenz, zeigt die Familie, bestehend aus Maria, Joseph und Jesus als Gruppe, es wurde von einem wohlhabenden Kaufmann in Auftrag gegeben. Die Familie, und es gibt dort noch eine andere menschliche Figur, wird von Tieren und Engeln umgeben. Alle Mitglieder tragen prächtige Heiligenscheine, die auf ihre übermenschliche Natur hinweisen. Das Thema wird in einem weicheren, realistischeren Stil als in früheren Jahrhunderten behandelt.
Simone dei Crocifissi, Die Geburt Christi, um 1380. Tempera auf Holz, 25 x 47 cm. Galleria degli Uffizi, Florenz.
Die Jungfrau der Apokalypse
Im Jahr 1391 vollendete Giovanni del Biondo Die Jungfrau der Apokalypse mit Heiligen und Engeln. Die Madonna mit dem Kind in den Armen steht auf einem Sockel, umgeben von vier männlichen und vier weiblichen Heiligen, zu denen Maria Magdalena gehört. Letztere stellt eine bedeutende mystische, weibliche Gestalt im Christentum dar, die entweder als Aspekt von Maria selbst oder als ihr extremes Gegenteil, die Hure, verstanden wurde. Maria Magdalena hat nach Meinung mancher Wissenschaftler ein von den Kirchenvätern abgelehntes Evangelium verfasst, nach Meinung anderer war sie die Braut oder Ehefrau von Jesus.[12] In der oberen rechten Ecke der Bildtafel befindet sich eine Figur, die Maria bei der Verkündigung darstellt, rot gekleidet mit einem blauen Umhang. Sie kreuzt die Arme, Symbol für die Ergebenheit in ihr Schicksal. Auf der gegenüberliegenden Seite ist der Erzengel der Verkündigung zu sehen, er hält eine weiße Lilie, Allegorie auf die Reinheit Marias. Maria, die zentrale Figur, ist in denselben Farben gehalten wie die kleinere Figur in der Ecke, aber ihr blauer Umhang hat einen Hermelinbesatz, der auf ihren Status als Königin des Himmels hinweist. Das Kind in ihren Armen hat die Hände gefaltet, wie die Maria der Verkündigung, dies spricht für eine enge spirituelle Verbindung zwischen beiden. Diese Madonna hat einen Heiligenschein in Form einer Sonne mit zwölf Sternen und steht auf dem zunehmenden Mond – eine Anspielung auf das Buch der Offenbarung, denn in der Offenbarung des Hl. Johannes wird eine Frau beschrieben als mit der Sonne gekleidet und auf einer Mondsichel stehend, mit einer Krone aus zwölf Sternen. Während des Mittelalters wurde es üblich, diese Frauengestalt mit Maria zu identifizieren. Diese Tradition trug sicher zur Entstehung der Dogmen von der Unbefleckten Empfängnis und von Marias Himmelfahrt bei. Unsere Liebe Frau erscheint auch im Zentrum über dem Haupt der wichtigsten Maria. Sie hat ein Paar Adlerflügel – ein weiterer Bezug zum Text der Offenbarung, wo die mit der Sonne gekleidete Frau von einem Adler gerettet wird, nachdem sie ein männliches Kind geboren hat. Diese Szene ist symbolisch für die Reinigung der Seele der Verstorbenen. Auch hier wieder stellt Maria als die Madonna auf dem Thron eine Metapher für die Kirche dar, ein Thema, das die christlichen Gläubigen in den folgenden Jahrhunderten bewegte.
Giovanni del Biondo, Die Jungfrau der Apokalypse mit Heiligen und Engeln, um 1391. Tempera und Gold auf Holz, 75,4 x 43,4 cm. Musei Vaticani, Vatikanstadt.
Die Madonna als Mutter der Kirche
Duccios Madonna, auf einem prächtigen Thron sitzend, ist nicht weniger schön. Im Gegensatz zur dreidimensional und realistisch wiedergegebenen Madonna und ihrem Kind ist ihre Umgebung stilisiert dargestellt und entspricht nicht den Regeln der Perspektive. Die Hierarchie wird hier durch die Größenskala verdeutlicht, ein im Mittelalter häufig verwendeter Kunstgriff – die wichtigste Person, Maria, ist am Größten dargestellt. Die symmetrische Verteilung der Engel, drei zu jeder Seite der Madonna, kann symbolisch für die Ordnung stehen, die Maria, die Mutter der Kirche, ihren Untertanen auferlegt. Sie bleibt dennoch die liebende Mutter.
Duccio di Buoninsegna, Madonna Rucellai, um 1285. Tempera auf Holz, 450 x 290 cm. Galleria degli Uffizi, Florenz.
Die Madonna als Beschützerin
Die mitfühlende und liebende Natur Marias als Mutter Gottes und der ganzen Christenheit wird vielleicht am deutlichsten von jenen Künstlern zum Ausdruck gebracht, die das Motiv der Madonna der Barmherzigkeit aufgreifen wie die aus dem 13. Jahrhundert stammende Madonna des Simone Martini. Er malte die Jungfrau als mächtige, aber mitfühlende Gestalt, umhüllt von einem weiten Mantel, unter dem viele Menschen Schutz finden. Die Personen gehören meist Königtum, Adel oder Klerus an. Dieses Bild der Madonna verkörpert die Sehnsucht der Menschheit, von der Göttlichen Mutter des Universums beschützt und geliebt zu werden.
Maria als Beschützerin ist das Thema eines Gemäldes in Tempera auf Holz vom Meister der Barmherzigkeit, das den Titel Madonna der Barmherzigkeit trägt.
Das Werk wurde für das Kloster der Augustinerinnen von Santa Maria in Candeli um das Jahr 1373 geschaffen und ist heute in der Galleria dell’Accademia in Florenz zu sehen. Maria ist die beherrschende Figur, abgebildet mit ausgestreckten Armen stehend. Ihr Schutzmantel, der von zwei Engeln gehalten wird, bedeckt eine Gruppe von Nonnen und vier kleinere weibliche Gestalten.
Die Inschrift darunter ADVOCATA UNIVERSITATIS erklärt sie zur universellen Fürsprecherin des Volks. Der obere Bereich des Gemäldes über dem Mantel bildet einen golden leuchtenden Hintergrund, der mit dem Strahlenkranz der Jungfrau verschmilzt.
Die Gestalten von Christus und den Engeln scheinen schwerelos auf der goldenen Himmelsfläche zu schweben. Dieses Bild ist der unmittelbare Ausdruck des volkstümlichen Glaubens an die Macht der Madonna.
Jacobello malte am Ende des 14. Jahrhunderts ein ähnliches Bild der Mutter, ebenfalls Madonna der Barmherzigkeit benannt. Zum oberen Rand des Gemäldes hin können wir die beiden Protagonisten der Verkündigung sehen. Die Gestalt Marias befindet sich auf der rechten Seite, sie kreuzt die Arme in einer Geste der Ergebenheit in ihr Schicksal.
Auf der Linken sehen wir den Erzengel Gabriel eine Lilie haltend, Symbol für die Reinheit der Unbefleckten Empfängnis Marias. In der Mitte ist eine riesige Madonna dargestellt, der Mantel über ihrem Kleid bietet den vielen, zu ihren Füßen stehenden Gläubigen Schutz. Eine Mandorla über ihrer Brust enthält das Jesuskind. Maria ist die mitfühlende und liebende Große Schutzgöttin des Volkes, eine Rolle, die sie von den weiblichen Gottheiten, ihren Vorgängerinnen aus den matriarchalischen Religionen der Vergangenheit, übernommen hat.[13]
Simone Martini, Madonna der Barmherzigkeit, 13. Jahrhundert. Pinacoteca Nazionale, Siena, Italien.
Der Meister der Barmherzigkeit, Madonna der Barmherzigkeit, um 1373. Tempera auf Holz, 63 x 34 cm. Galleria dell’Accademia di Firenze, Florenz.
Jacobello del Fiore, Madonna der Barmherzigkeit, um 1401-1439. Galleria dell’Accademia di Firenze, Florenz.
Jacobello del Fiore, Madonna der Barmherzigkeit (Detail), um 1401-1439. Galleria dell’Accademia di Firenze, Florenz.
Die Madonna als Sonnengöttin
Werke, die die mit der Sonne gekleidete Maria, so wie sie im Buch der Offenbarung beschrieben wird, darstellten, erschienen zuerst im Mittelalter. Die Handschrift mit Miniaturen aus dem schweizerischen Kloster St. Katharinental ist ein solches Beispiel. Hier wird Maria mit dem Hl. Johannes gezeigt, den man für den Verfasser der Offenbarung hielt. Eine große Sonnenscheibe bedeckt ihre Brust. Ihr Haupt ist gekrönt und von einem Heiligenschein aus zwölf Sternen umgeben. Dieses Bild von Maria ist eine kraftvolle Metapher für die Sonnengottheiten der alten Welt.
Im Laufe der Jahrhunderte entstanden zahlreiche Bilder Marias als volkstümliches Idol. Die Ideen und Konzepte der mittelalterlichen Künstler wurden an die Bedürfnisse der Gesellschaft der Folgezeit angepasst. Frauen genossen im Mittelalter mehr Freiheit als in den folgenden Jahrhunderten des Schreckens der Inquisition, die ja in erster Linie darauf ausgerichtet war, Frauen immer stärker zu unterdrücken.[14] Durch den in der Folgezeit zunehmenden Verlust ihrer Rechte verloren auch die mächtigen, heroischen und göttlichen Bilder von Maria an Beliebtheit. Trotzdem aber blieb sie die Fürsprecherin der Frauen, die ihnen in ihrem schwierigen und oft elenden Leben beistand. In den folgenden 200 Jahren schufen europäische Künstler zahllose Bilder und Skulpturen der Madonna, aber die Betonung lag jetzt auf der Verherrlichung ihrer Rolle als Mutter Jesu und sie wurde häufig mit menschlicheren Zügen ausgestattet.
Maria als Weib mit der Sonne bekleidet, frühes 14. Jahrhundert. Buchmalerei. Kloster St. Katharinental, Diessenhofen.
Quentin Massys, Vergine Addolorata (Die trauernde Jungfrau), 1514-1517. Museu Nacional de Machado de Castro, Coimbra.
Die Renaissance
Das Zeitalter der Renaissance umfasst in der Kunstgeschichte der westlichen Kulturen grob gerechnet zwei Jahrhunderte, das 15. und das 16. Jahrhundert. Die von den französischen Historikern Renaissance genannte (wörtlich „wiedergeboren werden“) und sehr bedeutende Bewegung breitete sich über ganz Europa aus und im Zuge der Eroberung anderer Kontinente vielleicht sogar über die ganze Welt. Ursprünglich entstand die Bewegung in Italien, als die antike Welt der römischen und griechischen Kulturen wiederentdeckt wurde, teils dort und teils in anderen Regionen mit arabischen Verbindungen, die sich jedoch am Mittelmeerraum orientierten. Für die bildenden Künste war es eine Periode größerer stilistischer Veränderungen, da die Kirche ihnen jetzt die Freiheit gab, den, wenn auch idealisierten, Realismus und Naturalismus in der Kunst der alten Römer und Griechen als Quelle der Inspiration zu nutzen.[15] Nach einer längeren Periode mutwilliger Zerstörung wurden die alten Kunstwerke der Griechen und Römer restauriert, gesäubert und der Bewunderung zugänglich gemacht. Kunstaufträge umfassten sakrale Themen aus der christlichen sowie der vorchristlichen Ära und oft war es den Künstlern gestattet, Themen aus der christlichen Ära mit solchen aus der vorchristlichen zu neuen Mischformen zu verbinden. Themen, die ursprünglich der marianischen Kunst entstammten, wurden wieder aufgegriffen, weiterentwickelt und durch die Verwendung realistischer Stilmittel neu definiert. Die Bilder der Madonna, die während der Renaissance geschaffen wurden, betonten oft ihre physische Schönheit und Menschlichkeit wie auch die Spiritualität ihrer Person.
Die Frauen im Zeitalter der Renaissance waren größeren Restriktionen ausgesetzt und ihre politischen Rechte wurden immer mehr beschnitten, sie mussten sich also auf die Rolle der Mutter und der Hausfrau beschränken. Mit Hilfe der Inquisition, die Frauen zu Tausenden und vielleicht sogar Millionen hinrichten ließ, übte die Kirche strenge Kontrolle über die Frauen aus. Diejenigen, die überlebten, fristeten ihr Dasein in Angst vor diesem rücksichtslosen und rachsüchtigen Arm der Kirche. In den Künsten spielten Frauen nur als Hilfskräfte der männlichen Personen ihrer Familie eine Rolle, oft waren sie die Assistenten ihrer Ehemänner und wirkten als solche schöpferisch in den Kunstwerkstätten mit. Einige wenige wurden jedoch selbständige Künstlerinnen und erlangten zu Lebzeiten größere Anerkennung. Das Volk ließ sich in seiner Verehrung Marias nicht beirren und trotz der Missbilligung von Seiten der Kirche, die bemüht war, Maria innerhalb der Kirche eine geringere Rolle zuzuweisen, brachte das Volk sie weiter mit den vielen wiederentdeckten Gottheiten der griechisch-römischen Vergangenheit in Verbindung. Die Kunst spiegelte die Sehnsucht nach Bildern der Madonna wider und die Kirchen machten sich zu Komplizen, indem sie viele dieser Bilder in Auftrag gaben. Jede Legende aus dem Leben Marias wurde von den Künstlern ausgeschöpft und neue Varianten der alten Motive sprudelten hervor. Jeder Künstler war an kirchlichen Aufträgen und den Möglichkeiten, die sich ihm durch sie erschlossen, interessiert. Die Priester, die Herrscher, der Adel und die neuen Reichen wie die Kaufleute, alle bemühten sich ihrerseits um die Beachtung der Künstler, indem sie ihnen Aufträge für Portraits, für Bilder der von ihnen bevorzugten Gestalten früherer Mythen und vor allem der Madonna mit dem Jesuskind erteilten. Das mittelalterliche Verständnis Marias als Neuer Eva, der reinen und vollkommenen göttlichen Kreatur, die dem Volk Rettung und ewige Seligkeit im Himmelreich verhieß, erlangte wieder neue Bedeutung und der Marienkult betonte mit Nachdruck ihren Status als Himmelskönigin. Häufige Erscheinungen trugen zur Entstehung weiterer volkstümlicher Legenden der Madonna bei, die als die Wegbereiterin zur himmlischen Seligkeit und große Fürsprecherin der Menschheit verehrt wurde.
Eine Buchillustration von Berthold Furthmeyr mit dem Titel Maria Kirchenmutter und Eva unter dem Baum des Sündenfalls aus dem Jahre 1489 stellt den Volksglauben von Maria als Neuer Eva dar. Es zeigt Maria und Eva auf jeder Seite des Apfelbaums stehend, Archetypus für die Quelle des Überflusses in der Natur. Eine lange Schlange windet sich um den Stamm des Baumes. Die Schlange ist im jüdisch-christlichen Glauben Symbol für das Böse und den Teufel, war aber andererseits auch ein Symbol für die Güte der Muttergöttin. Der Baum und die Schlange sind in vielen alten Religionen Symbole einer Göttin und verkörpern ihre Macht, Überfluss und Leben hervorzubringen. Da Sexualität und Sinnlichkeit in den alten, die Muttergöttin verehrenden Religionen positiv besetzt waren, war auch Nacktheit akzeptiert, im Fall Evas bedeutet Nacktheit jedoch auch den Verlust der göttlichen Gnade des patriarchalischen, männlichen Gottes.
Berthold Furtmeyr, Maria Kirchenmutter und Eva unter dem Baum des Sündenfalls, 1489. Buchillustration, Farbe und Blattgold auf Pergament, 38,3 x 28,7 cm. Bayerische Staatsbibliothek, München.
Piero di Cosimo, Die unbefleckte Empfängnis, um 1505. Öl auf Holz, 206 x 172 cm. Galleria degli Uffizi, Florenz.
Giorgio Vasari, Die unbefleckte Empfängnis, 1543. Öl auf Holz, 58 x 40 cm. Villa Guinigi, Lucca Musei Nazionali, Lucca.
Die unbefleckte Empfängnis
Das Leben der Madonna bot Künstlern viele Gelegenheiten, Marienthemen zu malen oder plastisch darzustellen. Eine der Kontroversen innerhalb der mächtigen, männlichen Priesterschaft betraf die Frage der Unbefleckten Empfängnis der Jungfrau Maria: Die Kirchenväter verkündeten die unbefleckte Geburt Marias frei vom Makel der Erbsünde. Diese Theorie wurde um das 8. Jahrhundert zuerst in der Ostkirche gelehrt, als die Bilderstürmer erklärten, es sei ausgeschlossen, dass eine Person wie Jesus von einer gewöhnlichen Frau geboren worden sei, einer Frau, die durch den Sündenfall befleckt, also Trägerin der Erbsünde sei. Diese Theorie verbreitete sich in den beiden folgenden Jahrhunderten über ganz Europa.[16] Das breite Publikum nahm wie üblich an diesen philosophischen Diskussionen über das Dogma nicht teil, sondern fuhr fort, Maria als seine Beschützerin und als Himmelskönigin zu verehren. Die Künstler drückten aus, was das Volk empfand und malten das Thema der unbefleckten Empfängnis mit Hingabe und Begeisterung.
Ein großes Ölbild, von Piero die Cosimo für die Kirche von Santissima Annunziata zu Beginn des 16. Jahrhunderts ausgeführt, trägt den Titel Die Unbefleckte Empfängnis und stellt die Madonna in der Mitte der Bildkomposition auf einem Podest in ihrer Glorie stehend dar. Durch die geöffneten Wolken fällt das Licht auf sie herab, das Symbol des Heiligen Geistes, eine Taube, schwebt über ihrem Haupt. Seit dem Beginn des Christentums war man, in Übereinstimmung mit dem Volksglauben, von einer sehr engen Verbindung zwischen dem Heiligen Geist und Maria überzeugt. Weiter unten ist auf einem Podest ein Relief der Verkündigung deutlich erkennbar. Marias Blick richtet sich auf die Heilige Taube, während die Heiligen – drei Männer und drei Frauen – in betender Gebärde verharren.
Es wird deutlich, dass hier die Schönheit und Jugend Marias und der weiblichen Heiligen als erstrebenswertes Ideal für die Frauen jener Zeit erscheinen, während die männlichen Heiligen in keiner Weise idealisiert werden und verschiedene und keineswegs schmeichelhafte Stadien des Alters erkennen lassen. Die unterschiedliche Behandlung von weiblichen und männlichen Bildobjekten lässt sich in der Renaissance häufig beobachten. Die Unbefleckte Empfängnis von Giorgio Vasari aus dem Jahr 1543 verwendet eine ungewöhnliche und innovative Ikonografie. Die Gestalt der Jungfrau befindet sich in der oberen Mitte des Gemäldes, von Engeln und Wolken umgeben und von Licht umflossen. Ein zunehmender Mond – Anspielung auf ihre Verbindung mit zahlreichen Mondgöttinnen der heidnischen Kulturen – befindet sich unter ihren Füssen. Sie schaut auf die Erde hinunter, wo ein gefallener Engel mit schlangenförmigem Schwanz sich dem Fegefeuer nähert. Dort bilden mehrere, meist männliche Personen eine dramatisch bewegte Gruppe. Die beiden sich zurücklehnenden Nackten stellten möglicherweise Adam und Eva nach dem Sündenfall dar. Das Gemälde ist als Allegorie auf die Göttlichkeit von Maria zu verstehen.
Leonardo da Vinci, Verkündigung, um 1475-1480. Tempera auf Holz, 98 x 217 cm. Galleria degli Uffizi, Florenz.
Nicolas Dipre, Die Darbringung der Jungfrau im Tempel, um 1498. Öl auf Holz, 33 x 51 cm. Musée du Louvre, Paris.
Die Verkündigung der Geburt Marias
Die Popularität des Kults der Unbefleckten Empfängnis – lange bevor diese als offizielles Dogma anerkannt wurde – veranlasste manchen Künstler, die Hl. Anne (Anna) darzustellen, die legendäre Mutter von Maria, die ebenfalls vom Volk verehrt wurde. Bernardino Luini (1485-1532) malte Die Verkündigung der Hl. Anna, wie sie glücklich den Worten des über ihr schwebenden Engels lauscht.
Marias Kindheit
Das Thema eines Ereignisses aus Marias Kindheit, gemalt von Nicolas Dipre, ist ihr Besuch im Tempel in Jerusalem. Die Darbringung der Jungfrau im Tempel