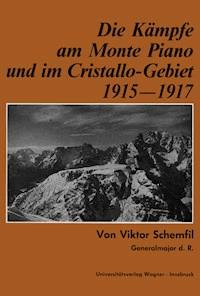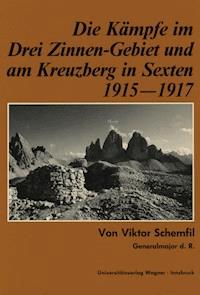
19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Universitätsverlag Wagner
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
GENERALMAJOR VIKTOR SCHEMFIL Der Verfasser, als Regimentsadjutant der Tiroler Kaiserjäger selbst am südlichen Kriegsschauplatz, schildert die Grenzschutzvorbereitungen, die Angriffs- und Verteidigungspläne und die Kampfhandlungen im Drei-Zinnen- und Kreuzberggebiet bis zum Abzug der italienischen Truppen im Herbst 1917. Neben zahlreichen anderen Episoden beleuchtet er insbesondere das tragisch verlaufene Paternkofel-Unternehmen des Sextener Bergführers Sepp Innerkofler, der mit Freunden als "fliegende Patrouille" rastlos Gipfel um Gipfel bestieg und dort ins Blickfeld des Gegners zu gelangen suchte, um ihm den Anschein zu vermitteln, alle diese Berge seien österreichisch besetzt und gesichert (vgl. auch Schlern-Schriften 273).
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 342
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
VIKTOR SCHEMFIL
DIE KÄMPFE IM DREI ZINNEN-GEBIET UNDAM KREUZBERG IN SEXTEN 1915—1917
Viktor Schemfil
Generalmajor d. R.
Die Kämpfe im Drei Zinnen-Gebiet und am Kreuzberg in Sexten 1915—1917
Verfaßt auf Grund österreichischer Kriegsakten, Schilderungen von Mitkämpfern und italienischer kriegsgeschichtlicher Werke
Mit 23 Skizzen und 23 Bildtafeln
Zweite Auflage
Schlern-Schriften 274
Universitätsverlag Wagner • Innsbruck 1986
Die Schlern-Schriften wurden 1923 von Raimund v. Klebeisberg gegründetHerausgegeben von em. Univ.-Prof. Dr. Dr. h. c. Franz HuterFür den Inhalt ist der Verfasser verantwortlich
In erster Auflage ist der Teil „Die Kämpfe im Drei Zinnen-Gebiet“ 1955 als Band 129 der Schlern-Schriften, der Teil „Die Kämpfe am Kreuzberg in Sexten“ 1957 als Band 177 der Schlern-Schriften erschienen. In der zweiten Auflage wurden diese Bände weitgehend unverändert übernommen. Die Bildtafeln im l. Teil „Drei Zinnen-Gebiet“ wurden um die Bilder 10 bis 30 ergänzt. Die Fotos dazu stammen aus dem Dolomitenkriegsarchiv, Dr. Hugo Reider, Tramin.
© 1986 by Universitätsverlag Wagner Ges.m.b.H., Erlerstraße 10, A-6020 lnnsbruck
Homepage: www.uvw.at
E-Mail: [email protected]
CIP-Kurztitelaufnahme der Deutschen Bibliothek
Schemfil, Viktor:
Die Kämpfe im Drei Zinnen-Gebiet und am Kreuzberg in Sexten 1915 – 1917: verf. auf Grund österr. Kriegsakten, Schilderungen von Mitkämpfern u. ital. kriegsgeschichtl. Werken / Viktor Schemfil – 2. Aufl. – Innsbruck: Universitätsverlag Wagner, 1986.
(Schlern-Schriften; 274)
l. Aufl. u. d. T.: Schemfil, Viktor: Die Kämpfe im Drei Zinnen-Gebiet u.
Schemfil, Viktor: Die Kämpfe am Kreuzberg in Sexten
1915- 1917 als: Schlern-Schriften ; Bd. 129 u. 177
ISBN 978-3-7030-0918-1
Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder in einem anderen Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses Buch erhalten Sie auch in gedruckter Form mit hochwertiger Ausstattung in Ihrer Buchhandlung oder direkt unter www.uvw.at.
ZUM GELEIT
Die erste Auflage des Buches von Viktor Schemfil, Die Kämpfe im Drei Zinnen-Gebiet (1955), hat der Herausgeber der Reihe, Raimund v. Klebelsberg, u. a. mit folgendem Satz eingeleitet: In immer weitere Jahre rücken die Kämpfer von einst vor, immer lichter werden ihre Reihen, immer vordringlicher wird die Pflicht, die Erinnerungen zu sammeln und sie der Nachwelt zu überliefern, zur Ehre derer, die damals Großes getan haben, und zum Ruhme Tirols!
Seither sind dreißig Jahre vergangen, die Zahl der Überlebenden des großen Kampfes um Österreich und Tirol ist weiter zusammengeschrumpft und die Frist nicht mehr fern, da der letzte, der noch dabei war, heimgegangen sein wird, eingerückt zur großen, zur ewigen Armee. Die heute noch übrig sind, verzeichnen schmerzlich, daß die inneren Werte, denen sie gedient, vielfach gerade so wenig geachtet werden wie die Landschaft, daß Konsumdenken und Egoismus unsere Seele zerstören und das erniedrigen, was jenen Kämpfern heilig war und ist.
So sind die Darstellungen von Haltung und Leistung unserer Väter, insbesondere an der Südtiroler Front, eine Mahnung, nicht zu vergessen und nicht ganz von dem zu lassen, was der große Inhalt unserer Vergangenheit genannt werden darf. Zu diesen Darstellungen zählen in vorderster Reihe die Bücher des Kaiserjägeroffiziers und späteren Generalmajors des Bundesheeres Viktor Schemfil1. Seit Jahren vergriffen, feiern sie, auch dank der Initiativen der Tochter des 1960 verewigten Verfassers, fröhliche Urständ. Auf die Bände Col di Lana, Monte Pasubio und Monte Piano - Monte Cristallo folgt nun – gemeinsam als Schlußstein des stolzen Gebäudes – der Band, der die Schilderung und Beurteilung der Kämpfe um den Kreuzberg in Sexten und im Drei Zinnen-Gebiet 1915–1917 und damit der östlichsten Abschnitte der Dolomitenfront vereinigt.
Für das Verbindungsglied dieser Grenzabschnitte, die Sextener Rotwand, lag bereits die begeisternde Schilderung eines Mitkämpfers in Oswald Ebners Buch „Der Kampf um die Sextener Rotwand“ vor sowie für das Verbindungsglied zwischen Col di Lana und Monte Piano die Monographie Georg Burtschers von den Kämpfen in den Felsen der Tofana, so daß diese Frontstücke von Schemfil ausgespart werden konnten2.
Die kämpferische Leistung empfängt hier noch insoferne eine besondere Wertung, als es nicht nur um jeden Gipfel, sondern um jeden Felskopf, um jedes Gratstück und jede Felsscharte ging und so das Gelände neben dem tapferen Soldaten auch einen das Leben wagenden Bergsteiger verlangte.
Aus den zahlreichen heldischen Episoden ragt das Paternkofel-Unternehmen im Drei Zinnen-Gebiet, bei dem einer der Tapfersten der Tapferen, der Sextener Bergführer Sepp Innerkofler, den Heldentod fand, hervor. Schemfil hat mit der ihm eigenen Sorgfalt gerade auch in diesem Fall neben dem schriftlichen Niederschlag der militärischen Dienststellen die erreichbaren lebenden Quellen befragt, um eine möglichst wahrheitsgetreue Darstellung zu geben, und ist zum Schluß gekommen, daß Innerkofler durch eine feindliche Kugel den Tod gefunden hat3.
Aus Anlaß des 60. Todestages (4. Juli 1975) hat der gleichnamige Sohn des Gefallenen, Wirt am Dolomitenhof im Fischleintal (Sexten), der 1915 als 17jähriger mit einem Feldstecher vom Zinnenplateau aus den Todesgang des Vaters verfolgte, die Darstellung Schemfils kritisiert und die Aussage des Standschützen Franz v. Rapp, der mit Vater Innerkofler damals am Paternkofel war, und auf die sich daher Schemfil nicht zuletzt stützte, in Zweifel gezogen. Nach seinen eigenen Wahrnehmungen sei der Vater durch eine Kugel der Maschinengewehrgarbe gefallen, die österreichischerseits zur Unterstützung des Angriffs zur Unzeit auf den Gipfel des Paternkofels abgegeben worden sei4.
Dies rief alsbald einen der Mitkämpfer aus den benachbarten Sextener Abschnitt, den späteren Landeshauptmann-Stellvertreter von Tirol, Josef Anton Mayer, auf den Plan. Er wollte, zumal andere Äußerungen die Version des Sohnes Innerkofler zu bestätigen schienen, Klarheit gewinnen. Dazu hat er weitere Zeugen gesucht und verwertet, aber die erhoffte Klarheit brachten sie nicht. Mayer stellt bereits für die erste Zeit uneinheitliche Berichte fest und am Schluß mit Recht die Frage: „Wie immer es gewesen sein mag, wer vermöchte dies mit gutem Gewissen zu sagen?“5
Über all diesem Zwiespalt und Zweifel steht himmelweit das Beispiel und Opfer dessen, der sein Leben für Vaterland und Heimat gab. Darum schließen wir mit den Versen eines Sprechers dieser großen Zeit, wenn er auch heute, wie sie, nicht mehr die Hochschätzung erfährt, die er verdienen mag:
Kein Grat und keine Klippe,Die nicht sein Fuß bezwang,Bis ihn des Todes Hippe,Dort grausam niederrang.Auf heimatlichen SchroffenSchrieb er mit Herzblut rotDie alten HeldenstrophenDer Treue bis zum Tod.Der Führer uns und FergeIns Reich der Schönheit war,Sein Denkmal sind die BergeUnd bleibens’s immerdar!
Br. Willram
Franz Huter
Anmerkungen
1 Viktor Schemfil, Col di Lana. Geschichte der Kämpfe um den Dolomitengipfel 1915–1917. Verlag J. N. Teutsch, Bregenz 1935. – Nachdruck in: Schriftenreihe zur Zeitgeschichte Tirols, Bd. 3, Verlag Buchdienst Südtirol, Nürnberg, o. J. (1983).Derselbe, Die Pasubiokämpfe. Das Ringen um den Eckpfeiler der Tiroler Front 1916–1918. Verlag J. N. Teutsch, Bregenz 1937. Nachdruck in: Schriftenreihe zur Zeitgeschichte Tirols, Bd. 4, Verlag Buchdienst Südtirol, Nürnberg, o. J. (1984).Derselbe, Monte Piano. Geschichte der Kämpfe (1915–1917) um einen der wichtigsten Stützpunkte der Dolomitenfront, verfaßt auf Grund der Kriegsakten, Schilderungen von Mitkämpfern und italienischer kriegsgeschichtlicher Werke. Schlern-Schriften Bd. 61, Universitätsverlag Wagner, Innsbruck 1949. – Derselbe, Die Kämpfe im Cristallo-Gebiet (Südtiroler Dolomiten) 1915–1917, Schlern-Schriften Bd. 161, Universitätsverlag Wagner, Innsbruck 1957. – Diese beiden Veröffentlichungen in einem Band zusammen in 2. Auflage herausgegeben in Schlern-Schriften Bd. 273, Universitätsverlag Wagner, Innsbruck 1984.Derselbe, Die Kämpfe im Drei Zinnen-Gebiet 1915–1917. Schlern-Schriften Bd. 129, Universitätsverlag Wagner, Innsbruck 1955. – Derselbe, Die Kämpfe am Kreuzberg in Sexten. Schlern-Schriften Bd. 177. – Diese beiden Veröffentlichungen erscheinen hier in 2. Auflage zusammen als Schlern-Schriften Bd. 274, Universitätsverlag Wagner, Innsbruck 1986.
2 Diese beiden Werke erschienen im Verlag J. N. Teutsch, Bregenz 1933 bzw. 1937. Vom Buch Ebners wurde 1974 im Selbstverlag ein Neudruck als zweite Auflage veranstaltet. Eine dritte Auflage hat 1976 die Verlagsanstalt Athesia Bozen herausgebracht. Sie enthält zu dem schon in der ersten Auflage beigegebenen Anhang eines Auszuges aus dem Tagebuch Innerkoflers von Otto Langl einen zweiten Anhang aus der Feder von J. Rampold, Der Weg einer Hochgebirgskompagnie. Die heutigen touristisch begehbaren Steiganlagen an der Sextener Rotwand.
3 Schemfil hat, schon lange bevor er das Buch über die Kämpfe im Drei Zinnen-Gebiet veröffentlichte, in einer eigenen Untersuchung über das Paternkofel-Unternehmen, das er im übrigen vom militärischen Blickpunkt her sehr kritisch beurteilt, und den Tod Sepp Innerkoflers geschrieben (Beitrag zur Klebelsberg-Festschrift, Veröffentlichungen des Museums Ferdinandeum Bd. 26/29, 1946/1949) und dazu u. a. Tagebuchaufzeichnungen, Berichte und Briefe von Mitkämpfern, die er befragt hatte (vgl. die Anschriften von 14 Briefschreibern am Schluß der Abhandlung), verwendet. So muß seinem Urteil, auch wenn Irrtümer in der Wahrnehmung von Zeugen nie auszuschließen sind, zumindest ein hoher Wahrscheinlichkeitswert zuerkannt werden. Das Manuskript zum Aufsatz lag schon 1938 vor.
4 Josef Innerkofler, Zum Tode meines Vaters Sepp Innerkofler, in: Der Schiern, Bd. 49, 1975, S. 544–546.
5 Josef Anton Mayer, Unternehmen Paternkofel, in: Alpenvereinszeitschrift, 101. Bd., 1976, S. 104–112.
INHALTSVERZEICHNIS
Zum Geleit. Von Franz Huter
1. Teil
Die Kämpfe im Drei Zinnen-Gebiet
Einleitung
1. Österreichische Grenzschutzvorbereitungen bis zum Beginn des Krieges mit Italien
2. Lage auf italienischer Seite. Angriffspläne
3. Lage auf österreichischer Seite
4. Die Zinnen-Hochfläche und das Bacherntal
a) Allgemeine Lage
b) Besetzung der Zinnen-Hochfläche am 12. Mai 1915
c) Patrouillentätigkeit des Standschützen-Bergführers Sepp Innerkofler 21. Mai 1915 27
5. Österreichischer Angriff auf den Paternsattel am 26. Mai 1915
6. Besetzung des oberen Bacherntales durch die Italiener in der ersten Junihälfte 1915. Patrouillengänge Sepp Innerkoflers 7. bis 14. Juni 1915
7. Aufklärung und Unternehmungen im Gebiete des Elfers
a) Beobachtungspatrouille Sepp Innerkoflers auf den Elfer am 19. Juni 1915
b) Patrouillenunternehmung des Leutnants von Schullern und Sepp Innerkoflers am 25. Juni 1915
8. Österreichische Unternehmungen auf der Zinnen-Hochfläche und im Gebiete des Elfers am 4. und 6. Juli 1915
a) Allgemeine Lage
b) Paternkofel-Unternehmung am 4. Juli. Tod Sepp Innerkoflers. Seine Enterdigung und Überführung nach Sexten im Jahre 1918. Angriff auf die Gamsscharte
c) Unternehmung gegen die italienischen Stellungen in der Linie Croda d’Arghena–Zinnen-Kuppe 2324 am 5. bis 10. Juli 1915
d) Besetzung des Sentinellapasses, der Elferscharte und der Rotwand am 4. Juli 1915
e) Brand der Zsigmondy-Hütte am 7. Juli 1915
9. Besetzung der Hochbrunner Schneid, des Zsigmondy-Grates und der Zeltscharte durch die Italiener am 4. August 1915
10. Italienische Angriffe im August 1915
a) Allgemeine Lage
b) Italienischer Angriff im oberen Bacherntal auf die Zsigmondy-Stellung am 4., 14. und 17. August 1915
c) Angriff der Italiener auf der Zinnen Hochfläche am 14., 18. und 19. August 1915
e) Erster Angriff der Italiener auf den Sentinellapaß am 7. August 1915
d) Zweiter italienischer Angriff auf den Sentinellapaß vom 13. bis 15. August 1915
f) Aufklärungspatrouille des Feldkuraten Hops auf den Elfergipfel vom 22. bis 24. August 1915
11. Italienische Angriffe Ende August und im September 1915
a) Allgemeine Lage
b) Italienischer Angriff im Bacherntal vom 26. bis 30. August 1915
c) Italienischer Angriff im Altsteinsattel vom 27. bis 31. August 1915
d) Dritter italienischer Angriff auf den Sentinellapaß am 3. September 1915
e) Italienischer Angriff auf die Elferscharte vom 7. und 10. September 1915
12. Abmarsch des bayerischen Infanterie-Leibregimentes und der deutschen Artillerie-Formationen. Einsatz des k. u.k. 2. Regimentes der Tiroler Kaiserjäger im Grenzunterabschnitt 10b
13. Unternehmungen des X. Marschbataillons des Infanterie-Regimentes Nr. 59 gegen den Sextenstein am 30. Oktober und 1. November 1915
a) Unternehmung am 30. Oktober 1915
b) Unternehmung am 1. November 1915
14. Der Toblinger Knoten und sein Ausbau als Beobachtungsstation
15. Das Kriegsjahr 1916/17
a) Der Winter 1916
b) Vierter Angriff und Eroberung des Sentinellapasses durch die Italiener am 16. April 1916
c) Unternehmungen gegen den Sextenstein am 11. September 1916
d) Unternehmung am 12. April 1917
16. Auswirkungen der großen österreichischen Herbstoffensive im Jahre 1917 am Isonzo auf die Dolomitenfront
Anhang
1. Besatzungstruppen der beiden Kampfabschnitte Zinnen-Hochfläche und Fischleintal
2. Quellen
3. Abkürzungen
4. Italienische Orts- und Geländebezeichnungen
2. Teil
Die Kämpfe am Kreuzberg in Sexten
Einleitung
1. Österreichische Grenzschutzvorbereitungen bis zum Beginn des Krieges mit Italien
2. Lage auf österreichischer Seite zur Zeit der Kriegserklärung Italiens
3. Österreichische Teilangriffe nach der Kriegserklärung im Grenzunterabschnitt 10 b auf den Frugnoni und die Pfannspitze (Monte Vanscuro) von Ende Mai bis 3. Juni 1915
4. Italienischer Angriff auf das Wildkarleck (Cima Valone), auf die Porze (Cima Palombino) und das Tilliacher Joch vom 9. bis 18. Juni 1915
5. Vorlegen von Sicherungsabteilungen in das Gebiet von Burgstall–Kreuzbergstraße–Seikofel und Roteck und Einsatz des Bayerischen Infanterie-Leibregimentes
6. Italienischer Angriff auf die Höhen östlich des Kreuzbergsattels (Frugnoni-Pfannspitze und Königswand bzw. Filmoorhöhe) vom 9. bis 12. und am 18. Juli 1915
7. Italienischer Angriff auf die Stellung Burgstall–Seikofel–Roteck am 4. August 1915
8. Italienischer Angriff auf die Stellung Burgstall–Pfannspitze am 6. September 1915
9. Abmarsch des Bayerischen Infanterie-Leibregimentes und der deutschen Artillerieformationen im Herbst 1915. Einsatz des 2. Regimentes der Tiroler Kaiserjäger im Grenzunterabschnitt 10b
10. Italienischer Angriff im Kreuzbergabschnitt am 24. Oktober 1915
11. Der weiße Tod
12. Die Jahre 1916/17
Schlußbetrachtung
Anhang
1. Abkürzungen
2. Quellen
1. Teil
Die Kämpfe im Drei Zinnen-Gebiet (1915–1917)
Einleitung
Die Abwehr der Invasion des Landes Tirol im Jahre 1915 gegen einen zahlenmäßig weit überlegenen Gegner mit dem folgenden zweijährigen, harten und opferreichen Ringen an den Landesgrenzen gehört zu den ruhmvollsten Blättern der Tiroler Geschichte. Sie würde es verdienen, in einem zusammengefaßten, erschöpfenden Werke dargestellt zu werden. Der Verlust der meisten Feldakten der höheren Verbände aber in diesem weiten Kriegsgebiet und der Mangel an Truppengeschichten ließen eine solche Darstellung nicht zu. So bildete sich im Laufe der Jahrzehnte durch das Erscheinen von nicht zusammenhängenden Einzelgeschichten und einiger Truppengeschichten eine nur sehr lückenhafte Literatur der Tiroler Landesverteidigung dieser Zeit heraus. Sie konzentrierte sich auf die am meisten umstrittenen Frontabschnitte, die Dolomitenfront und die Front vom Pasubio bis zum Grappa-Massiv, wobei die Dolomitenfront die größere Beachtung erfuhr. Hier tobten zu Beginn des Krieges mit Italien in der ersten Hälfte des Jahres 1915 die heftigsten und opferreichsten Kämpfe. Mit der geschichtlichen Darstellung derselben befaßten sich neben den sehr übersichtlichen Schilderungen von Cletus Pichler „Der Krieg in Tirol 1915/16“1 und von Val. Feuerstein „Dolomitenkämpfe“2 hauptsächlich Truppengeschichten wie die des „k. u. k. 3. Regiments der Tiroler Kaiserjäger im Weltkriege 1914–1918“ von V. Schemfil3, „Die Tiroler Kaiserjäger im Weltkriege 1914–1918“, Altkaiserjägerklub A. F. Götz4, ferner jene des „Festungsartilleriebataillons Nr. 1“ und A. v. Mörls Buch5 „Die Standschützen im Weltkrieg“. Sie behandeln die Tätigkeit dieser Truppen im Gebiete Col di Lana, Lagazuoi, Valparola, Monte Piano und Sexten, aber nur eben jene Zeitabschnitte, in denen die betreffenden Truppen dort eingesetzt waren. Eine Geschichte des Landesschützen- (später Kaiserschützen-)regimentes III, das die Hauptlast der Kämpfe im Rufreddo-, Piano- und Zinnen-Gebiet zu tragen hatte, ist leider nicht erschienen.
Die erste zusammenhängende und eingehende Darstellung der kriegerischen Ereignisse im engeren Bereiche eines Kampfabschnittes brachte die Monographie „Die Kämpfe in den Felsen der Tofana“ von Guido Burtscher6. Sie behandelte in ausgezeichneter Schilderung das kriegerische Geschehen im Travenanzes- und Lagazuoi-Gebiet in den Jahren 1915 bis 1917. Ihr folgte als weitere Einzeldarstellung das im Jahre 1935 erschienene Buch7 von V. Schemfil „Col di Lana“, das die Kämpfe um diesen so heiß umstrittenen Berg und seine Gipfelsprengung im Zeitabschnitt 1915 bis 1917 eingehend schildert.
Damit war 17 Jahre nach Ende des Ersten Weltkrieges der Verlauf der Ereignisse im westlichen Teil der Dolomitenfront, der sich mit dem Grenzunterabschnitt 9 fast deckte, in übersichtlicher und genauer Darstellung geschildert. Der östliche Teil aber, der Grenzabschnitt 10 mit dem Rufreddo-, Piano-Drei-Zinnen-, Rotwand- und Kreuzberg-Gebiet und dem Karnischen Kamm, war bis dahin nur in großen Zügen behandelt worden. Das 1937 erschienene vorzügliche Buch „Der Kampf um die Sextner Rotwand“ von 0. Ebner8 griff dann nur einen beschränkten Teilabschnitt heraus.
Um die im übrigen verbliebene Lücke im Osten zu schließen, begann der Verfasser im Jahre 1937 mit einer zusammenhängenden Gesamtbearbeitung des Abschnittes vom Cristallo bis zu Kärntner Grenze.
Den hiebei sehr fühlbaren Mangel an archivalischem Material mußten lebende Quellen ersetzen, die trotz mancher unvermeidbarer Einseitigkeit und Ungenauigkeit der Angaben doch sehr wertvolle Anhaltspunkte für die Rekonstruktion der Kämpfe ergaben. Die sehr eingehende und erschöpfende italienische Kriegsliteratur9 wurde ausgiebig herangezogen. Denn eine wissenschaftlich fundierte Kriegsdarstellung hat erst dann Wert, wenn man den entsprechenden Einblick in das hat, was beim Gegner geschah. Die Benützung der italienischen Literatur brachte viel Licht in den Verlauf der Kämpfe durch die Gegenüberstellung der Ereignisse und ermöglichte durch eine chronologische Übereinstimmung vielfach erst eine Rekonstruktion in historischer Treue.
Das auf diese Weise vom Verfasser im Jahre 1943 beendete umfangreiche Manuskript „Die Kämpfe in den Ampezzaner und Sextner Dolomiten im Weltkriege“ kam jedoch damals für eine Drucklegung nicht in Betracht, weil alles, was mit dem Ersten Weltkriege zusammenhing, vor den wichtigeren Geschehnissen des Zweiten Weltkrieges in den Hintergrund treten mußte. Nach dem Zweiten Weltkriege schwand begreiflicherweise das Interesse an einer militärischen Vergangenheit.
In dieser Zeit hat sich Universitätsprofessor Dr. von Klebeisberg, der im Ersten Weltkriege in eigener Kriegsdienstleistung die ganze Südtiroler Front kennengelernt hatte und dessen besonderes Interesse der Dolomitenfront galt, ein hohes Verdienst um die Tiroler Geschichte dadurch erworben, daß er kriegerische Ereignisse dieser Front der Vergessenheit entriß, indem er trotz vieler zeitbedingter Hindernisse und Hemmnisse im Jahre 1949 die Monographie „Monte Piano“ des Verfassers in den Schlern-Schriften (61. Band) herausgab und nun auch die Geschichte der Kämpfe im Drei-Zinnen-Gebiet erscheinen läßt.
Zu diesem Zwecke mußte der Verfasser das Manuskript über die Kämpfe in den Ampezzaner und Sextner Dolomiten in mehrere Einzeldarstellungen zerlegen, und zwar Rufreddo-Cristallo, Monte Piano, Drei-Zinnen-Hochfläche, Sexten und Karnischer Kamm, von denen nun Monte Piano und die Zinnenfläche veröffentlicht sind.
Professor Dr. von Klebelsberg sei für alle seine bisherigen Bemühungen wärmster Dank gesagt.
1. Österreichische Grenzschutzvorbereitungen bis zum Beginn des Krieges mit Italien
Schon vor der Kriegserklärung Italiens an die österreichisch-ungarische Monarchie war die Tiroler Verteidigungsfront in fünf Subrayone eingeteilt10. Der Dolomitenabschnitt11 bildete den Subrayon V mit den Grenzabschnitten 9 und 10. Er reichte vom Pordoijoch bis zur Kärntner Grenze und hatte eine Ausdehnung von fast 90 Kilometern. Jeder Grenzabschnitt zerfiel in Grenzunterabschnitte, diese wieder in Kampfabschnitte.
Die Tiroler Grenze war zu Kriegsbeginn meist offen und an der Dolomitenfront nur durch gänzlich veraltete, aus den achtziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts stammende und mit alten Geschützen armierte Befestigungen gesperrt. Auch das mobile Artilleriematerial war im allgemeinen alt, bereits ausgemustert und nur in verhältnismäßig geringer Zahl vorhanden.
Mit den Befestigungsarbeiten war man sehr im Rückstände, weil man, um die schon seit längerer Zeit dauernden diplomatischen Verhandlungen mit Italien nicht zu stören, alle auffallenden militärischen Vorbereitungen zurückgestellt hatte. Dadurch wurde viel kostbare Zeit für die Arbeiten an der Verteidigungsfront versäumt.
Vor der italienischen Kriegserklärung verfügte das Landesverteidigungskommando von Tirol über nur wenige Kräfte zur Sicherung der Grenze. Es waren dies einige in Südtirol in Ausbildung begriffene Marschbataillone12, die zudem noch in kurzer Zeit ihre Abberufung zu ihren Feldtruppenkörpern zu erwarten hatten, ferner acht aus Eisenbahnsicherungsabteilungen zusammengestellte Landsturmbataillone (Nr. 160 bis 167) mit notdürftiger Ausbildung, sieben aus Militärarbeiterabteilungen der Infanterieregimenter 29 (serbisch) und 37 (ungarisch) gebildete Reservebataillone und Gendarmerie- und Finanzwachabteilungen.
Als der Krieg gegen Italien begann, ließen es die außerordentlich schweren Verluste auf dem russischen und serbischen Kriegsschauplatz, die die Blüte des k. u. k. Heeres und eine große Menge von Kriegsmaterial verschlungen hatten, nicht zu, die Tiroler Grenze mit Feldtruppen zu dotieren, zumal der noch verfügbare Teil derselben an den wichtigsten Abschnitt der neuen Kriegsfront, an den Isonzo, abgestellt werden mußte.
Es blieben daher für die Verteidigung Tirols nur die bereits erwähnten Marsch-, Landsturm- und Reservebataillone übrig, zu denen sich bei der Kriegserklärung noch die Standschützenformationen gesellten, die sich, wie seinerzeit ihre Vorfahren, zur Sicherung ihrer Heimat zur Verfügung gestellt hatten und sich hervorragende Verdienste erwarben.
In der Verteidigungslinie des Subrayons V, dem Bereich der 56. Gebirgsbrigade, das ist vom Pordoijoch bis zur Kärntner Grenze, standen, als am 23. Mai 1915 um 19 Uhr die Nachricht von der Kriegserklärung Italiens an die k. u. k. Monarchie eintraf, nur sechseinhalb Bataillone mit zwei mobilen Batterien, und zwar die Marschbataillone des Infanterieregimentes 59, des 1. Regimentes der Tiroler Kaiserjäger und des Landesschützenregimentes Innichen III, ferner die Landsturmbataillone 165 und 167, ein Reservebataillon des Infanterieregimentes 29 und zehn Standschützenkompagnien13, Gendarmerie- und Finanzwachassistenzen.
Der Bereich des Subrayons V bzw. des 56. Gebirgsbrigadekommandos stand unter der Führung des Generalmajors Bankowsky14 und war gegliedert15 in den Grenzabschnitt 9 (Mjr. Busch, Lsch. III) vom Pordoijoch bis zum Seelandbachtal, Grenzabschnitt 10 (Obstl. Haslehner, Lsch. III) vom Seelandbachtal bis zur Kärntner Grenze.
Die Grenzabschnitte zerfielen in die Grenzabschnitte 9a und 9b und 10a, b und c, und diese wieder in Kampfabschnitte bzw. Kampfgruppen.
Der Grenzabschnitt 10 (Obstl. Haslehner) war folgend eingeteilt:
Grenzunterabschnitt 10a (Hptm. Schmid) mit den Kampfabschnitten Rufreddo, Gemärk und Landro (später Schluderbach),
Grenzunterabschnitt 10b (Obstl. Haslehner) mit den Kampfabschnitten Zinnenhochfläche, Fischleintal, Burgstall und Hornischeck (ab 23. Juni Seikofel),
Grenzunterabschnitt 10c (Mjr. von Pasetti) mit den Kampfabschnitten Eisenreich und Filmoorhöhe.
2. Lage auf italienischer Seite. Angriffspläne
Das italienische Heer war zur Zeit der Kriegserklärung in seiner materiellen Ausrüstung noch nicht schlagfertig. Es fehlte hauptsächlich an Artillerie und Maschinengewehren.
Von den vier italienischen Armeen umspannten zwei Tirol, und zwar16
I. Armee vom Stilfser Joch bis Croda Grande (südwestlich Agordo) mit demIII. Korps vom Stilfser Joch bis zum Gardasee (5., 6. und 35. Division),V. Korps vom Gardasee bis Croda Grande (9., 34. und 15. Division),
IV. Armee (Generalleutnant Nava) von Croda Grande bis zum oberen Piave (Monte Paralba im Karnischen Kamm),IX. Korps (Generalleutnant Ragni) von Croda Grande bis Rocchetta (17. und 18. Division),I. Korps (Generalleutnant Marini) von Roccetta (südlich Cortina) bis Monte Paralba (2. und 10. Division).
Das dem österreichischen Subrayon V (56. Gebirgsbrigade) gegenüberliegende italienische I. Korps, dem die Täler Boite, Ansiei und Padola17 zugewiesen worden waren, stand in folgenden Räumen:
2. Division (Generalleutnant Nasali Rocca)im Raume Venas-Borca im Val Boite mit der Brigade Como (Generalmajor Ussani) und der Brigade Umbria (Generalmajor Fiorelli).
10. Division (Generalleutnant Scrivante) teils im Raume Auronzo, teils im Raume San Nicolo im Val Padola mit der Brigade Marche (Generalmajor Fabri) und Ancona (Generalmajor Neomartini).
1. Division (Generalleutnant Petitti Roreto) zwischen Sedico Bribano und Longarone im Val Piave mit der Brigade Parma (Generalmajor Montuori) und Basilicata (Generalmajor Ferero).
Zwei Alpinibataillone (vier Kompagnien des Alpinibataillons Pieve di Cadore und zwei des Alpinibataillons Val Piave) mit einigen Gebirgsbatterien besorgten den Grenzschutz. Außerdem standen noch zur Verfügung das 16. Finanzwachbataillon in San Stefano di Cadore und das 8. Bersaglieriregiment. Das 20. Feldartillerieregiment lag mit einer Gruppe im Val Ansiei (Stabilizane) und mit einer in Padola.
Die italienische Führung glaubte, im Falle des Zusammenstoßes mit dem Heere der österreichisch-ungarischen Monarchie auf heftigen Widerstand zu stoßen und beabsichtigte, da die notwendige Schlagfertigkeit noch nicht erreicht war, gewagten Unternehmungen auszuweichen und mit den vorhandenen Kräften nur begrenzte Ziele zu erreichen.
Während demgemäß die I. italienische Armee in der strategischen Offensive zu verbleiben, mit kleinen Offensivstößen ihre Front zu sichern und feindliches Gebiet zu besetzen hatte, sollte die IV. Armee (Cadorefront) mit der Bekämpfung der Sperren Sexten, Landro und Valparola (Tresassi) beginnen. Als erstes Ziel war der IV. Armee die Erreichung von Toblach mit dem rechten Flügel und der Sellagruppe mit dem linken vorgeschrieben, wobei letztere Aufgabe dem IX. Korps zufiel. Die Bekämpfung der befestigten Stellung bei Son Pauses und der Sperren Landro und Sexten und der Stoß auf Toblach war dem I. Korps übertragen.
Da aber die Belagerungsartillerie zu Kriegsbeginn noch lange nicht zur Stelle war, hatte die Armee sofort nach der Kriegserklärung sich jener Raume zu bemächtigen, aus denen der beabsichtigte Angriff vorzutragen war. In Durchführung dieses Befehles besetzte sie kampflos das Becken von Cortina d’Ampezzo, das zwar innerhalb der österreichischen Grenze, aber doch vor der österreichischen Verteidigungslinie lag, und den Kreuzbergsattel.
Das Heranziehen des Belagerungsparkes und das Einrichten der Stellungen der schweren Batterien zog sich immer mehr in die Länge. Das italienische Höchstkommando wartete daher den Artillerieaufmarsch nicht ab, sondern befahl für den 1. Juni den Beginn des Generalangriffes.
Im Sinne dieses Befehles hatte das italienische I. Korps durch das Val Padola die Sperre Sexten, durch das Val Ansiei die Sperren Landro und Plätzwiese und durch das Val Boite die befestigte Stellung von Son Pauses anzugreifen. Das Alpinibataillon Fenestrelle (mit der 30. und 83. Kompagnie) sollte die Verbindung mit dem rechten Flügel des links benachbarten IX. Korps, der gegen Travenanzes und Val Parola angesetzt war, herstellen.
Während von den beiden Divisionen des I. Korps die 2. in den ersten Junitagen sogleich zum Angriff auf Son Pauses schritt, konnte die 10. mit der ihr aufgetragenen Bekämpfung der Sperren Landro-Sexten nicht beginnen, weil trotz überaus starker infanteristischer und artilleristischer Überlegenheit die österreichischen Truppen in diesem Raume die Initiative ergriffen hatten.
Ihre geringen Kräfte zwangen zwar zur strikten Defensive in der Linie der Sperren gegenüber dem auf drei Divisionen geschätzten Gegner, von dem man zudem annahm, daß er rasch und mit großer Übermacht zum Angriff übergehen werde. Doch wurde dieses Gebot der Defensive trotz zahlenmäßiger Unterlegenheit von einem starken Offensivgeist beherrscht, der sich in mehreren kleineren Unternehmungen aussprach. Am 26. Mai unternahm das IX./Lsch. III (Hauptmann Jaschke) aus eigener Initiative einen Angriff auf den Paternsattel. Am 3. Juni wurde durch die Besetzung des Frugnoni und der Pfannspitze (westlich des Kreuzbergsattels) eine Verbesserung der Verteidigungslinie erreicht. Am 7. Juni brachte ein kühn durchgeführter Handstreich den Nordteil des Monte Piano in den Besitz der Österreicher.
Schon diese mit minimalen Kräften durchgeführten kleinen Offensivstöße hatten den Italienern einen stärkeren Gegner vorgetäuscht, der die Initiative an sich gerissen hatte. Die einzige Offensivtätigkeit der Italiener war der Angriff der 10. Division auf Wildkarleck-Porze und Tilliacher Joch, bei dem nur die beiden ersten Höhen in ihre Hände fielen.
Auch den übrigen italienischen Divisionen blieb ein Erfolg versagt. Es sei gleich vorweggenommen, daß das Resultat des Generalangriffes der italienischen IV. Armee gering war. Ihre Korps hatten sich nur näher an die österreichische Verteidigungslinie herangeschoben.
3. Lage auf österreichischer Seite
Der Subrayon V (56. Gebirgsbrigade) erstreckte sich über eine schwer zugängliche Gebirgszone mit hochaufragenden Bergen und tief eingeschnittenen Tälern, die den Verteidigern die Lebensbedingungen zwar erschwerten, ihnen dafür aber die Möglichkeit der Geländebehauptung erleichterten. Für den Angreifer bildete diese Hochgebirgsgegend ein schweres Hindernis. Die an den Südhängen operierenden italienischen Truppen hatten den Vorteil der sonnigen, bald schneefreien Gebirgsseite, während die österreichischen Truppen an den Nordhängen noch lange mit tiefer Schneelage zu rechnen hatten.
Dem Subrayon war die Sicherung der durch das Pustertal führenden Verkehrswege, insbesondere der Bahnlinie übertragen. Wenn man bedenkt, daß von der Reichsgrenze auf dem Monte Piano der Ort Toblach im Pustertal nur 14 Kilometer und von Kreuzbergsattel der Ort Innichen nur 13 Kilometer in der Luftlinie entfernt waren, kann man die Gefahr ermessen, in der das Pustertal schwebte. So war die Aufgabe der Truppen des Subrayons eine zwar sehr ehrenvolle, hinsichtlich der vorhandenen, ganz unzulänglichen Kräfte aber eine sehr schwierige. Es sei bemerkt, daß die Division unter der tatkräftigen Führung ihrer Kommandanten, des Generalmajors Bankowsky, der Feldmarschalleutnante Goiginger und Pichler und des Generalmajors v. Steinhard dank der Tapferkeit und Zähigkeit der eingesetzten Truppen der schweren Aufgabe vollauf gerecht wurde. Alle während des Krieges von den Italienern mit großen Opfern versuchten Durchbrüche in dieses Tal mißlangen.
Die österreichische Führung hatte die Hauptwiderstandslinie im allgemeinen in die Linie der Sperren gelegt. Sie verlief im Grenzabschnitt 10 über den Knollkopf – das Seelandbachtal – die Strudelalpe – die Sperre Landro – den Rautkopf – die Drei-Zinnen-Hochfläche – die Zsigmondyhütte – die Rotwand – über Burgstall, die Sperren Haideck und Mitterberg – den Hornischeck und längs des Karnischen Kammes bis zu Kärntner Grenze.
Die Besetzung war, so wie an der ganzen Dolomitenfront, auch im Grenzabschnitt 10 eine sehr schüttere und unzulängliche. Zudem waren die Sperren alter Bauart, die Stellungen notdürftig ausgebaut und nur stellenweise besetzt, so daß die Lage nach der Kriegserklärung Italiens recht kritisch war. Man verlebte Tage des Hangens und Bangens, da das zwar noch nicht ganz schlagfertige, aber frische und zahlenmäßig weit überlegene italienische Heer mit erdrückender Übermacht den dünnen Schleier der österreichischen Front zerreißen und ungehindert in das Land einfallen konnte. Und doch war angesichts des trefflichen Geistes und des zähen Willens zum Durchhalten nicht alle Zuversicht geschwunden. Die kommenden Ereignisse zeigten, was eine von herrlichem Soldatengeist beseelte Truppe, auch wenn sie stark in der Minderzahl ist, zu leisten imstande ist.
4. Die Zinnen-Hochfläche und das Bacherntal
a) Allgemeine Lage
Für den Grenzunterabschnitt 10a (Landro) führte die Verbindung aus dem Pustertal an die Front von Toblach durch das Höhlensteiner Tal, für den Grenzunterabschnitt 10b, in dem die Zinnen-Hochfläche lag, verlief sie von Innichen durch das Sextental einerseits auf den Kreuzberg zur Versorgung der Kampfabschnitte Burgstall-Seikofel, andererseits bei Bad Moos zu den Kampfabschnitten Zinnen-Hochfläche und Fischleintal. Der Grenzabschnitt 10c mit den Kampfabschnitten Eisenreich und Filmoorhöhe stand durch mehrere Seitentäler mit dem Kartitscher Tal in Verbindung.
Vor und bei Beginn des Krieges wurde das Grenzgebiet der Drei Zinnen und das Giralbajoch kurz mit „Kampfgruppe Drei Zinnen“ bezeichnet. Erst als bei den Einleitungskämpfen die Verteidigungsstellung von der Grenze abgesetzt und dabei auch das zum Giralbajoch führende obere Bacherntal aufgegeben werden mußte, wurden aus der einen Kampfgruppe zwei Kampfabschnitte mit der Bezeichnung Zinnen-Hochfläche und Fischleintal gebildet. Die Versorgung, die für den ersteren durch das Fischlein- und Altsteintal erfolgte, wurde von da an auf das weiter westlich von Sextental abzweigende Innerfeldtal umgelegt.
Die durch die geographischen und taktischen Verhältnisse bedingte Zusammengehörigkeit der beiden Kampfabschnitte läßt es bei der Darstellung der Kämpfe notwendig erscheinen, nicht nur die kriegerischen Ereignisse auf der Zinnen-Hochfläche, sondern auch die im Gebiete des oberen Fischleintales, des Elfers und des Sentinellapasses in die Schilderung miteinzubeziehen.
Die Kämpfe um die dem Sentinellapaß östlich benachbarte Rotwandspitze werden jedoch nicht aufgenommen, da diese Bergspitze als wichtiger rechter Eckpfeiler taktisch zur Sextner (Kreuzberg-)Stellung gehörte und außerdem die Ereignisse in Ebners Buch „Kämpfe um die Sextner Rotwand“ bereits erschöpfend geschildert sind.
Das Kampfgebiet der Zinnen-Hochfläche und des Fischleintales lag zwischen zwei feindlichen Einbruchsrichtungen, die einerseits über Schluderbach-Landro durch das Höhlensteiner Tal nach Toblach und andererseits über den Kreuzbergsattel und durch das Sextental nach Innichen verliefen. Wegen des ausgesprochenen Hochgebirgscharakters des Geländes und der damit verbundenen Unmöglichkeit, stärkere Kräfte zur Entwicklung zu bringen und wegen des Mangels eines gut fahrbaren Verkehrs- und Versorgungsweges nördlich der Front in das Pustertal kam es für größere Angriffsoperationen nicht in Betracht, wohl aber bot es für die benachbarten eigenen Kampfabschnitte wegen der Überhöhung recht günstige flankierende Batteriestellungen und Beobachtungsmöglichkeiten. Die Kämpfe auf der Zinnen-Hochfläche waren daher meist Begleit- und Demonstrationsangriffe im Rahmen größerer feindlicher Offensiven und besonders im Jahre 1915 oft recht schwer und verlustreich.
b) Die Besetzung der Zinnen-Hochfläche am 12. Mai18
Schon zur Zeit der Versammlung des italienischen I. Korps im Cadore – also vor der Kriegserklärung – wurde von den Italienern das Alpinibataillon Pieve di Cadore in den Raum Monte Piano – Drei Zinnen als Deckungstruppe vorgeschoben. Seine 75. Kompagnie (Hauptmann Gatto) hatte am 11. Mai die Grenzlinie Paternsattel (Forcella di Lavaredo) und Oberbacher Joch (Passo Fiscalino), die 96. Kompagnie (Hauptmann Rossi) den Monte Piano mit dem Val Popena Bassa und dem Val Rimbianco besetzt. Der Kommandant des Alpinibataillons (Major Graf Buffa di Perero) mit seinem Stab und zwei Gebirgsbatterien befand sich in Misurina.
Auf österreichischer Seite sollte auf Befehl des Subrayonskommandanten Generalmajor Bankowsky einen Tag später (am 12. Mai) das IX. Marschbataillon des Landesschützenregimentes III (Hauptmann Jaschke) die Grenzsicherung auf der Drei-Zinnen-Hochfläche übernehmen. Vorerst ging nur der 1. Zug (Fähnrich Marsič) der 1. Kompagnie (Oberleutnant Trnozka)19 zur Drei-Zinnen-Hochfläche ab mit dem Befehl, die Übergänge an der Grenze, den Paternsattel, das Büllelejoch und das Giralbajoch zu besetzen. Er erhielt gleichzeitig die Weisung, jede Herausforderung der Italiener, von denen man noch immer hoffte, daß sie dem Dreibunde treu bleiben würden, zu vermeiden. Fähnrich Marsič fand jedoch, da er einen Tag später als die Italiener ankam, die genannten Übergänge bereits in den Händen der Alpini und hätte nur mit Anwendung von Waffengewalt seinem Auftrag nachkommen können.
Gebiet der Kampfabschnitte Zinnenhochfläche, Fischleintal
Unter Abänderung des ursprünglichen Befehles wurde ihm nun befohlen, mit einem Schwarm bei der Bödenalpe das Altsteintal und mit einem das Rienztal am oberen Ausgang zu sperren. Der Rest des Zuges hatte bei der Drei-Zinnen-Hütte, Front gegen den Paternsattel und am Frankfurter Würstl, Front nach Osten und Westen, Aufstellung zu nehmen. Zur Sperrung des Bacherntales gegen das Giralbajoch wurde Kadett Gruber mit 14 Mann in das Gebiet der Zsigmondy-Hütte befohlen.
So mußte um den Preis der Vermeidung von unerwünschten Grenzzwischenfällen eine in einer Respektsentfernung von der Grenze liegende und für die Verteidigung ungeeignete Stellung bezogen werden. Damit hatte man sich jedes Vorteiles einer geeigneten Stellung auf den beherrschenden Höhen und Übergängen längs der Grenzlinie begeben und konnte diesen Nachteil während des Krieges nicht mehr gutmachen.
Nach einigen Tagen (am 19. Mai) war die 1. Kompagnie zur Gänze auf der Hochfläche versammelt. Die 3. Kompagnie (Oberleutnant Voitl) rückte an diesem Tag bis zur Drei-Schuster-Hütte im Innerfeldtal vor, um dort eine zweite Stellung auszuheben.
Die durch den Zug des Fähnrichs Marsič angedeutete Verteidigungslinie auf der Zinnen-Hochfläche wurde am 20. Mai von der ganzen 1. Kompagnie, wie folgt, besetzt:
4. Zug in einer Stellung gegen das Rienztal mit je einer Patrouille auf dem Wildgrabenjoch und dem Gipsjoch.
1. Zug in einer Stellung bei der Drei-Zinnen-Hütte, Front gegen den Paternsattel, und in einer Flankenanlage bei dem Frankfurter Würstl.
3. Zug in einer Stellung auf der Bödenalpe, Front gegen das Büllelejoch.
2. Zug in einer Stellung Front gegen das Altsteintal mit einer Flankenanlage.
Die Hochfläche war noch stark verschneit und stellenweise nur mit Schneereifen der Ski gangbar. In den Mulden lag der Schnee über drei Meter hoch. Der Zuschub für Munition, Verpflegung und für Material zum Stellungsbau war daher ungemein erschwert.
Zur Aushebung der Schützengräben war von jedem Zug die Hälfte bestimmt, die andere hatte das Stellungsmaterial herbeizuschaffen. In den ersten Tagen erfolgte der gesamte Zuschub durch das Fischlein- und Altsteintal, dann durch das Innerfeldtal bis zur Drei-Schuster-Hütte mit Tragtieren. Von da aus mußte ihn die Kampftruppe mit eigenen Kräften mühsam und zeitraubend selbst besorgen. Nur der Schwarm des Kadetten Gruber blieb weiter auf die Versorgungslinie durch das Fischleintal angewiesen.
So lange noch keine Unterkünfte errichtet waren, wurde unter Zurücklassung von Wachen in den Stellungen eine halbe Kompagnie in der Drei-Zinnen-Hütte und die andere im Alpenseehotel untergebracht.
Die weit auseinandergezogene und unzulänglich von einer Kompagnie besetzte Stellung konnte nur einer Absperrung der Übergänge auf die Hochfläche und in die dort beginnenden Täler, aber keiner nachhaltigen Verteidigung der Hochfläche gerecht werden. Zur ständigen Besetzung der in Höhen bis zu 3000 Meter verlaufenden Grenzlinie fehlten die Kräfte. Auch ließ der Mangel an Trägerabteilungen für den Zuschub von Munition, Verpflegung und Stellungsmaterial die Festsetzung in solcher Höhenlage nicht zu.
Diese Umstände seien besonders erwähnt, weil von mancher, über die damaligen Verhältnisse nicht unterrichteten Seite in Veröffentlichungen der Führung der ungerechte Vorwurf gemacht wurde, sie hätte es versäumt, die weitaus günstigere Grenzstellung sofort in Besitz zu nehmen.
Am 20. Mai, dem Tage der Verlautbarung des Alarmbefehles, verlegte der österreichische Bataillonskommandant mit seinem Stab seinen Standort auf die Drei-Zinnen-Hochfläche. Der Abschnitt führte von da ab die Bezeichnung „Kampfgruppe Drei Zinnen“.
Es war ein merkwürdiger Zufall, daß am selben Tag auch das Kommando des Alpinibataillons Cadore seinen Standort von Misurina zur Unterkunftshütte im Val d’Aqua verlegte. Damit war gleichzeitig eine Änderung der bisherigen Besetzung auf italienischer Seite verbunden. Der Bataillonskommandant Major Buffa zog die 67. Alpinikompagnie (Hauptmann Busoli) heran und übertrug ihr die Sicherung des Raumes Drei Zinnen – Forcella Col die Mezzo – Croda d’Arghena. Die 75. Alpinikompagnie, die mit drei Zügen in der Kaserne nächst dem Paternsattel untergebracht war, hatte die Sicherung des Raumes östlich der Drei Zinnen, und zwar den Paternsattel, das Büllelejoch, den Oberbacher Sattel zu übernehmen. Die Maschinengewehrsektion des Oberleutnants Da Como stand auf dem Paternsattel, den die Italiener als den wichtigsten Teil ihrer Verteidigung auf der Zinnen-Hochfläche betrachteten.
Am gleichen Tage wurden dem Landesschützenbataillon eine Abteilung von 36 Sextner Standschützen und 35 Mann der Gendarmerie- und Finanzwachassistenz zugeteilt.
Nur die Bergführer, unter denen sich der bekannte Sextner Bergführer Sepp Innerkofler mit seinem 19jährigen Sohn Gottfried, ferner die Bergführer Piller, Forcher, Rogger usw. befanden, faßte man in eine Bergführerpatrouille unter dem Kommando Sepp Innerkofler zusammen. Die übrigen Standschützen, Gendarmerie- und Finanzwachleute hatten zum Teil Dienst beim Train zu machen oder waren der Pionierabteilung des Leutnants Müller zugewiesen.
Die Bergführerpatrouille trat alsbald in Verwendung und unternahm unter Sepp Innerkofler viele schwierige und erfolgreiche Beobachtungspatrouillengänge.
c) Patrouillentätigkeit des Standschützenbergführers Sepp Innerkofler ab 21. Mai bis 3. Juni 1915
Der Name Sepp Innerkofler ist mit der bergsteigerischen Erschließung der Sextner Dolomiten für alle Zeiten unauslöschlich verbunden. Als vor Beginn des Krieges mit Italien im Jahre 1915 die Sextner Standschützen aufgeboten wurden, meldete er sich freiwillig mit seinem Sohn Gottfried zum Waffendienste und rückte am 19. Mai ein. Damals war er ein 50jähriger Mann, Gottfried ein 19jähriger Jüngling. Beide waren bei der Standschützenkompagnie Sexten des Standschützenbataillons Sillian eingeteilt, zu der auch sein Bruder Christian, Hans Forcher und Vinzenz Goller gehörten.
Sepp Innerkofler war bisher nie zum Waffendienste geeignet befunden worden und daher soldatisch nicht ausgebildet. Sein durch die Jagd erworbener Spürsinn im Gelände aber, seine Schießfertigkeit, seine hervorragenden alpinistischen Kenntnisse im Kampfgebiet, sein zweifellos sehr gutes militärisches Urteil ersetzten den Mangel der soldatischen Ausbildung. Im Patrouillendienste leistete Innerkofler Hervorragendes. Während seiner fast siebenwöchentlichen Tätigkeit tauchte er bald da, bald dort auf den höchsten Gipfeln der ganzen Zinnenfront auf und täuschte so dem Gegner eine Besetzung vor20. Seine besonderen militärischen und alpinen Leistungen brachten ihm eine außergewöhnlich rasche Beförderung und die Verleihung mehrerer Tapferkeitsauszeichnungen ein. Schon bei seiner Einrückung am 19. Mai wurde er Standschützen-Patrouilleführer, am 21. Juni mit Übergehung der Unterjäger-und Zugsführercharge Standschützen-Oberjäger und erhielt die Kleine, kurz darauf die Große Silberne Tapferkeitsmedaille. Nach seinem Tode wurde ihm die höchste Tapferkeitsauszeichnung für Mannschaften, die Goldene Tapferkeitsmedaille, verliehen (vgl. Bild 24 auf Tafel 15).
In der Zeit vom 21. Mai bis 4. Juli 1915 unternahm Sepp Innerkofler folgende 17 Patrouillengänge:
21. Mai von der Zinnenhütte auf den Paternkofel
22. Mai vom Dolomitenhof auf Hochleist-Giralba
23. Mai Pfingstsonntag – italienische Kriegserklärung – vom Dolomitenhof auf den Ausläufer der Westlichen Zinne (2324 m)
24., 25., 26., 27. Mai täglich vom Sextenstein auf den Paternkofel
31. Mai vom Sextenstein auf den Morgenkopf
3. Juni von Bad Moos über das „Äußere Loch“ auf den Elfer
7. Juni vom Dolomitenhof auf die Hochbrunnerschneid
11. Juni vom Sextenstein auf den Toblinger Knoten
12. Juni vom Sextenstein auf die Morgenalpenspitze
14. Juni von Bad Moos auf den Einser
19. Juni vom Dolomitenhof auf den Elfer
25. Juni vom Dolomitenhof auf den Elfer und die Hochbrunner Schneid
30. Juni und 1. Juli von Sexten auf die Arzalpe
4. Juli Paternkofel †
Seine Begleiter waren meist die Bergführer und Standschützen Andreas Piller, der Schwager Innerkoflers, Forcher und Rogger und sein Sohn Gottfried, ferner Landesschützen-Unterjäger Bacher und Landsturmkorporal Hofbauer.
Den ersten Patrouillengang machte Innerkofler im Auftrage des Bataillonskommandanten Hptm. Jaschke am 21. Mai auf den Paternkofel, auf den ihn, am 4. Juli, auch sein letzter führen sollte.
Über die am 21. und 22. Mai unternommenen Patrouillen schrieb Innerkofler in sein Tagebuch:
„21. Mai. 6 Uhr früh ab auf den Paternkofel. Schuhtief Schnee. Konnten die Italiener sehr gut beobachten hinter dem Paternsattel, wo dieselben Batteriestände machen und Wege ausschaufeln. Wir waren mittags wieder zuhause zur Menasch (Menage).“
„22. Mai. 3 Uhr früh ab zur Drei-Zinnen-Hütte. Sehr mühsam. Drei Stunden. Von dort aus ins untere Bacherntal und links vom Hochleist hinauf auf den Giralba, wo wir, Bacher und ich, nur 20 Minuten beobachtet haben. Mit Ski herrlich herunter bis zum Talschluß und in den Dolomitenhof, wo auch drei Tänze gemacht wurden.
Am 23. Mai erhielt Innerkofler den Auftrag, von der Kote 2324 (westlich der Drei Zinnen) aus zu beobachten. Darüber ist in seinem Tagebuch zu lesen:
„23. Mai. Pflngstsonntag. Zur Drei-Zinnen-Hütte und von dort zum Ausläufer der westlichen (Zinne). Bacher, Korporal Hofbauer, Gottfried und ich, wo wir eine italienische Patrol (Patrouille) getroffen und gleichzeitig einen Italiener aus Angst schreien gehört haben, welcher auch gleichzeitig auf mich angeschlagen hat, was ihm aber nichts genützt haben würde; fürs erste haben wir sie (die Patrouille) zuerst gesehen, fürs zweite hätte er mich nicht getroffen, da er viel zu aufgeregt war. Ich war ganz ruhig, während er im Anschlag war. Die Tur war sehr lawinengefährlich.
Abends die Nachricht von der Kriegserklärung und wurde die Drei-Zinnen-Hütte sofort geräumt. Forcher und ich erhielten Befehl, den Paternsattel zu beobachten und hatten wir die erste Kriegsnacht. Ich lag auf der bloßen Pritsche. Es war die ganze Nacht Tumult und konnte ich nicht schlafen.“
Um 19 Uhr war tatsächlich auf telefonischem Wege die Nachricht eingetroffen, daß Italien sich „als mit der Österreich-ungarischen Monarchie im Kriegszustande befindlich“ erklärte. Nun wich die Spannung, die in den letzten Tagen alle Gemüter gefangen hielt und man wußte endlich, woran man war. Hptm. Jaschke hielt an die versammelten Offiziere und Mannschaften eine Ansprache, die er mit dem Wahlspruch der Landesschützen „Sieg oder Tod im Alpenrot“ schloß.
Nachher gab er Befehl zum sofortigen Beziehen der Stellung.
Der Schwarm des Fähnrichs Gruber bei der Zsigmondyhütte im Bacherntal und die als Reserve bestimmte 3. Kompagnie (Oberleutnant Voitl) wurden telefonisch vom Kriegszustand verständigt und letzterer beauftragt, auf die Zinnen-Hochfläche abzurücken.
Die Zinnenhütte, die bisher das Bataillonskommando und den im Dienste stehenden Teil der 1. Kompagnie beherbergte, wurde geräumt, jedes brauchbare Einrichtungsstück aus ihr entfernt und in die Schützengräben gebracht. Das Bataillonskommando bezog, da die Unterkunftsbaracke am Sextenstein noch nicht fertig war, das nächst den Bödenseen gelegene Alpenseehotel.
In der Zinnenhütte richtete man einen Raum als Verbandsplatz ein und hißte, um dem Gegner die Verwendung der Hütte zu Sanitätszwecken erkenntlich zu machen, eine Fahne mit dem roten Genfer Kreuz.