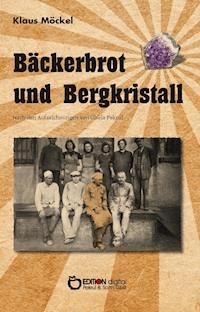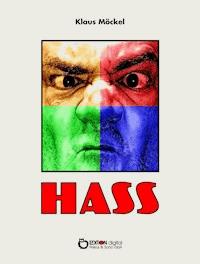5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: EDITION digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In den hier vorliegenden Erzählungen nimmt der Autor Erlebnisse seiner Nachkriegs-Kindheit zur Grundlage. So schildert er in „Die Katze am Teich“ den erbitterten Kampf eines Deserteurs mit einer streunenden, ausgehungerten Katze um ein Stück Räucherfleisch, in „Kleines Fuchs Lydia“ die wechselvolle Geschichte einer jungen Deutschrussin, die es auf der Flucht vor der Roten Armee in eine sächsische Kleinstadt verschlägt. Obwohl sie zur Geliebten des sowjetischen Kommandanten wird, bewahrt sie das nicht vor einem bedrohlichen Schicksal. Birgt die Titelerzählung äußerste Dramatik, so greift „Kleines Fuchs Lydia“ ans Herz. Voller lustiger Überraschungen sind dagegen „Der Apfel“, wo ein Zehnjähriger mit den Tücken kämpft, einen prächtigen Apfel vom Baum zu holen, und „Wer‘n mer gleich ham“, wo sich ein Schulabgänger bemüht, einen richtigen Schlosserlehrling abzugeben, obwohl er eine Fußbank braucht, um den Schraubstock zu erreichen, und eigentlich erst noch tüchtig wachsen müsste. Diese von Tragik und Heiterkeit geprägten Geschichten eines Zeitzeugen bieten Spannung, Information und Tiefe. Klaus Möckel, geb 1934 und Autor so bekannter Werke wie Drei Flaschen Tokaier; Hoffnung für Dan; Die Gespielinnen des Königs, verfügt über eine literarische Bandbreite, die ihresgleichen sucht. Ob Krimi, SF-Erzählung, historisches Abenteuer, Lyrik, packender Lebensbericht oder Satire-Spruch, Möckel versteht es, durch fantasiereiche Inhalte, gewitzten Hintersinn und immer wieder aufblitzenden Humor seine Leser zu fesseln.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 154
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Impressum
Klaus Möckel
Die Katze am Teich
Erzählungen
ISBN 978-3-68912-002-3 (E-Book)
ISBN 978-3-68912-004-7 (Hörbuch)
Umschlaggestaltung: Ernst Franta
© 2024 EDITION digital®Pekrul & Sohn GbR Godern Alte Dorfstraße 2 b 19065 Pinnow Tel.: 03860 505788 E-Mail: [email protected] Internet: http://www.ddrautoren.de
Der Apfel
Die Landstraße war gerade wie eine straff gespannte Schnur und schien nicht enden zu wollen. Zwischen Stoppelfeldern zog sie sich hin, zwischen Wiesen von kargem, gelblichem Grün, auf denen nur ab und an eine magere Ziege weidete. Mal stieg die Straße etwas an, mal senkte sie sich wieder, aber abbiegen würde sie erst da hinten am Horizont, wo die Hügel begannen, und auch dann war noch ein gutes Stück Weg zurückzulegen.
Jürgen, in Turnschuhen, schwarzer Skihose und einem knallgelben, viel zu weiten Sporthemd, das er von seinem großen Bruder „geerbt“ hatte, zählte seine Schritte: 728, 729, 730. Er war abgekämpft und hätte gern eine Rast gemacht, er hatte Hunger und vor allem Durst, denn der Marsch durch die Dörfer, die Gespräche mit den Bauern waren anstrengend gewesen an diesem sonnigen Herbsttag und die Luft trocken. Aber die Großmutter, die trotz ihrer sechzig Jahre keinerlei Müdigkeit zeigte, schritt, einen kleinen Sack Korn in der einen, ihren Wanderstock in der anderen Hand, unvermindert forsch aus. „Komm nur, komm“, sagte sie, als der Junge stehenbleiben wollte, „wenn wir uns beeilen, sind wir in einer Stunde zu Hause. Da gibt’s ein Glas Birnensaft, das versprech ich dir. Wir machen die große Flasche auf, die vom vorigen Jahr. Und deine Mutter wird bestimmt auch schon von der Arbeit zurück sein.“
Jürgen dachte einen Augenblick lang an die große grüne Flasche im Keller, und das Wasser lief ihm im Mund zusammen. Er hätte sie ansetzen und trinken können, bis sie leer, er selbst aber rund wie der Flaschenbauch war. Ein Glas, das war nicht viel, na ja, er würde das hohe aus dem braunen Schrank nehmen. Aber bis dahin war es noch weit – ein Bach in der Nähe wäre ihm lieber gewesen. Oder wenigstens ein Pferdefuhrwerk, das sie ein Stück mitnahm. Er würde hinten sitzen und die Beine baumeln lassen; die Großmutter könnte sich seinetwegen vorn zum Kutscher auf den Bock quetschen. Sie unterhielt sich gern mit den Leuten. Doch die Straße war nicht nur endlos, sie war auch wie leergefegt.
Es war später Nachmittag, ein paar Wolken kamen auf und schoben sich vor die Sonne, trotzdem blieb es warm. Jürgen dachte an die Schule, die bald wieder beginnen würde, und an das Fußballspiel vom vorigen Tag. Sie waren gegen die Angeber von der Hauptstraße angetreten und hatten drei zu eins geführt, als der Ball sein Leben aushauchte. Die Lederhülle war noch ganz gewesen, aber die Gummiblase darunter, zig-mal geflickt, hatte einen Riss abgekriegt, der ihr den Rest gab. Und Hänschen Räter, der einzige, der Ersatz stellen konnte, hatte sich nicht beschwatzen lassen. Er war sauer, weil er nicht in die Mannschaft aufgenommen worden war. Er schlug aber auch zu oft in den Rasen, so dass die Grasbüschel herumflogen und der Ball sonst wo landete, bloß nicht im Tor.
Nicht mal ein winziger Tümpel, aber nun gab es doch eine Abwechslung im Landschaftsbild: Rechts neben der Straße begann ein langer Zaun, und dahinter befand sich außer abgemähtem Rasen in einiger Entfernung eine Scheune. Wäre der Zaun nicht gewesen und an seinen Spitzen rostiger Stacheldraht, der Junge hätte sich trotz seiner Müdigkeit die Scheune mal schnell aus der Nähe angeschaut. Wusste man, ob sich nicht etwas Brauchbares darin fand? Korn oder Kartoffeln würden hier, weitab von den Bauernhöfen, zwar kaum gelagert sein, vielleicht gab es aber Kohlrüben. Für drei Kohlrüben hätte er einen Packen alter Flicken eintauschen können, und daraus ließ sich ein Stoffball machen. Der Zaun freilich verhinderte einen solchen Versuch von vornherein.
Jürgen ließ die Scheune Scheune sein, das Unternehmen wäre wohl auch am Einspruch der Großmutter gescheitert, die vorankommen wollte. Missmutig trottete der Junge weiter, sein Blick wanderte den Zaun entlang, an dem hier und da Sträucher wuchsen. Bis sich das Auge plötzlich festgehakt hatte. Automatisch beschleunigte er den Schritt: Er hatte den Apfel entdeckt!
Es war ein besonderer Apfel, ein Prachtexemplar, rotbäckig und von der Größe eines Kinderkopfes. Er hing an einem Baum, der diesseits vor dem Zaun mutterseelenallein am Straßenrand stand, hoch, krumm und im übrigen völlig abgeerntet. Jürgen, als sie den Baum erreicht hatten, starrte einen Augenblick lang mit einem Gefühl von Erstaunen und Bewunderung zu der verlockenden Frucht hinauf. Er hielt die Großmutter, die weitergehen wollte, am Rock fest. „Hast du den Apfel nicht gesehen?“, rief er und fügte mit der ganzen Überzeugtheit seiner zehn Jahre hinzu: „Den hol ich runter!“ Es schien ihm die einfachste Sache der Welt.
Die Großmutter ließ sich ungern auf eine Unterbrechung ein; man war, wie erwähnt, lange unterwegs, und es zog sie mit Macht in ihre Küche. Die Arbeit wartete – Jürgens Mutter, tüchtig in ihrem Beruf als Näherin in der Kreisstadt, überließ ihr zu großen Teilen den Haushalt. Die Mama schaffte es nicht anders, zumal noch ein zweiter Sohn da war, Jürgens zwölfjähriger Bruder Peter, und sie sich um die beiden Jungs kümmern musste, die schneller aus den Sachen wuchsen als das Getreide aus der Erde. Ohne Mann hatte sie es eben schwer. Zum Glück bin ja ich noch da und einigermaßen flott auf den Beinen, dachte die Oma.
„Der Apfel da oben, hast du ihn nicht gesehen?“, wiederholte Jürgen und streckte den Zeigefinger aus. Die Oma hatte doch sonst genau im Blick, was von Interesse war.
„Du brauchst nicht so zu schreien, jetzt seh ich ihn ja. War in Gedanken.“ Die alte Frau konnte nicht umhin, zuzugeben, dass die Sache einer näheren Betrachtung wert war. Wirklich ein schöner Apfel, so was ließ man nicht verkommen. Erst recht nicht in diesen Zeiten. Aber sie begriff auch sofort die Schwierigkeiten, ihn herunterzuholen.
Sie trat näher, stützte sich auf ihren Wanderstock und prüfte die Lage: „Wie willst du da heran?“
„Wir schütteln einfach den Baum“, sagte Jürgen. „Der Apfel ist richtig reif. Ich wunder mich, dass er nicht längst runtergefallen ist.“ Und er begann, an einem tiefer hängenden Ast zu zerren.
Die Großmutter packte ihn am Arm. „Siehst du denn nicht, dass er in den Garten fällt, wenn du den Baum schüttelst? Wie willst du dann da reinkommen?“
Jürgen hielt inne. Das wusste er auch nicht. Der Zaun war hoch und kaum zu überklettern, eher zerriss man sich die Hose. Der Apfel jedoch hing an der äußersten Spitze eines Astes, der über den Zaun hinweg reichte. Das war gewiss auch der Grund, weshalb ihn noch niemand von den Leuten, die hier vorbeikamen, heruntergeholt hatte. Die drinnen wohnten wohl in dem Haus weiter hinten und hatten ihn zwischen dem Laub einfach übersehen.
„Trotzdem krieg ich ihn. Ich kletter‘ auf den Baum und pflück ihn. Das klappt bestimmt.“
Die Oma hielt ihn erneut zurück. „Bleib hier, das wird nichts. Der Apfel hängt viel zu weit draußen, mit der Hand kommst du da nicht ran. Du machst dir bloß das Hemd schmutzig und fliegst womöglich noch runter. Dann haben wir die Bescherung.“
Jürgen fing an zu maulen. „Den ganzen Tag unterwegs und nur die dämliche Kohlsuppe bei dem Bauern. Die Birnen hast du ja nicht genommen. So ‘ne Birne, die hätt mir geschmeckt.“
Die Großmutter schüttelte den Kopf. „Red nicht solchen Unsinn. Für die Birnen wollten sie das Bettlaken, und dann hätten wir das Korn nicht gekriegt. Ich hab ja gehofft, dass dir die Frau eine Birne schenkt. Aber das war eine, die dir nicht das Weiße vom Ei gönnt. Jedenfalls ist das Korn wichtiger.“
„Das blöde Korn. Die Mehlsuppe mit Süßstoff schmeckt mir sowieso nicht.“
Nun wurde die Großmutter ärgerlich. „Willst du dich nicht versündigen?“, sagte sie und hob den Stock. „Sei froh, dass du Korn zu essen kriegst. Hast wohl vergessen, dass wir manchmal bloß Kartoffelschalen und Marmelade hatten. Ja, wenn’s noch richtige Marmelade gewesen wäre.“
Jürgen war einen Schritt zurückgewichen, außer Reichweite des Stocks, aber er war keineswegs zum Nachgeben bereit. Im Gegenteil, er schrie böse: „Auf jeden Fall hol ich mir den Apfel, den Apfel hol ich mir!“
Die Oma überlegte. Ihr Zorn war verraucht, der Junge tat ihr leid. Er ist ja nicht schuld, dass die Zeiten so sind, dachte sie. Weiter führte sie diesen Gedanken nicht – ihr Sinn richtete sich wieder aufs Praktische. In der Tat, ein seltenes Exemplar war das da oben, so richtig geschaffen, die Zähne hineinzuschlagen. Eine Leiter hätte man gebraucht. Wenn man nur eine Möglichkeit fände, an ihn heranzukommen.
Der Junge setzte bereits zur Kletterpartie an, er hatte das Hemd ausgezogen, nun umfasste er den Stamm mit seinen dünnen nackten Armen. „Warte“, sagte die Großmutter, „ich weiß jetzt, wie wir’s machen.“
Jürgen ließ von dem Baum ab und drehte sich um. Die Oma legte das Säckchen mit dem Korn aus der Hand, lehnte es so an den Zaun, dass nichts herausfallen konnte, und setzte sich dann ächzend – das Hinsetzen und Aufstehen fiel ihr am schwersten – an den Straßenrand. In ihrem dunkelblauen Rock und der bräunlichen Bluse passte sie gut in die Herbstlandschaft.
„Ja, so könnte es gehen“, sagte sie, nahm ihren Wanderstock quer über den Schoß und zog ein großes sauberes Sacktuch aus der Rocktasche. Es war eine Eigenheit von ihr, stets zwei große Taschentücher mitzuführen, eins, das sie benutzte, und eins als Ersatz. Sie hatte überall Taschen in ihre Röcke eingenäht, in denen sie alles Mögliche unterbringen könnte.
Die Oma faltete das Tuch auseinander und verknotete alle vier Zipfel am gebogenen Stockgriff, so dass es wie eine kleine Hängematte darunter hing. „Gut“, sagte sie befriedigt, nachdem sie die Festigkeit des so entstandenen Keschers geprüft hatte, „damit wirst du an den Apfel herankommen. Nun versuch dein Glück. Dass du mir aber ja nicht runterpurzelst!“
Jürgen nahm den Stock in die Hand, doch er hatte noch nicht recht begriffen, wie die Sache funktionieren sollte. Unschlüssig fuchtelte er mit dem Krückstock herum. Die Großmutter stand wieder auf, indem sie sich am Zaun hochzog. „Du musst mit dem Tuch so an den Apfel herangehen, dass er hineinrutscht“, erklärte sie. „Dann drehst du ein bisschen und reißt ihn ab. Er kann nicht runtersausen, ist gewissermaßen gefangen.“ Sie machte es vor, indem sie die Faust zwischen Tuch und Stock schob.
Nun war bei dem Jungen der Groschen gefallen. Er klomm wie in der Turnhalle an der Kletterstange den Stamm hinauf, vorsichtig, damit der Baum nicht in Bewegung geriet. Er tat das äußerst geschickt: Klettern war seine Stärke. Als er den ersten dicken Ast erreicht hatte, zog er sich hoch, stellte sich darauf und hielt inne. Er betrachtete die Welt von oben. „Oma, da hinter dem Hügel seh ich die Kirchturmspitze von Bärenbach.“
Die Großmutter aber war ungeduldig. Sie reichte ihm den Stock hoch. „Guck jetzt nicht in der Weltgeschichte rum, sondern beeil dich. Wir wollen heute noch nach Hause.“
Jürgen packte den Stock und stieg zwei Äste höher. Nun begann der schwierige Teil. Ganz draußen, zwischen gelblichem Restlaub, hing der begehrte Apfel. Der Junge setzte sich auf den Ast wie früher aufs Schaukelpferd und begann vorzurutschen. Mit den Füßen und der linken Hand versuchte er sich unten bzw. an den seitlichen Zweigen festzuhalten, rechts umklammerte er wie eine Lanze das Ende des Stocks.
Für einige Sekunden herrschte angespannte Stille, lediglich in der Ferne läutete eine Kirchenglocke. „Fall bloß nicht runter“, wiederholte die Großmutter, doch das war eine überflüssige Bemerkung, denn Jürgen ging so umsichtig zu Werke, als wollte er einen entflogenen Kanarienvogel einfangen. Aber er konnte, auch als er schon sehr weit vorgerückt war, den Apfel noch immer nicht erreichen. Dabei hatte er den Stock ganz hinten am äußersten Ende gepackt.
Er legte sich auf den Bauch. Der Ast zitterte, und der Apfel begann zu tanzen. Gleich wird er fallen, dachte die Großmutter, aber der Apfel blieb, wo er war.
Jürgen rutschte Zentimeter um Zentimeter auf dem Ast vor, die Beine um das armstarke Holz geklammert, ein Akrobat. Plötzlich knackte es im Geäst, knackte laut, und diesmal kriegte die Oma einen Schreck. „Nicht weiter“, rief sie, „der Ast bricht ab, es funktioniert nicht, komm zurück!“
„Ach was, der Ast hält mich zweimal“, sagte Jürgen großspurig. Um keinen Preis der Welt würde er sein Unterfangen jetzt aufgeben.
Die Oma seufzte. Wohin war man bloß gekommen, dass man wegen eines einzigen Apfels riskierte, sich das Genick zu brechen. Der Krieg, dachte sie, der verdammte Krieg, er hat alles kaputtgemacht. Doch wie auch immer, wenn dem Jungen etwas passierte, trug sie die Schuld. Sie würde ihrer Tochter nicht in die Augen schauen können. Ich dumme Gans, ging es ihr durch den Kopf, wie konnte ich mich bloß darauf einlassen. „Nein, es geht nicht, komm zurück“, schrie sie.
Jürgen jedoch, als wäre er taub, rutschte schnell noch ein Stückchen vor, und nun konnte er den Apfel tatsächlich erreichen. Geschickt ließ er ihn in das Tuch am Griff des Stockes gleiten, drehte, wie die Großmutter es ihm gezeigt hatte, das Gerät ein wenig und riss das Obst mit einem Ruck ab. Aber da krachte es diesmal so heftig im Geäst, dass auch ihm himmelangst wurde.
„Vorsicht, der Ast bricht ab“, schrie die Großmutter, „halt dich fest!“ Sie sah den Jungen schon heruntersausen, mit dem Kopf vorneweg.
In der Tat war Jürgen durch die eigene ruckartige Bewegung, das Knacken des Astes und das Schwingen des ganzen Baumes für einen Augenblick aus dem Gleichgewicht gekommen, und obwohl der Ast nicht brach und er selbst einen Absturz vermeiden konnte, weil er sich mit Händen und Füßen ans Gezweig klammerte, war ihm richtig schlecht. Vergeblich versuchte er den Stock festzuhalten, der sich nun selbständig machte. Durch den Apfel im Tuch vorn beschwert, sauste er wie eine Rakete nach unten. Nicht weit, er prallte auf den Zaunspitzen auf, drehte sich und flog der Großmutter direkt vor die Füße. Im Gegensatz zu dem Apfel, der unterwegs aus dem Tuch herausgefallen und nach der anderen Seite gesprungen war. Er lag nun rund und rotbäckig jenseits des Zauns im Gras.
„Miststück“, schrie Jürgen dem Apfel hinterher und drohte ihm wütend mit der Faust.
Die Großmutter hob verblüfft den Stock auf; sie war froh, dass dem Enkel nichts passiert war. Der Junge kroch, am ganzen Körper zerschunden, vom Baum.
In diesem Augenblick, noch ehe sich die beiden ganz von ihrem Schrecken erholt hatten und Jürgen den Schmutz vom Körper putzen konnte, kam, durch den Lärm angelockt, völlig unerwartet ein Schaf hinter der Scheune hervor und näherte sich dem Zaun. Der Apfel lag nicht weit davon entfernt – aber immerhin zu weit, als dass man ihn hätte mit dem Stock herüberholen können. Man hätte Zeit gebraucht, etwas Neues zu ersinnen.
Jürgen hatte die Gefahr zuerst erkannt. „Das Schaf“, brüllte er, „vertreib das Schaf, Oma!“ Und er begann nach Steinen zu suchen und drohend mit den Fäusten herumzufuchteln.
Das Schaf war inzwischen schon ganz nahe, und da der Apfel so groß war, hatte es keine Mühe, ihn zu entdecken. Vergeblich steckte die Großmutter den Stock durch den Zaun und schrie: „Weg da, du Mistvieh, das ist unser Apfel, untersteh dich!“
Zunächst sprang das Schaf zwar erschrocken zur Seite und beschwerte sich mit einem unwilligen „Mä-äh“ über die ungerechte Behandlung. Doch dann merkte es wohl, dass ihm nichts Ernsthaftes passieren konnte, weil der Stock zu kurz war. Die Fressgier siegte über die Angst. Das Geschrei der beiden missachtend, machte es sich genüsslich über den Apfel her.
Da hatten sie nun ihre Zeit drangesetzt, sich abgeplagt und etwas einfallen lassen, aber alle Mühen war vergebens gewesen. Zu spät gelang es Jürgen, einen großen Stein am Wegrand zu finden, den er dem Schaf in den dichten Pelz schmettern konnte – der Apfel war bereits unter lautem Schnurpsen zwischen den Zähnen des Tieres verschwunden.
„Dreckstück, elendes, verfressenes Aas“, brüllte Jürgen rot vor Wut und trommelte mit der Faust gegen den Zaun, „gibt’s denn nicht genug Gras für dich, musst du dir ausgerechnet unseren Apfel schnappen?“ Am liebsten wäre er über den Zaun geklettert, um das Tier mit den Fäusten zu traktieren.
Die Oma hatte sich wieder gefasst. Während das Schaf, beunruhigt durch den Lärm des Jungen und ohne Aussicht auf weitere Genüsse, langsam und halbwegs zufrieden davontrottete, klopfte sie ihren Rock ab, an dem ein paar Grashalme klebten, knüpfte das Tuch vom Stock und legte es zusammen, griff nach dem Beutel mit dem Korn. „Hör schon auf, hat ja doch keinen Zweck mehr“, murmelte sie. „Zieh dein Hemd an, wisch dir die Tränen aus den Augen und komm, wir haben eine Menge Zeit verplempert.“
Die Landstraße war gerade wie eine straff gespannte Schnur und schien nicht enden zu wollen. Die Großmutter und ihr Enkel marschierten schweigend nebeneinander her, ab und zu wischte sich der Junge noch eine Träne aus den Augen. Als sie die Hügel am Ortsrand fast erreicht hatten, kam ein dreirädriges klappriges Auto hinter ihnen her, hielt auf ihrer Höhe. Der Fahrer kannte sie, er war aus ihrem Städtchen. „Na, Erfolg gehabt?“, fragte er, als die Großmutter neben ihm saß und er den Beutel mit dem Korn sah.
„Na ja“, erwiderte sie, „ein Laken. Mehr war dafür nicht rauszuholen.“
Die Karre ruckelte dahin. Jürgen beruhigte sich langsam. Er war hinten auf die Plattform geklettert, lag auf einem Haufen alter Säcke und schaute in die Ferne. Dann, zögerlich, fing es an, dunkel zu werden und sein Blick glitt zum Horizont, wo langsam, wie ein großer roter Apfel, die Sonne unterging.
Die Katze
Keil trat aus dem Wald auf die felsige Freifläche hinaus, und die Hitze schlug wie eine Axt auf ihn ein. Anfang Mai erst, aber der fünfte heiße Tag hintereinander; die Luft flirrte, der wolkenlose Himmel hatte jeglichen Windhauch verschluckt, die weißglühende Sonne warf ihre Strahlenbündel mit ungeheurer Wucht zur Erde. Schon morgens schwitzte man, und jetzt ging es auf Mittag. Doch was half’s, die fehlenden Kilometer mussten noch zurückgelegt, unter die Schuhsohlen aus doppelt übereinander genageltem Koppelleder genommen werden.
Der steinige Untergrund speicherte die Wärme, ließ zugleich die Sonnenstrahlen zurückprallen. Keil, die Hand als Schirm über die Augen haltend, starrte in die Ferne, wo sich Häuser und, durch die gleißende Luft verzerrt, ein Kirchturm abhoben. Die Spitze war von einer Granate abrasiert worden, hier in der Gegend hatten schwere Kämpfe stattgefunden. Auf jeden Fall befand sich da drüben die Straße, und es gab vielleicht die Chance, von einem Fuhrwerk mitgenommen zu werden. Ein paar tausend Meter mochten es bis dorthin sein. Der Mann machte sich auf den Weg.
Das Gelände zog sich in leichten Bodenwellen hin. Sand, Steine und mageres, in ein bräunliches Grün gehülltes Buschwerk. Heidekraut dazwischen, hartes, sperriges Gras, das unterm Fuß seufzte. Links am Horizont verschwammen fast schwarz die Forsthänge, rechts hing, kantig und durch weißblauen Dunst wie vom Boden abgeschnitten, ein dreihöckriger Felsgrat. Aber Keil schenkte ihm keine Beachtung. Die Kämme dieses Mittelgebirges interessierten ihn nicht, sein Ziel lag in der Ebene, in der Stadt.
Er kam von B., einem kleinen Ort hinter den Wäldern, wo er sich einige Monate lang verkrochen hatte. Bei Kosiče in der Tschechoslowakei hatte er seine zusammengeschrumpfte Kompanie im Februar 1945 verlassen, oder genauer gesagt: Er war bei einem Angriff der Gegenseite abgesprengt worden und nicht mehr zurückgekehrt.
Beschissener Krieg, verlorener Krieg, Keil hatte ihn satt gehabt und die Gelegenheit genutzt, sich zu verdrücken. Mit bibberndem Herzen – natürlich hatte er Angst, geschnappt, von einer Militärstreife aufgegriffen und an den nächsten kräftigen Buchenast geknüpft zu werden. Kein schönes Gefühl, wenn man an den grünen, frühlingsbelaubten Bäumen hochsah, in denen fröhlich die Finken hin und her schwirrten, und sich vorstellte, dass …
Aber der Gedanke, dass einem der mehrfach gezackte Splitter einer Granate die Brust zerfetzte und die Lunge zerriss, war keineswegs verlockender gewesen. Und dieser Gedanke hatte sich dem Soldaten zuletzt, seit der Januaroffensive der Russen, immer heftiger aufgedrängt. „Du hast eine blöde Fantasie, Mensch“, hatte Paul Heller, der Kumpel, gezischt, wenn Keil davon anfing. Bis es ihn, Paul, dann selber erwischt hatte. So schlimm wie der zugerichtet war – mit aller Phantasie hätte man sich das nicht ausmalen können. Für Keil jedenfalls war es ein letztes dringliches Achtungszeichen gewesen.