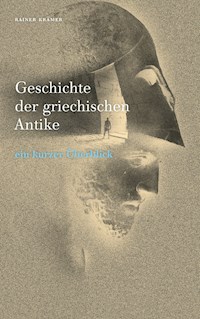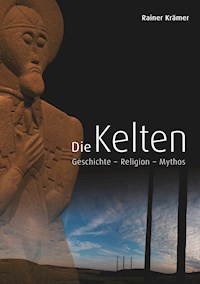
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Über kaum ein anderes antikes Volk wird soviel spekuliert wie über die Kelten. Sogar Hollywood hat sich ihrer angenommen. Immer wieder überraschen Funde aus archäologischen Grabungen selbst Fachwissenschaftler. Viele Facetten der keltischen Kultur geben immer noch Rätsel auf. Was schreiben die römischen und griechischen Autoren über die Kelten? Was weiß man über ihre religiösen Bräuche? Das vorliegende Buch will ein wenig Licht in dieses Dunkel bringen und nimmt den Leser mit auf eine spannende Reise durch das vorgeschichtliche Europa. Neue lektorierte Auflage mit 11 Abbildungen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 101
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Die Kelten – Eine Einführung
Von den Anfängen bis zur römischen Besetzung
Sprache und Schrift
Stammesverbände
Handwerk und Handel
Die Grabhügel der „Fürsten“
Viereckschanzen
Die Moorleiche aus dem Lindow Moss
Die Druiden
Kopfjagd und Menschenopfer
Das Gold der Kelten
Das Rätsel um Menosgada
Keltische Sagen und Legenden – König Artus
Die Kelten einst und heute
Anhang
Archäologische Methoden
Die Kelten in griechischen und römischen Schriften
Literatur und Quellen
Abbildungsnachweis
Die Kelten – Eine Einführung
Abb. 1: White Horse of Uffington
Die Kelten - schon allein der Name dieses Volkes beschwört die unterschiedlichsten Vorstellungen herauf. Historiker, Archäologen, Sprachforscher, Schriftsteller und nicht zuletzt Esoteriker tummeln sich auf diesem Gebiet. Doch was weiß man wirklich über dieses Volk? Etwas spröde klingt da die Definition nach der modernen Forschung: demnach bildet vor allem die gemeinsame Sprachfamilie die Grundlage für die Zuordnung zu dem Begriff "Kelten". Die Geschichte dieses alteuropäischen Volkes reicht weit zurück. Seine Spuren lassen sich bis ins 6. Jahrhundert v. Chr. zurückverfolgen. Von der iberischen Halbinsel im Westen bis Kleinasien im Süd-Osten erstreckte sich der keltische Einflussbereich. Die Nord-Süd Ausdehnung der Siedlungsgebiete reichte von den Britischen Inseln bis nach Norditalien. Politisch in viele Einzelstämme zersplittert hatten sie aber auf Dauer auswärtigen Feinden nur wenig entgegenzusetzen. In Irland bewahrten sich die keltischen Stämme am längsten ihre Unabhängigkeit, auf dem Kontinent wurden sie kurz vor Christi Geburt zwischen Römern aus dem Süden und Germanen aus dem Norden aufgerieben. In den römischen Provinzen Galliens und Raetiens ist das Fortleben keltischer Kultur noch eine Weile belegt in Form von Götterkulten und keltischen Namen, die z. B. in Entlassungsurkunden der römischen Armee auftauchen. Im Kleinasiatischen Galatien wurde die keltische Sprache noch bis ins 4. Jh. n. Chr. gesprochen. Die Wirren der Völkerwanderung im 5. und 6. Jh. n. Chr. wischte aber auch diese letzten Spuren fort, so dass die keltischen Traditionen nur noch in Britannien und Irland weiterleben konnten. Aber auch die Inseln boten keinen ausreichenden Schutz vor fremden Invasoren. Um 400 n. Chr. verließen die Römer endgültig Britannien und die keltische Bevölkerung wurde von den kurz darauf nachrückenden Angeln und Sachsen nach Cornwall, Wales und Schottland verdrängt.
Das wiedererwachte Interesse für die Antike in der Renaissance brachte auch die Kelten wieder in das Bewusstsein zurück, wenn sich zunächst auch nur Gelehrte mit den antiken Berichten über dieses Volk auseinandersetzten. Im 18. Jh. begann eine wahre "Keltomanie", eine seltsame Kombination aus ernstzunehmender Forschung, Patriotismus und Romantik, die oft skurrile Blüten trieb. So ist in Frankreich der Keltenfürst Vercingetorix, der von Caesar bei Alesia vernichtend geschlagen wurde, ein Nationalheld ersten Ranges. Dass der Ort der Niederlage bis ins vorletzte Jahrhundert unentdeckt blieb, ist vielleicht sogar eine glückliche Fügung. So mancher besonders auffällige Grabhügel hat schon früh das Interesse lichtscheuer Zeitgenossen geweckt, und besonders wertvolle Fundstücke fanden bereits in der Renaissance ihren Weg in gut sortierte Sammlungen.
Erste ernstzunehmende archäologische Grabungen begannen erst in der zweiten Hälfte des 19. Jh.. Zwei reiche Fundstätten markierten den Beginn der archäologischen Keltenforschung: eine Pfahlbausiedlung am Ufer des Neuenburger See in der Schweiz, nach der Fundstelle La Tène (Untiefe) genannt und ein Gräberfeld bei Hallstatt im Salzkammergut in Österreich. Sehr bald erkannte man, dass die Funde aus Hallstatt älter waren als die von La Tène. Seitdem spricht man von der sog. "Hallstattzeit", auf der die "Latènezeit" folgt. Forscher der ersten Stunde waren z. B. Otto Tischler und der schwedische Reichsantiquar Hans Hildebrand.
Heute wird der Beginn der "Hallstattzeit" mit dem 8. Jh. v. Chr. angesetzt und die darauf folgende Latènezeit mit der zweiten Hälfte des 5. Jh. v. Chr. bis etwa 50 v. Chr. In der Zeitepoche vom 8. bis zum 6. Jh. v. Chr., vor der ersten schriftlichen Erwähnung der Kelten durch die Griechen, ist man ausschließlich auf die Ergebnisse der archäologischen Forschungen angewiesen. Sehr aufschlussreich können z. B. die vorherrschenden Bestattungssitten sein. So ist ab dem 8. Jh. v. Chr. die Sitte zu beobachten, Angehörige der Oberschicht in einer hölzernen Kammer unter einem Erdhügel zu begraben. In manchen Gegenden Süddeutschlands, wie z. B. der Fränkischen oder der Schwäbischen Alb, sind diese Hügel noch heute zu finden, wenn man sich nur genau genug umsieht. Die Grabkammern wurden oft mit vielen Beigaben gefüllt, wie Trinkgeschirr, Waffen oder Schmuck. Gegen Ende der Hallstattzeit erreicht diese Bestattungskultur ihren Höhepunkt in den sog. "Fürstengräbern", monumentale Hügel mit prunkvoll ausgestatteten Grabkammern, wie etwa im Gebiet um die Heuneburg an der oberen Donau und beim Hohenasperg in der Gegend des mittleren Neckar. Diese "Fürsten" residierten in befestigten "Höhensiedlungen", die eine Größe von mehreren Hektar erreichen konnten. Ihr Herrschaftsgebiet erstreckte sich weit ins Umland hinein. Die bekannteste Siedlung dieser Art ist wohl die bereits erwähnte Heuneburg. Funde dokumentieren Kontakte zu Etrurien in Mittelitalien, Griechenland und sogar Phönizien im heutigen Libanon.
Der Beginn der Latènezeit in der zweiten Hälfte des 5. Jh. v. Chr. markiert einen tiefen Einschnitt in diese Entwicklung. Die Höhensiedlungen werden aufgegeben, neue Grabhügel werden kaum noch angelegt. Vielmehr werden die bereits bestehenden Hügel genutzt, die genügend Raum für weitere Bestattungen bieten, sog. Nachbestattungen. Es deutet vieles darauf hin, dass in gesellschaftlichen Umwälzungen der Grund für diese Phänomene zu suchen ist. Mit der Latènezeit gelangt die keltische Kultur erst zur vollen Blüte. Die in der Hallstattzeit eher geometrischen Verzierungsmuster auf Keramikgefäßen und Bronzeschmuck wandeln sich radikal. Während vorher die Darstellung von Mensch und Tier eher skizzenhaft geschah, so strahlen sie jetzt eine Lebendigkeit aus, die einen scharfen Kontrast zur Hallstattzeit bildet. Da die Kunst in den frühen Gesellschaftsformen meist untrennbar mit den jeweiligen religiösen Vorstellungen verbunden ist, so ist zu vermuten, dass auch hier eine Veränderung stattfand. Der Wandel in den Bestattungssitten wurde bereits genannt, neben den erwähnten Nachbestattungen treten immer mehr Flachgräberfelder und später auch Brandbestattungen in den Vordergrund. Seit Mitte des zweiten Jh. v. Chr. entwickelten sich zentrale befestigte Siedlungen von zuvor nicht gekannter Größe - die sog. Oppida. In diese Zeit fallen auch die rätselhaften Viereckschanzen, rechteckige Anlagen mit Wall und Graben, die in Süddeutschland besonders zahlreich auftreten.
Doch wie sah die keltische Gesellschaft aus? Hier kann die Archäologie nur ansatzweise weiterhelfen. Caesar berichtet in seinem Werk „Der Gallische Krieg“, dass die Stämme Galliens von einer einflussreichen Aristokratie beherrscht waren, die eine dünne Schicht an der Spitze der Stammesgesellschaft bildeten. Der jeweilige Stammesfürst kam in der Regel aus diesem exklusiven Kreis. Einige der gallischen Stammesführer führten laut Caesar sogar den Titel "rex", also König. Doch diese "Könige" hatten meist nur begrenzten Einfluss auf die Entscheidungen innerhalb des Stammes.
Abb. 2: Statue eines gallischen Kriegers, Vachères
Machtkämpfe waren, wie man sich denken kann, nicht selten. Aristokraten mit einer besonders umfangreichen Gefolgschaft konnten sich zuweilen über Beschlüsse der Stammesversammlungen hinwegsetzen. Um ihren Einfluss zu sichern, wurde von manchen Familien eine umfangreiche Heiratspolitik betrieben, auch über die Stammesgrenzen hinweg. Zu diesen Familien gehörte eine oft große Zahl von Abhängigen. Die Clans von Schottland könnte man als eine Art Überbleibsel dieser altkeltischen Strukturen bezeichnen.
Der zweite Stand wurde nach Caesar von den Rittern gebildet. Sie hatten im Kriegsfall eine gewisse Anzahl von Gefolgsleuten um sich, die mit in die Schlacht zogen. Mit dem Begriff „Ritter“ meinte Caesar berittene Krieger, die auch von den Römern gefürchtet waren. Dass Krieger, ob sie nun beritten waren oder nicht, eine herausragende Rolle in der keltischen Gesellschaft spielten, zeigen vor allem Funde aus Bestattungen. Die Waffen wurden als Statussymbol den Toten mit ins Grab gegeben. So sind in der frühen Hallstattzeit in Männergräbern das Schwert, im 6. und 5. Jh. v. Chr. besonders häufig Lanzen mit eiserner Spitze und Dolche aus Eisen oder Bronze zu finden. Im 3. Jh. v. Chr. bestehen die Beigaben vor allem aus Schwert, Lanze und Schild. Allerdings ist der Nachweis solcher Bewaffnung sehr von den Erhaltungsbedingungen abhängig. Beispielsweise kann ein Schild auch vollständig aus vergänglichem Material gefertigt worden sein - der Archäologe würde dann nur die Waffen aus Metall vorfinden. Eine der wenigen naturgetreuen Abbildungen eines keltischen Kriegers ist eine Statue von Vachères in Frankreich aus dem späten 1. Jh. v. Chr., die einen Krieger in Kettenhemd zeigt. Allerdings dürfte diese von den Römern übernommene Schutzbekleidung nur den Vornehmeren Kelten vorbehalten gewesen sein.
Von allen keltischen Gesellschaftsgruppen üben sicherlich die Druiden die größte Faszination aus. Sie bildeten eine Art Orden mit einer klaren Hierarchie - neben religiösen Aufgaben waren sie auch für die Schlichtung von Streitfällen zuständig. Diese richterliche Funktion sicherte ihnen auch einen gewissen politischen Einfluss. Ein Druide zu werden war nicht einfach, der Nachwuchs hatte bis zu 20 Jahre Lehrzeit vor sich. Das schriftliche Fixieren der Lehre war streng verboten. Sicherlich sind die Druiden keine Priester nach unserem heutigen Verständnis gewesen, sondern bewahrten vor allem für die Traditionen Dieser Gruppe sind im weitesten Sinne auch die Barden zuzuordnen, fahrende Sänger und Dichter. Neben Handwerkern und Händlern wurde die unterste Schicht von Kleinbauern gebildet. Letztere waren in ein komplexes System von Abhängigkeiten eingebunden. Die sog. Schuldknechtschaft war offenbar keine Seltenheit, d. h. jemand musste sich aufgrund von finanzieller Not in die Abhängigkeit von einem Adligen begeben. Für einen solchen armen Schlucker bedeutete dies z. B. Gefolgschaft in Kriegszeiten und ähnlich undankbare Verpflichtungen.
Über den Status der Frau in der keltischen Gesellschaft liegen nur sehr wenige Informationen vor. Eine der wenigen Äußerungen ist wieder bei Caesar zu finden. Demnach hätten Männer den Frauen und Kindern gegenüber die Gewalt über Leben und Tod gehabt. Er schreibt aber auch, dass das von beiden in die Ehe eingebrachte Vermögen gemeinsam verwaltet wurde. Bei Streitfragen wurden Frauen oft als Schlichter hinzugezogen. Dass sie durchaus auch gesellschaftlich angesehene Positionen erreichen konnten, zeigen besonders reich ausgestattete Begräbnisse, wie z. B. die sog. Dame von Vix, ein Grab aus dem Jahr 480 v. Chr. Neben kostbarem Schmuck wurde ihr ein auffallend großes bronzenes Mischgefäß für Wein mitgegeben, eine Sonderanfertigung aus griechischen Werkstätten. Mit diesen Kontakten zum Mittelmeerraum Anfang des 5. Jh. v. Chr. beginnt aber eigentlich erst die Geschichte der Kelten, wie wir sie kennen ...
Von den Anfängen bis zur römischen Besatzung
Der Ursprung der Kelten liegt weitgehend im Dunkel der Vorgeschichte. Es gilt allerdings als sicher, dass Keltisch sprechende Völkerschaften bereits in der Bronzezeit (2300 – 800 v. Chr.) existiert haben. Da sie selbst leider keine Chroniken hinterließen beginnt ihre Geschichte aus unserer Sicht erst, als sie ins Blickfeld der antiken Völker am Mittelmeer rücken. Immerhin scheint bereits der griechische Historiker Herodot (484 - ca. 430 v. Chr.) das Siedlungsgebiet der Kelten zu kennen: „Die Donau entspringt im Land der Kelten nahe der Stadt Pyrene und durchquert Europa, das sie in der Mitte durchtrennt.“ Unter den Archäologen ist es ziemlich umstritten, ab wann und vor allen Dingen wo man zum ersten Mal von keltischen Volksstämmen sprechen kann. So sehen manche bereits die vorgeschichtlichen Kulturen der sog. Urnenfelderzeit im südlichen Mitteleuropa, etwa ab 1200 v. Chr., als frühe Kelten an, doch die Mehrheit erkennt die Herausbildung der keltischen Kultur erst in der „Hallstattzeit“, also in der Zeit vom 8. bis zum 5. Jh. v. Chr.
Zu Lebzeiten von Herodot lag das keltische Kernland zwischen dem heutigen Burgund und Böhmen. Von diesem Gebiet aus drängten ab dem 4. Jh. immer mehr keltische Scharen in angrenzende Länder. Mit dem Mittelmeerraum bestanden bereits vor diesen Wanderbewegungen weit reichende Handelskontakte. Besonders Wein war beliebt, der als Import aus griechischen Kolonien die Rhône entlang seinen Weg nach Mitteleuropa fand. Filigrane Metallarbeiten belegen, dass die Künstler Anregungen aus dem Süden erfuhren. Geometrische Muster wurden von vielgestaltigen pflanzlichen und tierischen Motiven abgelöst.