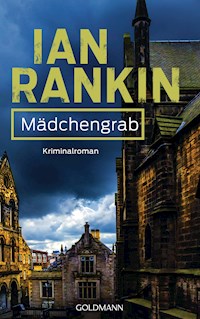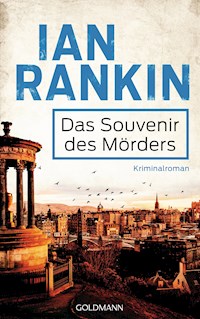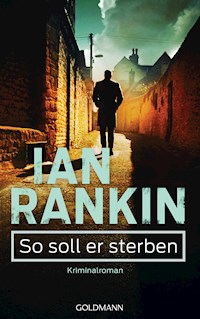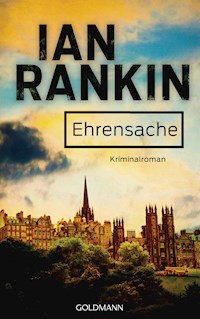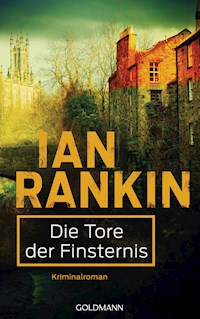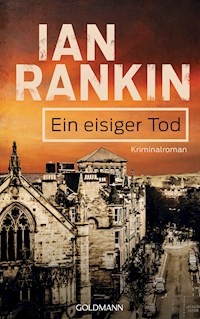9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Manhattan
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ein Inspector-Rebus-Roman
- Sprache: Deutsch
Ein blutiger Amoklauf in der örtlichen Schule erschüttert das Küstenstädtchen South Queensferry. Die Suche nach den Hintergründen der Tat führt Inspector Rebus in das Herz einer kleinen Gemeinschaft und ihrer verlorenen Kinder – und in seine eigene Vergangenheit beim Special Air Service. Denn bei dem Schützen handelt es sich um den früheren Elitesoldaten Lee Herdman. Was hat ihn zu seiner schrecklichen Tat getrieben? Je näher Rebus der Wahrheit kommt, desto dunkler wird der Abgrund, der sich vor ihm auftut …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 741
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Buch
In dem beschaulichen Küstenstädtchen South Queensferry erschüttert ein Blutbad die Öffentlichkeit: In einer Schule hat der ehemalige Elitesoldat Lee Herdman zwei Jungen erschossen, einen schwer verletzt und anschließend sich selbst getötet. Es gibt eigentlich nur eine offene Frage: warum? Die Suche nach der Antwort führt John Rebus und seine Kollegin Siobhan Clarke in das Herz einer kleinen Gemeinschaft und ihrer verlorenen Kinder. Eine zweite Spur reicht weiter in die Vergangenheit des Täters, dessen Schicksal Rebus nicht mehr loslässt. Selbst ehemaliges Mitglied der Special Air Forces, versucht er, sich in die Psyche Herdmans zu versetzen, um dessen Tat zu begreifen. Und damit ist er nicht allein: Ermittler der Royal Army schalten sich in den Fall ein, angeblich, um ähnliche Taten in Zukunft zu verhindern. Doch dann zeigt sich, dass ein paar ehemalige Kollegen Herdmans sowie eine Hand voll Jugendlicher aus Queensferry tiefer in den Fall verstrickt sind, als zunächst vermutet. Und die Frage nach den Hintergründen eines vermeintlichen Amoklaufs verwandelt sich in ein komplexes Rätsel, dessen Lösung so überraschend wie schockierend ist …
Mehr Informationen zum Autor und seinen Büchern
unter: www.ianrankin.net
Inhaltsverzeichnis
In Memoriam – dem CID von St. Leonard’s
Ita res accendent lumina rebus
Anonymus
Es gibt keine Aussicht auf ein Ende
James Hutton,
Naturwissenschaftler, 1785
Erster Tag
Dienstag
1
»Völlig klare Sache«, sagte Detective Sergeant Siobhan Clarke. »Herdman ist schlicht und einfach ausgerastet.«
Sie saß neben einem Krankenhausbett in Edinburghs erst kürzlich eröffneter New Royal Infirmary. Der Gebäudekomplex befand sich am Südrand der Stadt, in einer Gegend namens Little France. Er war für eine beträchtliche Summe auf einer Wiese errichtet worden, doch es gab bereits Klagen über die schlechte Raumaufteilung im Inneren und den Parkplatzmangel draußen. Siobhan hatte nach einer Weile eine Lücke für ihr Auto gefunden, nur um danach festzustellen, dass sie für dieses Glück würde bezahlen müssen.
Das hatte sie Detective Inspector John Rebus erzählt, nachdem sie sich an sein Bett gesetzt hatte. Rebus’ Hände waren komplett verbunden. Als Siobhan ihm etwas lauwarmes Wasser eingeschenkt hatte, hatte er den Plastikbecher mit beiden Händen zum Mund geführt und vorsichtig getrunken, während sie ihn dabei beobachtete.
»Sehen Sie?«, hatte er anschließend vorwurfsvoll gesagt. »Keinen Tropfen verschüttet.«
Aber dann hatte er die Vorführung vermasselt, indem er den Becher bei dem Versuch fallen ließ, ihn auf dem Nachttisch abzustellen. Der Becher landete mit der Unterkante auf dem Boden, prallte ab, und Siobhan schnappte ihn sich noch in der Luft.
»Gute Reflexe«, lobte Rebus.
»Nichts passiert. War ja leer.«
Danach machte sie absichtlich, wie ihnen beiden klar war, Konversation, verkniff sich die Fragen, die sie ihm eigentlich unbedingt stellen wollte, und berichtete ihm stattdessen über die Bluttat in South Queensferry.
Drei Tote, ein Verletzter. Ein ruhiges Küstenstädtchen, wenige Kilometer nordöstlich der Stadtgrenze gelegen. Eine Privatschule für Jungen und Mädchen im Alter von fünf bis achtzehn. Sechshundert insgesamt, jetzt zwei weniger.
Die dritte Leiche war der Todesschütze, der seine Waffe anschließend gegen sich selbst gerichtet hatte. Wie Siobhan gesagt hatte, eine völlig klare Sache.
Abgesehen von der Frage nach dem Warum.
»Er hatte dieselbe Vergangenheit wie Sie«, sagte sie nun. »War ein Ex-Soldat, meine ich. Man nimmt an, dass sein Motiv etwas damit zu tun hat: Hass auf die Gesellschaft.«
Rebus fiel auf, dass sie ihre Hände inzwischen tief in den Taschen vergraben hatte. Er vermutete, sie hatte sie zu Fäusten geballt und es noch nicht einmal bemerkt.
»In der Zeitung stand, dass er eine Firma gehabt hat«, sagte er.
»Er besaß ein Motorboot, hat Wasserskiläufer damit gezogen.«
»Und doch hatte er diesen Hass?«
Sie zuckte die Achseln. Rebus wusste, dass sie sich wünschte, sie würde am Tatort gebraucht, würde irgendetwas tun, um ihre Gedanken von der anderen Ermittlung abzulenken – einer internen und zudem einer, in deren Mittelpunkt sie selbst stand.
Sie starrte an die Wand über seinem Kopf, so als sehe sie dort etwas Interessantes.
»Sie haben mich noch gar nicht gefragt, wie es mir geht«, sagte er.
Sie schaute ihn an, »Wie geht es Ihnen?«
»Bin kurz vorm Lagerkoller, trotzdem danke der Nachfrage.«
»Sie sind doch erst seit gestern hier.«
»Mir kommt’s länger vor.«
»Was sagt der Arzt?«
»War noch keiner bei mir, jedenfalls nicht heute. Egal, was er sagt, ich haue nachher hier ab.«
»Und was dann?«
»Wie meinen Sie das?«
»Sie können nicht arbeiten.« Erst jetzt musterte sie seine Hände. »Wie wollen Sie Auto fahren oder einen Bericht tippen? Oder einen Telefonhörer halten?«
»Das schaffe ich schon irgendwie.« Er ließ den Blick schweifen, denn nun war er derjenige, der Augenkontakt vermied. Seine Zimmergenossen waren ausnahmslos Männer etwa in seinem Alter und mit demselben fahlen Teint. Alle hatten sie der schottischen Lebensart Tribut zollen müssen, so viel war sicher. Einer von ihnen hustete, weil es ihn nach einer Zigarette verlangte. Ein anderer sah aus, als habe er Atemprobleme. Lauter Vertreter der übergewichtigen, fettlebrigen Masse männlicher Mitbürger. Rebus hob eine Hand, kratzte sich mit dem Unterarm die linke Wange und spürte dabei seine Bartstoppeln. Er wusste, sie hatten dieselbe graue Farbe wie die Wände dieser Krankenstation.
»Ich schaffe das schon«, wiederholte er in die Stille hinein, senkte den Arm und wünschte sogleich, er hätte ihn nicht angehoben. Ein glühender Schmerz stach in seine Finger, als das Blut in sie zurückfloss. »Hat man schon mit Ihnen gesprochen?«, fragte er.
»Worüber?«
»Tun Sie doch nicht so, Siobhan …«
Sie sah ihn an, ohne zu blinzeln. Als sie sich auf dem Stuhl vorbeugte, tauchten ihre Hände aus ihren Verstecken auf.
»Ich habe heute Nachmittag noch einen Termin.«
»Bei wem?«
»Der Chefin.« Bei Detective Superintendent Gill Templer also. Rebus nickte, zufrieden, dass noch keine höhere Dienststelle mit der Angelegenheit befasst war.
»Was werden Sie ihr erzählen?«, fragte er.
»Es gibt nichts zu erzählen. Ich habe mit Fairstones Tod nichts zu tun.« Sie schwieg, und eine weitere unausgesprochene Frage schwebte zwischen ihnen in der Luft. Können Sie das von sich auch behaupten? Sie schien darauf zu warten, dass Rebus etwas sagte, aber er blieb stumm. »Sie wird wissen wollen, was mit Ihnen los ist«, fügte Siobhan hinzu. »Wieso Sie hier sind.«
»Ich habe mich verbrüht«, sagte Rebus. »Das hört sich blöd an, aber so war’s.«
»Ich weiß, dass Sie gesagt haben, es sei so gewesen…«
»Nein Siobhan, es ist so gewesen. Fragen Sie den Arzt, wenn Sie mir nicht glauben.« Er sah sich erneut um. »Immer vorausgesetzt, Sie entdecken ihn irgendwo.«
»Vielleicht sucht er immer noch einen Parkplatz.«
Ein reichlich müder Witz, aber Rebus lächelte trotzdem. Sie hatte ihm signalisiert, dass sie ihn nicht weiter bedrängen würde. Sein Lächeln drückte Dankbarkeit aus.
»Wer hat in South Queensferry das Kommando?«, fragte er, um das Thema zu wechseln.
»DI Hogan, glaube ich.«
»Bobby ist ein guter Polizist. Wenn es überhaupt möglich ist, den Fall schnell abzuschließen, wird er das schaffen.«
»Ziemlicher Medienrummel, nach allem was man so hört. Grant Hood ist für die Pressearbeit abgestellt worden.«
»Das heißt, er fehlt uns in St. Leonard’s.« Rebus wirkte nachdenklich. »Ein Grund mehr, dass ich mich rasch zurückmelde.«
»Vor allem, falls man mich vom Dienst suspendiert …«
»Das wird man nicht. Sie haben es doch selbst gesagt, Siobhan – Sie haben mit Fairstone nichts zu tun. So wie ich es sehe, war es ein Unfall. Und jetzt, da etwas Wichtigeres passiert ist, wird die Angelegenheit vielleicht eines natürlichen Todes sterben, wenn ich so sagen darf.«
»Ein Unfall«, wiederholte sie seine Worte.
Er nickte langsam. »Also machen Sie sich bloß keine Sorgen. Es sei denn, natürlich, Sie haben den Mistkerl tatsächlich um die Ecke gebracht.«
»John …« In ihrer Stimme lag ein warnender Unterton. Rebus lächelte erneut und brachte ein Zwinkern zustande.
»Sollte ein Witz sein«, sagte er. »Ich weiß nur allzu gut, wem Gill den Tod von Fairstone anhängen will.«
»Er ist verbrannt, John.«
»Und das bedeutet, ich habe ihn umgebracht?« Rebus hielt beide Hände hoch und drehte sie hin und her. »Verbrühungen, Siobhan. Nichts anderes, bloß Verbrühungen.«
Sie erhob sich. »Wenn Sie das sagen, John.« Dann stand sie vor ihm, während er die Hände senkte und den peinigenden Schmerz zu ignorieren versuchte, der ihn schlagartig durchströmte.
Eine Krankenschwester näherte sich und kündigte an, sie werde seine Verbände wechseln.
»Ich wollte sowieso gerade los«, sagte Siobhan zu ihr. Und dann zu Rebus: »Mir ist der Gedanke zuwider, Sie könnten sich zu einer derartigen Dummheit hinreißen lassen, und dabei glauben, es geschehe mir zuliebe.«
Er schüttelte langsam den Kopf, und sie drehte sich um und ging weg. »Nicht vom Glauben abfallen, Siobhan!«, rief er ihr hinterher.
»Ihre Tochter?«, fragte die Krankenschwester im Plauderton.
»Nur eine befreundete Arbeitskollegin.«
»Haben Sie etwas mit der Kirche zu tun?«
Rebus zuckte zusammen, als sie eine der Binden abzuwickeln begann. »Wie kommen Sie denn da drauf?«
»Die Art, wie Sie das Wort Glauben benutzt haben.«
»In meinem Beruf braucht man mehr davon als in den meisten anderen.« Er schwieg einen Moment. »Aber bei Ihnen ist das vielleicht genauso, oder?«
»Bei mir?« Sie lächelte, den Blick auf ihre geschickten Hände gerichtet. Sie war klein, keine Schönheit, geschäftsmäßig. »Ich kann es mir nicht leisten, untätig herumzusitzen und abzuwarten, bis der Glaube etwas für mich erledigt. Wie haben Sie das eigentlich angestellt?« Sie meinte seine von Blasen übersäten Hände.
»Hab sie aus Versehen in heißes Wasser getaucht«, erklärte er und spürte dabei, wie eine Schweißperle seine Schläfe hinunterzukriechen begann. Mit Schmerzen werde ich fertig, dachte er bei sich. Die Probleme liegen woanders. »Könnten wir die Verbände denn nicht gegen etwas Leichteres austauschen?«
»Sie sind wohl erpicht darauf, von hier zu verschwinden?«
»Erpicht darauf, einen Becher in die Hand zu nehmen, ohne dass er mir runterfällt.« Oder einen Telefonhörer, dachte er. »Außerdem gibt es bestimmt jemand, der das Bett hier dringender braucht.«
»Wirklich sehr selbstlos von Ihnen. Wir müssen abwarten, was der Arzt dazu sagt.«
»Und wann wird der Arzt hier sein?«
»Sie müssen sich schon noch ein bisschen gedulden.«
Geduld: das Einzige, wofür er überhaupt keine Zeit hatte.
»Vielleicht bekommen Sie ja noch mehr Besuch.«
Das bezweifelte er. Niemand außer Siobhan wusste, wo er war. Jemand vom Krankenhauspersonal hatte sie auf seine Bitte hin angerufen, damit sie Templer ausrichtete, er habe sich für einen, maximal zwei Tage krankgemeldet. Allerdings war Siobhan als Folge des Anrufs angerückt gekommen. Vielleicht hatte er das vorhergesehen. Vielleicht war das der Grund, wieso er bei ihr hatte anrufen lassen und nicht auf der Polizeiwache.
Das war gestern Nachmittag gewesen. Gestern Morgen hatte er den Kampf aufgegeben und war zu seinem Hausarzt gegangen. Die Praxisvertretung hatte ihm nach einem Blick auf seine Hände gesagt, er müsse ins Krankenhaus. Rebus hatte ein Taxi zur nächstgelegenen Notaufnahme genommen, und es war ihm peinlich gewesen, dass der Fahrer ihm in die Hosentasche greifen musste, um sich das Geld für die Fahrt zu holen.
»Haben Sie die neusten Nachrichten gehört?«, hatte der Fahrer gefragt. »In einer Schule hat’s eine Schießerei gegeben.«
»Wahrscheinlich bloß mit einem Luftgewehr.«
Aber der Mann hatte den Kopf geschüttelt. »Nein, im Radio war sogar von einer Tragödie die Rede …«
In der Notaufnahme hatte Rebus geduldig gewartet, bis er drankam. Seine Hände waren verbunden worden, und die Verletzungen wurden als nicht ernst genug eingestuft, um eine Verlegung in die Verbrennungseinheit draußen in Livingston zu rechtfertigen. Aber er hatte deutlich erhöhte Temperatur gehabt, deshalb wurde angeordnet, dass er über Nacht im Krankenhaus bleiben sollte, und ein Krankenwagen brachte ihn nach Little France. Er nahm an, man wollte ihn im Auge behalten, für den Fall, dass er in einen Schockzustand oder Ähnliches geriet. Oder man befürchtete, er sei eine Gefahr für sich selbst. Allerdings hatte bisher niemand mit ihm über so etwas gesprochen. Vielleicht ließ man ihn deshalb nicht gehen: man wollte warten, bis ein Psychiater ihn kurz in Augenschein genommen hatte.
Er dachte an Jean Burchill, den einzigen Menschen, dem sein plötzliches Verschwinden von zu Hause womöglich auffallen würde. Aber ihr Verhältnis hatte sich ein bisschen abgekühlt. Sie schafften es etwa alle anderthalb Wochen, eine Nacht miteinander zu verbringen. Telefonierten öfters miteinander, trafen sich manchmal nachmittags zum Kaffee. Ihr Verhältnis war zu einer Gewohnheit geworden. Er erinnerte sich, dass er vor Jahren eine kurze Affäre mit einer Krankenschwester gehabt hatte. Er wusste nicht, ob sie immer noch in der Stadt arbeitete. Er könnte sich natürlich erkundigen, aber ihm war ihr Name entfallen. Das war ein Problem von ihm: er hatte manchmal Schwierigkeiten mit Namen. Vergaß die eine oder andere Verabredung. Eigentlich nichts Schlimmes, nur eine zwangsläufige Folge des Älterwerdens. Aber er stellte fest, dass er sich bei Zeugenaussagen zunehmend auf seine Notizen verließ. Vor zehn Jahren hatte er weder Netz noch doppelten Boden gebraucht. Seine Auftritte waren überzeugender gewesen, und er hatte die Geschworenen stets beeindruckt – zumindest hatten ihm das die Staatsanwälte gesagt.
»Fertig.« Die Krankenschwester richtete sich auf. Sie hatte Salbe auf seinen Händen verteilt, sie mit Gaze bedeckt und die alten Binden wieder darum gewickelt. »Besser?«
Er nickte. Die Haut fühlte sich etwas kühler an, aber er wusste, das würde nicht so bleiben.
»Dürfen Sie noch weitere Schmerzmittel bekommen?« Eine rhetorische Frage. Sie überprüfte die Verlaufskurve am Fußende seines Bettes. Er hatte sich das Blatt vorhin auf dem Rückweg von der Toilette angeschaut. Temperatur und Medikamentierung waren darauf verzeichnet, sonst nichts. Kein Wort von der Geschichte, die er erzählt hatte, während er untersucht worden war.
Hab mir ein heißes Bad einlaufen lassen … bin ausgerutscht und reingefallen.
Der Arzt hatte einen kehligen Laut von sich gegeben, was besagen sollte, dass er sich mit der Geschichte zufrieden gab, ohne sie unbedingt zu glauben. Überarbeitet, Schlafmangel – nicht seine Aufgabe nachzuhaken. Er war Arzt und kein Polizist.
»Ich könnte Ihnen ein paar Paracetamol geben«, bot die Schwester an.
»Wie groß ist die Chance auf ein Bier zum Runterspülen?«
Sie lächelte erneut ihr routiniertes Lächeln. Während ihrer jahrelangen Arbeit beim National Health Service hatte sie wahrscheinlich nicht allzu viele originelle Sprüche gehört.
»Ich seh zu, was ich für Sie tun kann.«
»Sie sind ein Engel«, sagte Rebus zu seiner eigenen Überraschung. Es war eine Bemerkung, von der er glaubte, dass Patienten sie machen, eines dieser bequemen Klischees. Die Schwester war schon auf dem Weg hinaus, und er war sich nicht sicher, ob sie es gehört hatte. Vielleicht hatte es etwas mit dem Wesen von Krankenhäusern zu tun. Auch wenn man sich nicht krank fühlte, übten sie dennoch eine bestimmte Wirkung auf einen aus, ließen einen träge und folgsam werden. Dem Anstaltsleben angepasst. Es konnte etwas mit den Farben, dem summenden Hintergrundgeräusch zu tun haben. Vielleicht spielte auch die Temperatur in den Zimmern eine Rolle. Auf der Polizeiwache St. Leonard’s gab es eine besondere Zelle für die »Ausgeklinkten«. Sie war hellrosa und sollte sie angeblich beruhigen. Was sprach dagegen, dass hier eine ähnliche psychologische Methode angewandt wurde? Das Letzte, was die Schwestern gebrauchen konnten, war ein pampiger Patient, der herumkrakeelte und alle fünf Minuten aus dem Bett sprang. Daher die beengenden Laken, die ganz festgesteckt waren, um jegliche Bewegung zu erschweren. Bleiben Sie einfach ruhig liegen … auf die Kissen gebettet … und aalen Sie sich in der Wärme und der Helligkeit … Machen Sie keine Unannehmlichkeiten. Er glaubte, wenn das so weiterginge, würde er bald seinen Namen vergessen. Die Welt draußen würde keine Bedeutung mehr haben. Es würde keine Arbeit auf ihn warten. Kein Fall Fairstone. Kein Wahnsinniger, der in einer Schule um sich geschossen hatte …
Rebus drehte sich auf die Seite und schob mit den Beinen die Laken weg. Es war ein Zwei-Fronten-Kampf, wie bei Harry Houdini, wenn er in einer Zwangsjacke steckte. Der Mann im Bett nebenan hatte die Augen aufgeschlagen und schaute zu.
»Graben Sie ruhig weiter Ihren Tunnel in die Freiheit«, sagte er zu dem Mann. »Ich mach einen Spaziergang, schüttel mir die Erde aus den Hosenbeinen.«
Der Mitgefangene schien die Anspielung nicht zu verstehen …
Siobhan war inzwischen in St. Leonard’s und trieb sich dort in der Nähe des Getränkeautomaten herum. An einem der Tische in der kleinen Kantine saßen ein paar Uniformierte und verspeisten Sandwiches und Kartoffelchips. Der Getränkeautomat stand im angrenzenden Flur, von dem aus man auf den Parkplatz hinausschauen konnte. Hätte sie geraucht, so hätte sie eine Entschuldigung gehabt, nach draußen zu gehen, wo die Chance geringer war, dass Gill Templer sie finden würde. Aber sie war Nichtraucherin. Sie konnte versuchen, in dem schlecht belüfteten Fitnessraum am Ende des Flurs in Deckung zu gehen, oder sie konnte hinüber zu den Zellen schlendern. Aber nichts würde Gill Templer davon abhalten, die Sprechanlage der Wache zu benutzen, um ihre Beute zu stellen. Es würde sich herumsprechen, dass sie im Haus war. Das war in St. Leonard’s so: Es gab kein Versteck. Sie riss an der Lasche der Coladose und wusste dabei, worüber die Uniformierten am Tisch redeten – über dasselbe wie alle anderen.
Drei Tote bei einer Schießerei in einer Schule.
Sie hatte die aktuellen Ausgaben der Zeitungen überflogen. Grobkörnige Fotos der toten Schüler waren abgebildet: zwei Jungen, siebzehn Jahre alt. Die Wörter »Tragödie«, »Verlust«, »Schock« und »Gemetzel« waren von den Journalisten großzügig verwendet worden. Neben der eigentlichen Geschichte füllten zusätzliche Reportagen Seite um Seite: die zunehmende Vorliebe der Briten für Waffen … mangelnde Sicherheit an Schulen … eine Chronologie der Selbstmordattentate. Siobhan betrachtete die Fotos des Täters – offenbar verfügten die Medien bisher nur über drei verschiedene Aufnahmen. Eine war sehr unscharf, so als sei auf ihr ein Geist statt eines Menschen aus Fleisch und Blut abgebildet. Die zweite zeigte einen Mann im Overall, der nach einem Seil griff, während er an Bord eines kleinen Bootes ging.
Er lächelte, das Gesicht der Kamera zugewandt. Siobhan hatte den Eindruck, dass es ein Werbefoto für seine Wasserski-Firma war.
Das dritte war eine Porträtaufnahme aus der Armeezeit des Mannes. Herdman, hieß er. Lee Herdman, sechsunddreißig Jahre alt. Wohnhaft in South Queensferry, Besitzer eines Motorbootes. Es waren Fotos von dem Grundstück abgebildet, auf dem er seine Firma betrieb. »Kaum mehr als anderthalb Kilometer vom Ort des entsetzlichen Geschehens entfernt«, wie eine Zeitung hinausposaunte.
Als ehemaliger Soldat dürfte es ziemlich einfach für ihn gewesen sein, sich eine Waffe zu besorgen. Er war auf das Schulgelände gefahren, hatte neben den Autos der Lehrer geparkt. War offensichtlich in Eile gewesen, denn er hatte die Fahrertür weit offen gelassen. Zeugen sahen ihn in die Schule stürmen. Sein erstes und einziges Ziel – der Aufenthaltsraum. Drei Schüler in dem Zimmer. Zwei waren jetzt tot, einer verletzt. Dann ein Schuss in die eigene Schläfe, und das war’s. Es war bereits Kritik laut geworden – wieso, bitteschön, hatte ein Unbefugter, nach dem, was in Dunblane geschehen war, einfach so in eine Schule spazieren können? Hatte es bei Herdman Anzeichen dafür gegeben, dass er ausrasten würde? Konnte man einem Arzt oder einem Sozialarbeiter die Schuld geben? Der Regierung? Irgendjemandem – wem auch immer. Jemand musste schuld sein. Es war zwecklos, nur Herdman allein verantwortlich zu machen: Er war tot. Es musste sich doch irgendwo ein Sündenbock auftreiben lassen. Siobhan vermutete, dass die Öffentlichkeit morgen die üblichen Verdächtigen vorgeführt bekäme: Gewalt in der modernen Zivilisation … Filme und Fernsehen… der Druck, unter dem viele Menschen standen … Dann würde es wieder ruhiger werden. Eine Statistik war Siobhan besonders aufgefallen – seit man als Folge des Massakers in Dunblane die Bestimmungen für den Waffenbesitz verschärft hatte, war die Zahl der Verbrechen mit Waffengewalt sogar noch gestiegen. Sie wusste, wie die Waffenlobby sich das zunutze machen würde …
Einer der Gründe, wieso ganz St. Leonard’s über die Morde sprach, bestand darin, dass der Vater des überlebenden Jungen ein Mitglied des Schottischen Parlaments war – und nicht nur irgendein MSP. Jack Bell war vor sechs Monaten in die Bredouille gekommen, denn die Polizei hatte ihn im Stadtteil Leith bei einer Razzia in den Straßen des Autostrichs festgenommen. Die Anwohner der Gegend hatten zuvor die Behörden mehrfach bei Demonstrationen aufgefordert, aktiv zu werden. Die Polizei hatte reagiert, indem sie eines Abends ausgerückt war und sich dabei unter anderem Jack Bell, MSP, geschnappt hatte.
Bell hatte jedoch darauf beharrt, unschuldig zu sein, hatte seine Anwesenheit in der Gegend mit »Recherchen vor Ort« erklärt. Seine Ehefrau hatte zu ihm gestanden und die meisten Mitglieder seiner Partei ebenfalls, mit dem Ergebnis, dass man im Polizeipräsidium beschlossen hatte, die Angelegenheit auf sich beruhen zu lassen. Aber erst nachdem die Medien ihren Spaß auf Bells Kosten gehabt hatten, was dazu führte, dass der MSP die Polizei beschuldigte, sie stecke mit den »Revolverblättern« unter einer Decke und mache nur wegen seiner beruflichen Position auf ihn Jagd.
Die Abneigung hatte sich bei Bell hartnäckig gehalten und dazu geführt, dass er mehrere Reden im Parlament hielt, in denen er von der Ineffizienz bei der Verbrechensbekämpfung und der Notwendigkeit einer Polizeireform sprach. All das, da war man sich einig, könnte sich zu einem Problem auswachsen.
Denn Bell war von Beamten aus Leith festgenommen worden, von eben jener Polizeiwache, die jetzt für die Gewalttat in der Port Edgar Academy zuständig war.
Und zufällig lag South Queensferry in seinem Wahlkreis …
Und als hätte das noch nicht genügt, um den Leuten Gesprächsstoff zu liefern, war außerdem eines der Opfer der Sohn eines Richters.
Aus all dem resultierte der zweite Grund, wieso in St. Leonard’s alle über den Fall redeten. Sie fühlten sich ausgeschlossen. Da Leith das Kommando hatte und nicht St. Leonard’s, blieb ihnen nichts anderes übrig, als untätig abzuwarten, in der Hoffnung, dass es nötig werden würde, zusätzliche Kräfte hinzuzuziehen. Das bezweifelte Siobhan allerdings. Der Fall war sonnenklar, die Leiche des Schützen lag in der Gerichtsmedizin, die seiner Opfer nicht weit entfernt. Das würde Gill Templer nicht in genügendem Maße ablenken, damit sie –
»DS Clarke ins Büro vom Chief Super!« Der quäkende Befehl kam aus einem Lautsprecher, der über ihr an der Decke angebracht war. Die Uniformierten in der Kantine drehten sich um und schauten sie an. Sie versuchte, gelassen zu wirken, und trank ihre Dose leer. Ihre Eingeweide fühlten sich plötzlich kalt an – und das hatte nichts mit der eisgekühlten Cola zu tun.
»DS Clarke zum Chief Super!«
Direkt vor ihr war die Glastür. Dahinter stand ihr Auto brav auf dem Parkplatz. Was würde Rebus tun – verschwinden oder sich verstecken? Sie musste lächeln, als sie sich die Frage beantwortete. Er würde nichts von beidem tun. Er würde wahrscheinlich auf dem Weg zum Büro der Chefin zwei Stufen auf einmal nehmen, in der Gewissheit, dass er Recht hatte und sie Unrecht, egal, was sie sagen würde.
Siobhan warf die Dose weg und ging zur Treppe.
»Sie wissen, warum ich Sie sprechen will?«, fragte Detective Superintendent Gill Templer. Sie saß hinter dem Schreibtisch ihres Büros, vor sich den tagtäglich anfallenden Papierkram. DCS Templer stand der Division B vor, die drei Polizeiwachen im Südteil der Stadt umfasste, mit St. Leonard’s als Bereichszentrale. Ihr Arbeitspensum war nicht so hoch wie das mancher ihrer Kollegen, aber das würde sich ändern, wenn das Schottische Parlament endlich in den Neubau am Ende der Holyrood Road einzog. Templer verbrachte schon jetzt unverhältnismäßig viel Zeit in Konferenzen, die sich mit den Anforderungen des Parlaments beschäftigten. Siobhan wusste, dass sie diese Termine verabscheute. Kein Mensch wurde Polizist, weil er eine Vorliebe für Papierkram hatte. Aber Finanzen und Budgetierung standen immer häufiger oben auf der Themenliste. Beamte, die es schafften, Ermittlungen oder eine ganze Polizeiwache im Rahmen des Budgets zu leiten, waren eine geschätzte Spezies; jene, die den Finanzrahmen nicht ausschöpften, wurden als überaus seltene, hoch entwickelte Lebewesen angesehen.
Siobhan sah, dass der Stress bei Gill Templer Spuren hinterließ. Sie hatte stets einen leicht gequälten Gesichtsausdruck. In ihrem Haar glitzerte es grau. Entweder war es ihr noch nicht aufgefallen, oder sie hatte keine Zeit, sich darum zu kümmern. Die Zeit war ihr übermächtiger Gegner. Das brachte Siobhan zu der Überlegung, welchen Preis sie für das Erklimmen der Karriereleiter würde zahlen müssen. Immer vorausgesetzt, diese Leiter war am Ende des heutigen Tages noch in Sichtweite.
Templer schien etwas in ihrer Schreibtischschublade zu suchen. Schließlich gab sie es auf, schloss die Schublade und richtete ihre Aufmerksamkeit auf Siobhan. Während sie das tat, senkte sie ihr Kinn. Als Folge davon wurde ihr Blick strenger, aber es betonte auch, wie Siobhan nicht entging, die Falten an ihrem Hals und ihrem Mund. Als Templer sich auf ihrem Stuhl bewegte, spannte sich ihre Kostümjacke unter ihrem Busen, offenbar hatte sie zugenommen. Entweder zuviel Fastfood oder zu viele dienstliche Abendessen mit irgendwelchen hohen Tieren. Siobhan, die an diesem Morgen um sechs im Fitnessraum gewesen war, setzte sich auf ihrem Stuhl etwas aufrechter hin und hob ihr Kinn ein wenig.
»Ich nehme an, es geht um Martin Fairstone«, sagte sie, womit sie den ersten Schlagabtausch für sich entschied. Da Templer nichts erwiderte, redete sie weiter: »Ich habe mit seinem Tod nichts –«
»Wo ist John?«, unterbrach Templer sie in scharfem Ton.
Siobhan schluckte bloß.
»Er ist nicht in seiner Wohnung«, fuhr Templer fort. »Ich habe jemanden hingeschickt, um nachzusehen. Dabei hat er sich Ihren Angaben zufolge für einige Tage krankgemeldet. Wo ist er, Siobhan?«
»Ich …«
»Es ist nämlich so: Vorgestern abend wurde Martin Fairstone in einem Pub gesehen. Das wäre an sich nichts Ungewöhnliches, aber er war in Begleitung eines Mannes, dessen Beschreibung haargenau auf Detective Inspector John Rebus passt. Und ein paar Stunden später ist Fairstone in der Küche seiner Wohnung bei lebendigem Leibe verbrannt.« Sie verstummte einen Augenblick lang. »Vorausgesetzt natürlich, er war noch am Leben, als das Feuer ausbrach.«
»Madam, ich kann Ihnen wirklich nicht –«
»John passt gerne ein bisschen auf Sie auf, Siobhan, stimmt’s? Daran ist nichts auszusetzen. Das liegt an seinem Faible, den Ritter in funkelnder Rüstung zu spielen, nicht wahr? Ständig muss er nach einem neuen Drachen Ausschau halten, mit dem er kämpfen kann.«
»Das alles hat mit DI Rebus nichts zu tun, Madam.«
»Wieso versteckt er sich dann?«
»Mir war nicht bewusst, dass er sich irgendwo versteckt.«
»Aber Sie haben ihn gesehen?« Es war eine Frage, jedoch nur so gerade eben. Templer lächelte liebenswürdig. »Darauf würde ich wetten.«
»Es geht ihm wirklich nicht gut genug, um zur Arbeit zu kommen«, parierte Siobhan, merkte allerdings, dass ihre Konter viel von der anfänglichen Schlagkraft verloren hatten.
»Wenn er nicht herkommen kann, bin ich durchaus bereit, mich von Ihnen zu ihm bringen zu lassen.«
Siobhan spürte, wie ihre Schultern zusammensackten. »Ich muss erst mit ihm reden.«
Templer schüttelte den Kopf. »In dieser Sache gibt es keinen Verhandlungsspielraum, Siobhan. Ihnen zufolge hat Fairstone Sie belästigt. Er hat Ihnen das blaue Auge verpasst.« Unwillkürlich hob Siobhan eine Hand an ihren linken Wangenknochen. Die Farbtönung verblasste mehr und mehr, sah inzwischen eher wie ein Schatten aus. Man konnte sie mit Make-up verdecken oder mit Müdigkeit erklären. Aber Siobhan sah sie immer noch, wenn sie in den Spiegel schaute.
»Und jetzt ist er tot«, fuhr Templer fort. »Bei einem Wohnungsbrand, verursacht womöglich durch Fremdeinwirkung. Sie werden daher verstehen, dass ich mit jedem sprechen muss, der ihn an jenem Abend gesehen hat.« Sie legte erneut eine Pause ein. »Wann haben Sie ihn zuletzt gesehen, Siobhan?«
»Wen – Fairstone oder DI Rebus?«
»Beide, von mir aus.«
Siobhan sagte nichts. Ihre Hände wollten die Metallarmlehnen ihres Stuhls umklammern, aber dann stellte sie fest, dass er keine Armlehnen hatte. Ein neuer Stuhl, unbequemer als der alte. Dann sah sie, dass Templers Stuhl ebenfalls neu war, und einige Zentimeter höher gestellt als früher. Ein kleiner Trick, um sich einen Vorteil gegenüber ihren Besuchern zu verschaffen … was bedeutete, dass die Chefin glaubte, solche Hilfsmittel nötig zu haben.
»Ich glaube nicht, dass ich bereit bin, darauf eine Antwort zu geben, Madam.« Siobhan legte eine Pause ein. »Mit Verlaub.« Sie stand auf und fragte sich gleichzeitig, ob sie sich auf Befehl wieder hinsetzen würde.
»Das enttäuscht mich sehr, DS Clarke.« Templers Stimme klang kühl; keine Anrede mit dem Vornamen mehr. »Werden Sie John von unserer Unterhaltung erzählen?«
»Wenn Sie das möchten.«
»Ich gehe davon aus, dass Sie beide Ihre Versionen der Geschichte vor einer offiziellen Untersuchung aufeinander abstimmen wollen.«
Siobhan nahm die Drohung mit einem Nicken zur Kenntnis.
Gill Templer brauchte bloß den Antrag zu stellen, und schon würde das Complaints Department auf der Bildfläche erscheinen, mit einem Haufen misstrauischer Fragen im Gepäck. Das Complaints Department: vollständige Bezeichnung Complaints and Conduct Department – Abteilung für Beschwerden und dienstliches Fehlverhalten.
»Vielen Dank, Madam«, sagte Siobhan lediglich, öffnete die Tür und machte sie gleich darauf hinter sich zu. Am Ende des Flurs befand sich eine Toilette, und sie schloss sich darin ein, setzte sich, holte eine kleine Papiertüte aus der Tasche und atmete eine Weile lang hinein. Als sie das erste Mal eine Panikattacke erlitten hatte, kam es ihr so vor, als würde sie gleich einen Herzstillstand erleiden: ihr Herz pochte laut, ihre Lungen schienen den Dienst zu versagen, ihr ganzer Körper stand unter Strom. Ihr Arzt riet ihr, sich ein paar Tage freizunehmen. Sie hatte seine Praxis in der Erwartung betreten, dass er sie zu Untersuchungen ins Krankenhaus überweisen würde, aber stattdessen sagte er zu ihr, sie solle sich einen Ratgeber besorgen, der von ihren Beschwerden handelte. Sie kaufte sich einen in der Apotheke. Im ersten Kapitel war jedes einzelne ihrer Symptome aufgelistet, und es wurden einige Vorschläge gemacht. Den Konsum von Koffein und Alkohol einschränken. Weniger Salz und Fett essen. In eine Papiertüte atmen, wenn ein Anfall bevorzustehen schien.
Der Arzt hatte gesagt, ihr Blutdruck sei etwas zu hoch und hatte sportliche Betätigung empfohlen. Daraufhin gewöhnte sie sich an, eine Stunde früher nach St. Leonard’s zu fahren und vor der Arbeit im Fitnessraum zu trainieren. Der Commonwealth Pool befand sich nur ein paar Straßenzüge entfernt, und sie fasste den Vorsatz, dort regelmäßig schwimmen zu gehen.
»Ich ernähre mich ziemlich gesund«, hatte sie zum Arzt gesagt.
»Versuchen Sie mal, eine Woche lang Buch zu führen«, hatte er erwidert. Bis jetzt hatte sie sich noch nicht die Mühe gemacht. Und sie vergaß immer wieder, ihren Badeanzug mitzunehmen.
Es war nur allzu leicht, die Schuld auf Martin Fairstone zu schieben.
Fairstone: wegen zwei Anklagen vor Gericht – Einbruch und Körperverletzung. Als er die Wohnung verließ, in die er gerade eingebrochen hatte, stellte sich ihm eine Nachbarin in den Weg; Fairstone knallte den Kopf der Frau gegen eine Wand und trat ihr so brutal ins Gesicht, dass die Sohle seines Turnschuhs einen Abdruck auf der Haut hinterlassen hatte. Siobhan hatte vor Gericht ausgesagt und dabei ihr Bestes gegeben. Aber man hatte den Schuh nirgends gefunden, und bei der Durchsuchung von Fairstones Wohnung war nichts von dem Diebesgut aufgetaucht. Die Nachbarin hatte den Angreifer beschrieben, hatte dann später Fairstone in der Verbrecherkartei wiedererkannt und ihn auch bei der Gegenüberstellungs-Parade herausgepickt.
Es gab jedoch Schwachstellen in der Anklage, die die Staatsanwaltschaft auch sofort erkannt hatte. Keine Beweise am Tatort. Keine Verbindung zwischen Fairstone und dem Verbrechen, abgesehen von der Identifizierung und dem Umstand, dass er als Einbrecher einschlägig bekannt und mehrfach wegen Körperverletzung vorbestraft war.
»Der Schuh wäre prima gewesen.« Der Staatsanwalt hatte sich den Bart gekratzt und gefragt, ob er vielleicht einen der Anklagepunkte fallen lassen, vielleicht einen Handel anbieten sollte.
»Und er bekommt einen Klaps auf die Finger und ist ein freier Mann?«, hatte Siobhan eingewandt.
Vor Gericht wurde Siobhan vom Verteidiger darauf hingewiesen, dass zwischen der ursprünglichen Beschreibung, die die Nachbarin von ihrem Angreifer abgegeben hatte, und dem Mann auf der Anklagebank wenig Ähnlichkeit bestand. Dem Opfer selbst erging es kaum besser, denn sie gab einen kleinen Rest an Unsicherheit zu, den der Verteidiger weidlich ausnutzte. Während ihrer eigenen Aussage machte Siobhan so viele Andeutungen wie möglich, um alle Anwesenden wissen zu lassen, dass der Angeklagte vorbestraft war. Irgendwann konnte der Richter jedoch die Proteste der Verteidigung nicht mehr ignorieren.
»Ich verwarne Sie eindringlich, Detective Sergeant Clarke«, hatte er gesagt. »Sofern Sie den Chancen der Anklage nicht aus irgendwelchen Gründen absichtlich schaden wollen, empfehle ich Ihnen, sich Ihre Antworten ab jetzt sorgfältiger zu überlegen.«
Fairstone hatte sie wütend angestarrt, denn ihm war natürlich klar gewesen, was sie bezweckte. Und später, nach der Verkündung des Urteils »Nicht schuldig«, hüpfte er geradezu aus dem Gerichtsgebäude, so als hätte er Sprungfedern in den Absätzen seiner nagelneuen Turnschuhe. Draußen vor dem Gebäude packte er Siobhan bei der Schulter, um sie am Weggehen zu hindern.
»Das ist eine Tätlichkeit«, hatte sie zu ihm gesagt, bemüht, sich nicht anmerken zu lassen, wie wütend und enttäuscht sie war.
»Vielen Dank, dass du mir da drin rausgeholfen hast«, sagte er. »Vielleicht kann ich mich ja irgendwann mal revanchieren. Ich will in einen Pub, um zu feiern. Komm doch mit.«
»Tun Sie mir einen Gefallen und verschwinden Sie im nächsten Gully.«
»Ich glaub, ich hab mich verliebt.« Ein Grinsen breitete sich über sein ganzes, schmales Gesicht aus. Jemand rief nach ihm: seine Freundin. Chemie-blond, schwarzer Trainingsanzug. Zigarettenschachtel in der einen Hand, Handy am Ohr. Sie hatte ihm für die Tatzeit ein Alibi verschafft, gemeinsam mit zweien seiner Freunde.
»Sieht aus, als würde die junge Dame was von Ihnen wollen.«
»Ich will dich, Shiv.«
»Sie wollen mich?« Sie wartete, bis er nickte. »Dann nehmen Sie mich doch mit, wenn Sie wieder mal vorhaben, eine wildfremde Frau zu verprügeln.«
»Gib mir deine Nummer.«
»Ich stehe im Telefonbuch – unter ›Polizei‹.«
»Marty!« Das Fauchen seiner Freundin.
»Wir sehen uns, Shiv.« Immer noch grinsend ging er ein paar Schritte rückwärts und drehte sich dann erst um. Siobhan fuhr schnurstracks nach St. Leonard’s, um seine Akte erneut zu studieren. Eine Stunde später stellte die Telefonzentrale einen Anruf durch. Es war Fairstone, der aus einer Kneipe anrief. Sie legte auf. Zehn Minuten später rief er wieder an … und nach weiteren zehn erneut.
Und am nächsten Tag.
Und während der gesamten darauf folgenden Woche.
Anfangs war sie sich unsicher über die richtige Taktik. Sie wusste nicht, ob ihr Schweigen Erfolg versprechend war. Es schien ihn bloß zum Lachen zu bringen, ein Ansporn für ihn zu sein. Sie hoffte inständig, er werde es irgendwann leid sein und sich eine andere Beschäftigung suchen. Dann tauchte er vor St. Leonard’s auf und versuchte, ihr nach Hause zu folgen. Sie bemerkte ihn jedoch und fuhr durch die Gegend, bis die Verstärkung eingetroffen war, die sie per Handy angefordert hatte. Die Besatzung des Streifenwagens stellte ihn zur Rede. Am nächsten Tag parkte er wieder vor dem Parkplatz auf der Rückseite von St. Leonard’s. Sie hatte nichts unternommen, sondern war durch den Haupteingang gegangen und mit dem Bus nach Hause gefahren.
Dennoch gab er nicht auf, und ihr wurde klar, dass diese Angelegenheit, die anfangs – vermutlich – nur ein Scherz gewesen war, sich inzwischen zu einer ernsteren Art von Spiel entwickelt hatte. Daher beschloss sie, ein schwereres Geschütz in Stellung zu bringen. Rebus war es ohnehin schon aufgefallen: die Anrufe, die sie nicht annahm; die viele Zeit, die sie am Bürofenster verbrachte; die neue Angewohnheit, sich immer wieder umzuschauen, wenn sie beide dienstlich in der Stadt unterwegs waren. Also erzählte sie es ihm schließlich, und sie statteten Fairstone in seiner Sozialwohnung in Gracemount gemeinsam einen Besuch ab.
Es war von Anfang an schlecht gelaufen, denn Siobhan musste rasch einsehen, dass ihr »Geschütz« nach seinen eigenen Regeln spielte, statt sich an die anderer zu halten. Ein Gerangel, von dem Couchtisch im Wohnzimmer brach ein Bein ab, das Furnier drückte sich nach innen in die Faserplatte. Siobhan fühlte sich hinterher so schlecht wie lange nicht – schwächlich, weil sie Rebus mitgenommen hatte, statt sich selbst um die Sache zu kümmern; zittrig, weil sich in ihr der leise Verdacht regte, dass sie genau gewusst hatte, was passieren würde, und auch gewollt hatte, dass es passierte. Anstifterin und Feigling.
Sie machten auf dem Rückweg in einem Pub Station.
»Glauben Sie, dass er etwas unternehmen wird?«, fragte Siobhan.
»Er hat angefangen«, sagte Rebus zu ihr. »Und er weiß jetzt, was ihm blüht, wenn er Sie weiter behelligt.«
»Eine Tracht Prügel, meinen Sie.«
»Es war reine Selbstverteidigung, Siobhan. Sie waren dabei. Sie haben es mit angesehen.«
Sein Blick fixierte sie, bis sie nickte. Und er hatte ja auch Recht, Fairstone hatte sich auf ihn gestürzt. Rebus hatte ihn hinunter auf den Couchtisch gedrückt und versucht, ihn dort festzuhalten. Dann brach das Tischbein ab, und beide Männer purzelten zu Boden, rollten kämpfend herum. Es war binnen Sekunden vorbei gewesen, und Fairstones Stimme hatte vor Wut gebebt, als er ihnen sagte, sie sollten verschwinden. Rebus hob drohend einen Finger, als er den Befehl wiederholte, »sich von DS Clarke fern zu halten.«
»Haut endlich ab, ihr beiden!«
Siobhan fasste Rebus am Arm. »Kommen Sie, es ist vorbei.«
»Du glaubst, es ist vorbei?« Aus Fairstones Mundwinkel flogen weiße Speichelspritzer.
Rebus letzte Worte: »Das will ich schwer hoffen, Freundchen, es sei denn, du willst ein echtes Feuerwerk erleben.«
Sie wollte ihn fragen, was er damit gemeint hatte, aber stattdessen holte sie ihnen ein letztes Mal Nachschub an der Bar. In jener Nacht starrte sie an die dunkle Zimmerdecke, döste ein, doch schrak sie mit einem Gefühl plötzlichen Entsetzens wieder hoch und sprang, von Adrenalin durchströmt, aus dem Bett. Sie kroch auf allen vieren aus dem Schlafzimmer, überzeugt davon, dass sie sterben würde, wenn sie sich erhob. Irgendwann war es vorbei, und sie tastete sich beim Aufstehen mit den Händen an der Wand des Flurs entlang. Sie ging langsam zurück ins Schlafzimmer, legte sich hin und drehte sich zusammengerollt auf die Seite.
Darunter leiden mehr Menschen, als Sie vielleicht denken, sollte ihr Arzt später, nach der zweiten Attacke, zu ihr sagen.
In der Zwischenzeit reichte Martin Fairstone Beschwerde wegen Belästigung ein, zog die Beschwerde aber kurz darauf zurück. Und er rief sie weiterhin an. Sie versuchte, es vor Rebus geheim zu halten, denn sie wollte lieber nicht erfahren, was er mit »Feuerwerk« meinte.
Das CID-Büro war menschenleer. Die Kollegen waren entweder zu Ermittlungen unterwegs oder bei Gericht. Nicht selten wartete man eine halbe Ewigkeit darauf, seine Zeugenaussage machen zu können, nur um dann zu erleben, wie die Anklage in sich zusammenbrach oder der Beschuldigte es sich anders überlegte. Manchmal schwänzte ein Geschworener, oder jemand Wichtiges war krank. Die Zeit rann dahin, und am Ende lautete das Urteil »Nicht schuldig«. Selbst bei einem Schuldspruch wurde oft nur eine Geld- oder Bewährungsstrafe verhängt. Die Gefängnisse waren überfüllt, und Haft galt mehr denn je nur als Ultima ratio. Siobhan fand nicht, dass sie zynisch geworden war, sondern bloß realistisch. Kürzlich war Kritik laut geworden, dass es in Edinburgh mehr Knöllchenverteiler als richtige Polizisten gab. Wenn eine Sache wie die in South Queensferry passierte, wurde die personelle Lage noch heikler. Urlaub, Krankschreibungen, Papierkram, Gerichtstermine … und ein Tag hatte einfach nicht genug Stunden. Siobhan war sich bewusst, dass auf ihrem Schreibtisch einiges liegen geblieben war. Wegen Fairstone hatte ihre Arbeit gelitten. Sie spürte noch immer seine Gegenwart. Wenn ein Telefon klingelte, erstarrte sie, und sie hatte sich ein paarmal dabei ertappt, wie sie zum Fenster gegangen war, um nachzusehen, ob draußen sein Wagen stand. Sie wusste, sie benahm sich irrational, konnte daran aber nichts ändern. Wusste auch, dass sie über so etwas mit niemandem reden konnte – ohne Schwäche zu zeigen.
Ein Telefon begann zu klingeln. Nicht ihres, sondern das von Rebus. Wenn niemand abhob, würde die Zentrale es vielleicht unter einem anderen Anschluss versuchen. Sie ging hinüber und wünschte dabei inständig, es möge verstummen. Das tat es aber erst, als sie den Hörer abnahm.
»Hallo?«
»Mit wem spreche ich?« Eine männliche Stimme. Energisch, geschäftsmäßig.
»DS Clarke.«
»Tag, Shiv. Hier spricht Bobby Hogan.« Detective Inspector Bobby Hogan. Sie hatte ihn schon einmal gebeten, sie nicht Shiv zu nennen. Immer wieder wurde sie so genannt. Siobhan, Schi-wahn ausgesprochen, wurde zur Kurzform Shiv. Wenn fremde Leute ihren Namen aufschrieben, kamen dabei alle möglichen falschen Schreibweisen heraus. Ihr fiel ein, dass Fairstone sie, im Bemühen um Vertraulichkeit, ein paar Mal Shiv genannt hatte. Sie konnte es nicht leiden, und eigentlich sollte sie Hogan verbessern, ließ es aber sein.
»Viel zu tun?«, fragte sie stattdessen.
»Wissen Sie, dass ich für die Sache in Port Edgar zuständig bin?« Er brach ab. »Blöde Frage, natürlich wissen Sie’s.«
»Sie sind wirklich telegen, Bobby.«
»Ich bin zwar für Schmeicheleien stets empfänglich, Shiv, aber die Antwort lautet ›nein‹.«
Sie musste unwillkürlich lächeln. »Ich ertrinke momentan nicht gerade in Arbeit«, log sie, den Blick auf die Akten auf ihrem Tische gerichtet.
»Wenn ich ein zusätzliches Paar Hände brauche, melde ich mich bei Ihnen. Ist John da?«
»Der beliebteste Kollege von allen? Er hat sich krankgemeldet. Was wollen Sie von ihm?«
»Ist er zu Hause?«
»Ich könnte ihm wahrscheinlich eine Nachricht übermitteln.« Ihr Interesse war geweckt. Hogans Stimme hatte etwas Dringliches an sich.
»Sie wissen, wo er ist?«
»Ja.«
»Wo?«
»Sie haben meine Frage noch nicht beantwortet: Was wollen Sie von ihm?«
Hogan stieß einen langen Seufzer aus. »Ich brauche das erwähnte zusätzliche Paar Hände«, sagte er zu ihr.
»Und es müssen unbedingt seine sein?«
»Glaube schon.«
»Ich bin am Boden zerstört.«
Er ging nicht darauf ein. »Wie schnell können Sie es ihm ausrichten?«
»Womöglich ist er gesundheitlich nicht in der Lage, Ihnen zu helfen.«
»Sofern er nicht gerade an der eisernen Lunge hängt, kann er mir hier nützen.«
Sie lehnte sich an Rebus’ Tisch an. »Was ist bei Ihnen los?«
»Sagen Sie ihm einfach, er soll mich anrufen, okay?«
»Sind Sie in der Schule?«
»Er soll es am besten auf meinem Handy probieren. Wiederhören, Shiv.«
»Warten Sie!« Siobhan schaute zur Tür hinüber.
»Was?« Hogans Ungeduld war nicht zu überhören.
»Er ist gerade gekommen. Ich reiche Sie weiter.« Sie streckte den Hörer Rebus entgegen. All seine Kleidungsstücke saßen irgendwie schief. Zuerst dachte sie, er sei betrunken, aber dann wurde ihr klar, woran es lag. Er hatte Probleme gehabt, sich anzuziehen. Das Hemd war mehr schlecht als recht unter den Hosenbund gestopft worden. Die Krawatte hing lose um den Hals. Statt Siobhan den Hörer abzunehmen, stellte er sich vor sie hin und hielt das Ohr dagegen.
»Bobby Hogan«, erklärte sie.
»Tag, Bobby.«
»John? Die Verbindung ist plötzlich so schlecht …«
Rebus schaute Siobhan an. »Näher ran«, flüsterte er. Sie drehte den Hörer, bis sie sein Kinn berührte, und bemerkte dabei, dass sein Haar dringend gewaschen werden musste. Vorne klebte es an der Kopfhaut, und hinten stand es ab.
»Besser so, Bobby?«
»Ja, prima. Du musst mir einen Gefallen tun, John.«
Als Siobhan die Hand mit dem Hörer etwas sacken ließ, schaute Rebus zu ihr hoch. Ihr Blick war erneut auf die Tür gerichtet. Er drehte sich um und sah Gill Templer.
»In mein Büro!«, bellte sie. »Sofort!«
Rebus fuhr sich mit der Zungenspitze über die Lippen. »Ich glaube, ich muss dich später zurückrufen, Bobby. Die Chefin will mit mir reden.«
Er richtete sich auf und nahm Hogans Stimme nur noch blechern wie die eines Automaten wahr. Templer machte ihm ein Zeichen, ihr zu folgen. Den Blick auf Siobhan gerichtet, zuckte er die Achseln, und ging zur Tür.
»Er ist weg«, sagte sie in die Sprechmuschel.
»Dann holen Sie ihn zurück!«
»Das geht leider nicht. Hören Sie… wie wär’s, wenn Sie mir einen Anhaltspunkt geben, worum es geht? Womöglich könnte ich Ihnen helfen …«
»Ich lass die Tür offen, wenn du nichts dagegen hast«, sagte Rebus.
»Wenn du willst, dass jeder, der vorbeikommt, mithören kann, soll mir das recht sein.«
Rebus plumpste auf den Besucherstuhl. »Es ist bloß so, dass ich mich mit Türgriffen momentan ein bisschen schwer tue.« Er hob die Hände, damit Templer sie sah. Augenblicklich veränderte sich ihr Gesichtsausdruck.
»Mein Gott, was ist passiert, John?«
»Hab mich verbrüht. Sieht schlimmer aus, als es ist.«
»Dich verbrüht?« Sie lehnte sich zurück und presste die Finger gegen die Tischkante.
Er nickte. »Nicht mehr und nicht weniger.«
»Dir ist klar, was ich gerade denke?«
»Ja, natürlich. Aber es war so: Ich habe heißes Wasser in die Küchenspüle laufen lassen, um abzuwaschen, habe vergessen, kaltes dazuzugeben, und meine Hände hineingesteckt.«
»Wie lange genau?«
»Lange genug, um sie zu verbrühen.« Er versuchte zu lächeln, denn er hoffte, die Geschichte mit dem Abwasch klänge glaubwürdiger als die mit der Badewanne, Templer wirkte jedoch alles andere als überzeugt. Ihr Telefon fing an zu klingeln. Sie hob den Hörer kurz an und legte sofort wieder auf.
»Du bist nicht der Einzige, der in letzter Zeit Pech gehabt hat. Martin Fairstone ist bei einem Brand umgekommen.«
»Siobhan hat’s mir erzählt.«
»Und?«
»Unfall mit der Fritteuse.« Er zuckte die Achseln. »So was kommt vor.«
»Du warst Sonntagabend mit ihm zusammen.«
»War ich das?«
»Zeugen haben euch beide zusammen in einem Pub gesehen.«
Rebus zuckte erneut die Achseln. »Er ist mir zufällig über den Weg gelaufen.«
»Und du hast den Pub gemeinsam mit ihm verlassen?«
»Nein.«
»Und bist mit ihm nach Hause gegangen?«
»Behauptet das jemand?«
»John …«
Seine Stimme wurde lauter. »Behauptet jemand, dass es kein Unfall gewesen ist?«
»Die feuerpolizeilichen Untersuchungen sind noch nicht abgeschlossen.«
»Dann wünsche ich den Kollegen viel Erfolg.« Rebus machte Anstalten, die Arme zu verschränken, merkte dann aber, was er da tat, und ließ sie wieder hinabbaumeln.
»Das tut wahrscheinlich weh.«
»Gibt Schlimmeres.«
»Und es ist Sonntagabend passiert?«
Er nickte.
»Pass auf, John …« Sie beugte sich vor, die Ellbogen auf dem Schreibtisch. »Du weißt, was die Leute sagen werden. Siobhan hat erklärt, Fairstone belästige sie ständig. Er hat das bestritten und im Gegenzug behauptet, du hättest ihn bedroht.«
»Eine Anschuldigung, die er später zurückgezogen hat.«
»Und jetzt erfahre ich von Siobhan, dass Fairstone sie tätlich angegriffen hat. Wusstest du davon?«
Er schüttelte den Kopf. »Der Brand ist bloß ein dummer Zufall.«
Sie senkte den Blick. »Es macht aber keinen besonders guten Eindruck.«
Rebus schaute ostentativ an sich hinunter. »Hat es mich je gekümmert, ob ich einen guten Eindruck mache?«
Beinahe hätte sie gelächelt. »Ich will bloß sichergehen, dass uns in dieser Sache kein Ärger droht.«
»Vertrau mir, Gill.«
»Dann hast du bestimmt nichts dagegen, eine offizielle Aussage abzugeben? Schriftlich, meine ich.« Erneut hatte ihr Telefon zu klingeln begonnen.
»Ich würde dieses Mal lieber rangehen«, sagte eine Stimme. Siobhan stand mit verschränkten Armen im Flur. Templer sah sie an, dann nahm sie den Hörer ab.
»Hier ist DCS Templer.«
Siobhan fing Rebus’ Blick auf und zwinkerte ihm zu. Gill Templer hörte zu, was der Anrufer ihr zu sagen hatte.
»Ich verstehe … ja … vermutlich ist es … dürfte ich erfahren, wieso ausgerechnet er?«
Rebus begriff plötzlich. Es war Bobby Hogan. Vielleicht nicht am Telefon – womöglich hatte Hogan den stellvertretenden Polizeichef gebeten, an seiner Stelle anzurufen. Weil Rebus ihm einen Gefallen tun sollte. Hogan besaß zurzeit aufgrund der von ihm geleiteten Ermittlungen eine gewisse Macht. Rebus fragte sich, um was für einen Gefallen es sich handeln mochte.
Templer legte den Hörer auf. »Du sollst dich umgehend in South Queensferry melden. Offenbar braucht DI Hogan jemand, der bei ihm Händchen hält.« Sie starrte auf die Schreibtischplatte.
»Verbindlichsten Dank«, sagte Rebus.
»Die Fairstone-Sache wird sich nicht in Luft auflösen, John, vergiss das nicht. Sobald Hogan dich nicht mehr benötigt, gehörst du wieder mir.«
»Verstanden.«
Templer schaute an ihm vorbei zu Siobhan hinüber. »In der Zwischenzeit wird DS Clarke vielleicht etwas zur Aufklärung –«
Rebus räusperte sich. »Es gibt da leider ein kleines Problem …«
»Was denn?«
Rebus hielt die Hände in die Höhe und drehte sich langsam herum. »Ich werd’s vermutlich schaffen, bei Bobby Hogan Händchen zu halten, aber bei allem anderen brauche ich ein bisschen Hilfe.« Er drehte sich zur Seite. »Also, wenn du DS Clarke für eine Weile entbehren könntest …«
»Ich kann dir einen Fahrer besorgen«, erwiderte Templer schnippisch.
»Aber fürs Aufnehmen von Aussagen… telefonische Befragungen … bräuchte ich jemand vom CID. Und wenn ich mir überlege, wie es eben drüben im Büro aussah, gibt es, glaube ich, keine Alternative.« Er schwieg einen Moment. »Natürlich nur, wenn es dir recht ist.«
»Los, macht, dass ihr wegkommt.« Templer griff abrupt nach einem Stapel Papierkram. »Sobald es Neuigkeiten von der Feuerpolizei gibt, hörst du von mir.«
»Alles klar, Boss«, sagte Rebus, während er aufstand.
Zurück im CID-Büro wies er Siobhan an, aus einer der Taschen seines Jacketts ein Plastikdöschen mit Tabletten zu holen. »Die Idioten waren mit den Dingern so geizig, als wären sie aus Gold«, maulte er. »Bringen Sie mir etwas Wasser.«
Sie nahm eine Flasche von ihrem Tisch und half ihm, zwei Tabletten hinunterzuspülen. Als er eine dritte haben wollte, überprüfte sie das Etikett.
»Hier steht, alle vier Stunden zwei Stück.«
»Eine mehr wird nicht schaden.«
»Die werden bei dem Verbrauch aber nicht lange reichen.«
»In meiner anderen Tasche ist ein Rezept. Wir halten unterwegs bei einer Apotheke.«
Sie schraubte den Deckel wieder auf das Döschen. »Vielen Dank, dass Sie mich mitnehmen.«
»Keine Ursache.« Er schwieg kurz. »Wollen Sie über Fairstone reden?«
»Nicht unbedingt.«
»In Ordnung.«
»Ich gehe davon aus, dass Sie sich genauso wenig vorzuwerfen haben wie ich.« Ihr Blick bohrte sich in seine Augen.
»Stimmt genau«, sagte er. »Und das bedeutet, wir können uns voll und ganz auf die Hilfe für Bobby Hogan konzentrieren. Aber da ist noch eine Sache, ehe wir losfahren …«
»Ich höre?«
»Könnten Sie mir eventuell die Krawatte ordentlich binden? Die Krankenschwester hatte keine Ahnung, wie das geht.«
Sie lächelte. »Ich warte schon lange auf die Chance, meine Hände um Ihren Hals zu legen.«
»Noch so eine Bemerkung, und ich befördere Sie im hohen Bogen zur Chefin zurück.«
Aber das tat er nicht, auch dann nicht, als sie nicht in der Lage war, seine Anweisungen zum Binden eines Krawattenknotens zu befolgen. Am Ende übernahm es die Frau in der Apotheke, während das Medikament auf dem Rezept geholt wurde.
»Ich habe das früher immer für meinen Mann gemacht«, sagte sie. »Gott hab ihn selig.«
Draußen auf der Straße schaute Rebus den Bürgersteig entlang. »Ich brauche Zigaretten«, sagte er.
»Erwarten Sie ja nicht, dass ich die Dinger für Sie anzünde«, sagte Siobhan und verschränkte die Arme. Er starrte sie an. »Das ist mein Ernst«, fügte sie hinzu. »Eine bessere Gelegenheit aufzuhören werden Sie nie wieder kriegen.«
Er kniff die Augen zusammen. »Sie genießen das, stimmt’s?«
»Irgendwie schon«, gab sie zu und öffnete mit großer Geste die Beifahrertür für ihn.
2
Nach South Queensferry zu gelangen, dauerte seine Zeit. Sie fuhren durch die Innenstadt, dann die Queensferry Road, und erst, als sie die A 90 erreichten, kamen sie einigermaßen zügig voran. Der Ort, den sie ansteuerten, schien sich zwischen die beiden Brücken – eine für Autos, eine für Eisenbahnen – zu schmiegen, die den Firth of Forth überspannten.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!