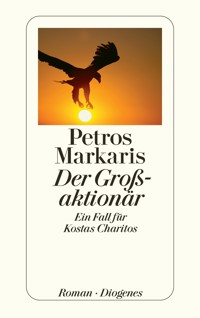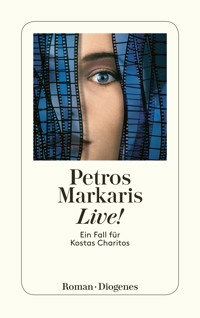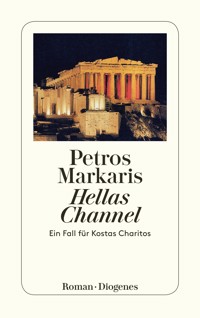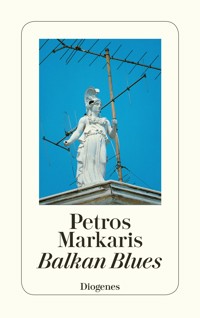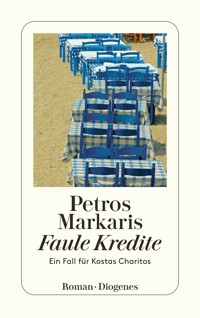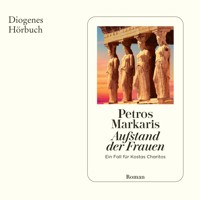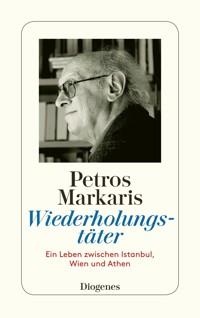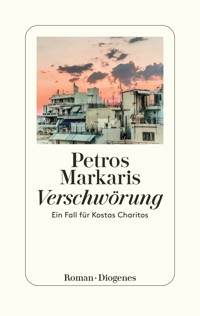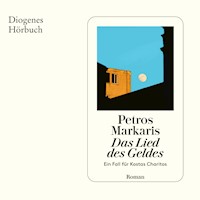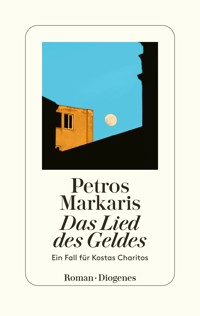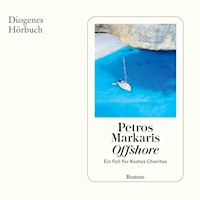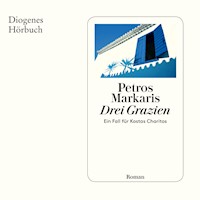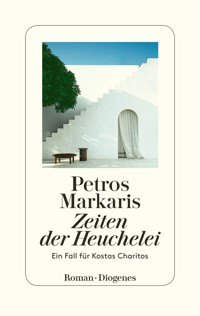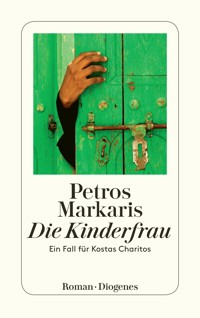
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Kostas Charitos
- Sprache: Deutsch
Was in Istanbul geschah, ist nun viele Jahrzehnte her. Und doch findet die neunzigjährige Kinderfrau keine Ruhe – sie hat noch alte Rechnungen zu begleichen. Kommissar Charitos folgt ihren Spuren: Sie führen nach ›Konstantinopel‹, in eine Vergangenheit mit zwei Gesichtern – einem schönen und einem hässlichen. Petros Markaris präsentiert mit ›Die Kinderfrau‹ einen Roman voll Nostalgie – sein bisher persönlichstes Buch.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 347
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Petros Markaris
Die Kinderfrau
Ein Fall fürKostas Charitos
Roman
Aus dem Neugriechischen vonMichaela Prinzinger
Titel der 2008 bei Samuel Gavrielides Editions, Athen,
erschienenen Originalausgabe: ›Παλιά, πολύ παλιά‹
Copyright ©2008 by Petros Markaris
und Samuel Gavrielides Editions
Der Text wurde für die 2009 im Diogenes Verlag erschienene deutsche Erstausgabe
in Zusammenarbeit mit dem Autor nochmals durchgesehen
Covermotiv: Foto von Bryan Peterson (Ausschnitt)
Copyright ©Bryan Peterson/Corbis/Specter (Ausschnitt)
In Gedenken an die wahre Maria Chambena,
die uns groβgezogen hat
Alle Rechte vorbehalten
Copyright ©2017
Diogenes Verlag AG Zürich
www.diogenes.ch
ISBN Buchausgabe 978 3 257 24041 2 (7. Auflage)
ISBN E-Book 978 3 257 60323 1
Die grauen Zahlen im Text entsprechen den Seitenzahlen der im Impressum genannten Buchausgabe.
[5] Sie haben mich oft bedrängt von meiner Jugend auf,
aber sie haben mich nicht überwältigt.
Die Pflüger haben auf meinem Rücken geackert
und ihre Furchen langgezogen.
Psalm 129
[7] 1
Die Heilige Jungfrau schaut streng, fast tadelnd auf mich herab. So kommt es mir jedenfalls vor, doch es kann gut sein, dass es sich um reine Einbildung oder um einen griechisch-orthodoxen, auf Minderwertigkeitskomplexen beruhenden Dünkel handelt. Hat die Muttergottes nichts Besseres zu tun, als sich ausgerechnet mit mir zu beschäftigen? Sie blickt auf ihre Schäfchen, die sich im riesigen Narthex drängeln. Ganz zufällig bin auch ich darunter, zusammen mit meiner Ehefrau, inmitten einer Horde von Athener Touristen.
»Die Darstellung der Heiligen Jungfrau mit dem Jesuskind datiert aus dem Jahr 867 und ist somit das älteste erhaltene Mosaik.« Die Stimme der Fremdenführerin bringt mich wieder in die Gegenwart zurück. »Es wurde gegen Ende des Bilderstreits geschaffen.«
»Dank sei dir, Großmächtiger, dass du mich für würdig erachtest«, flüstert Adriani neben mir und bekreuzigt sich, während sie hinzufügt: »Heilige Jungfrau, Muttergottes, erhöre mein Gebet.« Ich weiß, wofür sie betet, ziehe es jedoch vor, das Thema nicht anzusprechen.
»Die Kuppel der Hagia Sophia ist fünfundfünfzig Meter und sechzig Zentimeter hoch«, höre ich wieder die Stimme der Fremdenführerin. »Was den Durchmesser betrifft, so ist die Nord-Süd-Achse der Kuppel etwas kürzer als die [8] Ost-West-Achse. Dort, wo Sie die arabischen Schriftzeichen sehen, befand sich einst das Mosaik des Pantokrators, die Darstellung Christi als Weltenherrscher. Die arabischen Schriftzeichen wurden im achtzehnten Jahrhundert hinzugefügt und stammen aus der ersten Sure des Korans.«
In der Hauptkuppel, wohin die Fremdenführerin unser Augenmerk lenkt, breiten sich die Mosaiken von der Mitte nach unten aus und enden bei den kleinen Fensteröffnungen, durch die das Sonnenlicht hereinfällt.
»Wenn man das Gekritzel entfernt, kommt also darunter das Jesuskind zum Vorschein? Schon krass«, meint Stelaras, und sein vorlautes Gelächter schallt durch den Raum, während ihm seine Mutter ein »Ruhe jetzt!« ins Ohr zischt.
»Es ist ungewiss, ob darunter der Pantokrator zum Vorschein käme«, erläutert die Fremdenführerin. »Die meisten Archäologen und Restauratoren sind der Meinung, dass der Großteil des Mosaiks zerstört wurde.«
»Irgendwann kommt der Tag, und Konstantinopel wird wieder unser sein, aber was bleibt dann davon für uns noch übrig?«, kommentiert Despotopoulos betrübt.
Ich tue so, als betrachte ich, von der Pracht überwältigt, hingebungsvoll den Innenraum, und entferne mich von der Reisegruppe, denn Despotopoulos, Brigadegeneral der Panzertruppe a.D., ist ein großer Verehrer der heiligen Allianz zwischen den Streit- und den Sicherheitskräften. Daher richtet er bei jedem Ausbruch von Vaterlandsliebe dieselbe Frage an mich: »Und was meinen Sie, Herr Kommissar?« Und ich halte mich eisern zurück. Sonst würde mir vielleicht noch die Bemerkung herausrutschen, dass es, nachdem die Albaner Athen erobert haben, an der Zeit ist, [9] Konstantinopel heimzuholen – das wäre ein Bevölkerungsaustausch der etwas anderen Art.
Ich ziehe mich aus dem Narthex zum Kaisertor zurück, um das Kirchenschiff in seiner ganzen Größe zu sehen. Es ist seltsam, doch die Hagia Sophia scheint so gebaut zu sein, dass man stets nach oben in den Himmel blickt und nie nach unten in die Hölle. Vergeblich versucht man, den Blick auf das Irdische und Niedrige zu richten, immer gleitet er in die Höhe, zu den Säulen, den Emporen, die den Frauen vorbehalten waren, hoch zu den Kuppeln und den Fensteröffnungen, die das Hauptschiff an ausgeklügelten Stellen, in einem Spiel von Licht und Schatten, erhellen. Das trägt sicherlich zu dem Ehrfurcht einflößenden Eindruck bei, den der Sakralbau hervorruft. Die schönsten Ornamente sind dementsprechend hoch oben angebracht, und man muss den Kopf demütig in den Nacken legen, um sie zu bewundern. Ich halte nach einem Besucher Ausschau, dessen Blick nach unten oder zur Seite gerichtet ist, doch ich kann keinen finden.
Ich mache einen Rundgang durch die Kirche, um ihre Ausmaße auf mich wirken zu lassen und die Lichteffekte zu ergründen. Ein wildes Sprachengewirr umtost mich: Englisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Italienisch, Türkisch. Ich schließe die Augen, geblendet vom Blitzlicht japanischer Touristen, die einander fröhlich ablichten, während neben mir einige Mönche in dunkelbraunen Kutten mit Kapuzen und mit riesigen Kreuzen um den Hals den Ausführungen eines Priesters in einer slawischen Sprache lauschen.
Adriani bedeutet mir von weitem, mich wieder der [10] Gruppe anzuschließen. Ich gehorche ohne große Begeisterung, da mir mein einsamer Spaziergang viel besser gefällt als das auswendig gelernte Geleier der Fremdenführerin, das die Tatsachen eher vernebelt als erhellt.
»Komm, wir gehen auf die Frauenempore«, erklärt mir Adriani und hängt sich feierlich bei mir ein, als schritten wir zur österlichen Auferstehungsfeier.
»Der Nordwestflügel, der zur Frauenempore und zum Versammlungssaal der heiligen Synode führt, wurde im sechsten Jahrhundert errichtet«, fährt die Fremdenführerin fort.
Wir laufen eine gewundene, gepflasterte Rampe hoch, die wie ein überdachtes Altstadtgässchen wirkt. An jeder Kurve befindet sich ein kleines, viereckiges Fenster, das die Rampe gerade so viel erleuchtet, dass man nicht auf die Nase fällt.
»Lass jetzt das Handy in Ruhe, Schatz, du brichst dir noch alle Knochen!«, maßregelt die Stefanakou ihren Sohn.
»Ich will nur testen, ob es in diesem Bunker überhaupt Empfang hat.«
»Jetzt reicht’s, spiel nicht damit rum, Stelaras, wir wollen weitergehen!«, greift sein Vater ein.
Stelaras ist der fünfzehnjährige verzogene Sohnemann des Ehepaars Stefanakos, in einem Alter also, in dem selbst Marlon Brando wenig anziehend wirkte. Seine Mutter ruft ihn naheliegenderweise ›Stelios‹, doch sein Vater zieht aus unerfindlichen Gründen dem niedlichen ›Stelakos‹ das grobe ›Stelaras‹ vor.
»Ist der byzantinische Kaiser hier hochgeritten?«, fragt die Pachatouridou die Fremdenführerin.
[11] »Nein, hier ist die Kaiserin auf die Frauenempore hochgeschritten, um an der heiligen Messe teilzunehmen«, verbessert die Fremdenführerin, die an der Spitze der Gruppe geht. »Der Kaiser ist unten geblieben, im Narthex.«
»Sind Sie da sicher?«
Die Fremdenführerin bleibt stehen und lächelt sie an: »In der Literatur ist das Zeremoniell gut dokumentiert. Nirgendwo wird erwähnt, dass sich der Kaiser zu Pferd auf die Frauenempore begeben hätte.«
Die Pachatouridou beugt sich zu Adriani und flüstert ihr ins Ohr. »Wo hat man die denn aufgetrieben? Die hat ja keine Ahnung. Konstantinos Paleologos, der letzte byzantinische Kaiser, ist hier hochgeritten, daran gibt’s nichts zu rütteln.«
Sobald wir das enge, schlecht erleuchtete Gässchen verlassen, empfängt uns eine breite Lichtschneise, die durch die großen Fenster der Frauenempore hereindringt. Rechts liegen die Fenster, links die Säulen und in der Mitte ein geräumiger Gang mit einem Marmorfußboden.
»Von hier aus hat die Kaiserin die heilige Messe verfolgt.« Die Fremdenführerin deutet nach links zu der Stelle, wo einst der Thron der Kaiserin stand.
Zum ersten Mal blicke ich in die entgegengesetzte Richtung, nämlich von oben nach unten, und ich frage mich, ob die Hagia Sophia jemals bis auf den letzten Platz gefüllt war. Wie viele Gläubige wären nötig gewesen, um jeden Sonn- und Feiertag ein anständiges Publikum für die Messe zu garantieren? Vielleicht sollte sie ja aber auch nur dem Hofstaat und der kirchlichen Hierarchie als offizieller Zeremonienraum dienen. Mein Verdacht erhärtet sich, als wir [12] den Saal betreten, in dem die heilige Synode tagte. Wenn sie hier zusammentrat, dann war das Gotteshaus logischerweise eine Art Regierungssitz und nicht so sehr für die Kirchengemeinde gedacht. All das reime ich mir freilich selbst zusammen, denn meine Beziehung zur Kirche besteht nur gerade im alljährlichen Besuch der Auferstehungsmesse zu Ostern. Früher schleppte mich meine Mutter noch ans Kirchweihfest zu Ehren eines Dorf- oder Stadtheiligen, und während meiner Ausbildung an der Polizeischule gehörte es dazu, am Sonntag die Messe zu besuchen.
Vor dem Mosaik, das die Gottesmutter mit dem Jesuskind im Arm zwischen Johannes Komnenos und Kaiserin Eirene zeigt, drängelt sich eine Gruppe Japaner, die wieder zwanghaft fotografiert. Eine kleine Japanerin baut sich genau vor der Gottesmutter auf, um zwischen Komnenos und Eirene abgelichtet zu werden, und dabei strahlt sie vor Begeisterung über ihre Eingebung. Wie sie so dasteht, sage ich mir, sieht es auf dem Foto bestimmt so aus, als würden zwei Köpfe, ihrer und der des Jesuskindes, aus ihrem Körper wachsen. Doch das scheint den Fotografen der Truppe überhaupt nicht zu stören, der den anderen bedeutet, von diesem Motiv ebenso Gebrauch zu machen.
»Die setzen sich an die Stelle der Heiligen Jungfrau? Jesus Maria!« Adriani ist empört und bekreuzigt sich.
»Liebe Frau Charitou«, wirft die Despotopoulou besänftigend ein, »darf man denn erwarten, dass sich Götzendiener respektvoll benehmen?«
»Buddhisten«, verbessert die Pachatouridou.
»Auch Buddhisten sind Götzendiener. Sie verehren ja die Buddhastatue.«
[13] Ich schicke mich gerade zum Weitergehen an, als mich Despotopoulos zurückhält. Auf mysteriöse Art und Weise taucht er immer in meiner Nähe auf. »All das ist zwar eindrucksvoll, aber Byzanz ist ein Fremdkörper und hat keinen Bezug zu Griechenland.«
»Wie kommen Sie denn darauf?«, frage ich überrascht.
»Griechenland ist die Wiege der abendländischen Kultur. Das hier ist der Orient. Wenn man vom orthodoxen Glauben absieht, steht Byzanz den Türken näher als uns Griechen.«
»Wieso wollen Sie Konstantinopel dann zurückhaben?«
»Weil strategisch gesehen der naturgemäße Expansionsraum Griechenlands im Osten liegt. Nach Westen gibt es keinen Lebensraum für uns. Das hat schon Alexander der Große begriffen«, stellt der Feldherr a.D. klar.
Adriani hält mich am Unterarm zurück und lässt die restliche Mannschaft weiterziehen. »Nette Leute«, meint sie, nachdem die anderen außer Hörweite sind. »Aber manchmal unerträglich.«
»Beschwer dich nicht, ich habe dir vorgeschlagen, alleine herzukommen, aber du wolltest ja nicht.«
»Mit dem Mirafiori!« Sie schreit fast, so zornig ist sie. »Die Fahrt Athen-Istanbul mit dem Mirafiori zu machen! Es gibt auf der Welt nur einen einzigen Polizisten, der keinerlei Gespür für Gefahrensituationen hat, und das ist ausgerechnet mein Mann!«
[14] 2
Wer den Spruch »Die Sünden der Eltern baden die Kinder aus« in die Welt gesetzt hat, muss mit Sicherheit kinderlos gewesen sein. Denn wenn ich mich umschaue, sehe ich weit und breit kein Elternpaar, das seinen Abkömmlingen das Leben schwermacht. Die meisten kleiden ihre Kinder in Samt und Seide, und wenn sie sich trendige Markenprodukte nicht leisten können, dann muss eben ein überzeugendes Imitat her, das wie ein Original aussieht, damit der Sprössling keine seelischen Schäden davonträgt. Sie bringen ihre Kinder zum Englischkurs, zum Französischunterricht, zur Deutschstunde und zur Nachhilfe, und sobald sie die Panhellenischen Prüfungen für das Universitätsstudium bestanden haben, kaufen sie ihnen auch ein Auto, mit dem schlagenden Argument: »Das arme Kind muss auf dem Weg zur Uni zwei Mal umsteigen!« Auch wenn dies alles unter falscher Erziehung und folglich unter »elterlichen Sünden« firmiert, eines ist sicher: Die Kinder leiden nicht darunter.
All das führe ich an, weil ich zu Recht stolz darauf bin, dass ich solchen Sünden nicht verfallen bin. Katerina hat nicht mehr Nachhilfeunterricht bekommen als unbedingt nötig. Ihr Englisch hat sie auf dem Lyzeum gelernt, und über ein anderes Fortbewegungsmittel als den öffentlichen Verkehr verfügt sie auch heute nicht.
Doch was ist mit den Eltern, die unter den [15] Entscheidungen der Sprösslinge zu leiden haben? Darüber sagt der unbekannte Kritiker der Elternseite nicht das Geringste. Kann ja sein, dass Katerina ihre Doktorarbeit ohne große Ansprüche an uns und mit spartanischer Lebensweise geschafft hat, andererseits jedoch sind ihre Entscheidungen stets wie ein Blitz aus heiterem Himmel über uns hereingebrochen. Sie liebt uns, sie sorgt sich um uns, sie kümmert sich um uns, doch immer war sie die alleinige Urheberin aller Entscheidungen und wir nur die Adressaten ihrer Beschlüsse. In der zweiten Klasse des Lyzeums verkündete sie uns, sie wolle Jura studieren. Als sie den Abschluss machte und ich mich bei Freunden und Bekannten in der Staatsanwaltschaft nach einer seriösen Anwaltskanzlei umhörte, wo sie ihr Referendariat machen könnte, teilte sie uns mit, sie wolle promovieren. In den darauffolgenden Jahren war ein Posten in der Richterschaft ihr erklärtes Ziel, doch als sie die Doktorarbeit beendete, gab sie umgehend bekannt, sie plane, bei ihrem Professor zu bleiben und eine akademische Laufbahn einzuschlagen. Schließlich beschloss sie, Staatsanwältin zu werden. Doch als sie ihr Referendariat in einer bekannten Anwaltskanzlei absolvierte, entdeckte sie plötzlich die schönen Seiten dieses Berufs und entschied sich nun endgültig dafür.
Wer mich kennt, der weiß, dass mein großer Traum in Bezug auf meine Tochter immer der war, sie eines Tages als Staatsanwältin zu bewundern. Vielleicht war dieser Wunsch eine väterliche Spinnerei. Doch selbst wenn man diese Spinnerei als »elterliche Sünde« bewerten wollte, so habe ich sie Katerina nie aufgezwungen. Ganz im Gegenteil, als sie ihre endgültige Entscheidung kundtat, dachte ich, [16] vielleicht sei es realistischer, eine Laufbahn als Rechtsanwältin anzustreben, als in muffigen Gerichtssälen zu versauern. Mein Traum, ihr bei der Verurteilung von Straftätern zuzusehen, die ich ihr zuführte, war ohnehin unerfüllbar, da ich nicht der Abteilung für Wirtschaftskriminalität angehöre. Und als Richterin hätte sie sich ihr halbes Leben mit ungedeckten Schecks und unbezahlten Kreditkartenrechnungen herumschlagen müssen.
Hinzu kam Adrianis Freude, als sie erfuhr, dass ihre Tochter schließlich doch noch Rechtsanwältin würde. Als Polizistengattin hat sie für das Arbeitgeberduo Ministerium für öffentliche Ordnung und Justizministerium nicht viel übrig. Nachdem Katerina sich zum Jurastudium entschlossen hatte, um ihr berufliches Leben mit Dieben, Betrügern und anderen Delinquenten zu verbringen, lag es Adrianis Meinung nach auf der Hand, auf Seiten der Verbrecher zu stehen, nicht auf Seiten des Staates, denn es sei einträglicher, Straftäter freizubekommen, als sie einzusperren. Diesen Gedankengang kann ich nach wie vor nicht nachvollziehen.
Das ganze Hin und Her, die umgeworfenen Entschlüsse, Meinungswechsel und Rückzugsgefechte fanden ein glückliches Ende, als Katerina uns verkündete, Fanis und sie hätten beschlossen zu heiraten. Adriani hüpfte vor Freude.
»Endlich! Mir fällt ein Stein vom Herzen. Warum sollte ein so schönes Paar ohne kirchlichen Segen bleiben?«
»Kirchlicher Segen, nun ja«, entgegnete Katerina lachend.
»Wie, nun ja?«, wunderte sich Adriani. »Eine Trauung findet nun mal in der Kirche, mit Brautschleier, Priester und Trauzeugen statt.«
[17] »Bei uns geht’s auch ohne all das. Wir werden auf dem Standesamt heiraten.«
Adriani erstarrte förmlich unter dieser kalten Dusche. Sie brauchte gut fünf Minuten, um wieder zu ihrer Betriebstemperatur zu finden. Dann begann sie, Katerina alle Nachteile einer standesamtlichen Trauung aufzulisten. Zuerst wandte sie sich den materiellen Argumenten zu.
»Aber ins Standesamt kann man nur eine beschränkte Anzahl von Gästen einladen, und dann entgehen euch die ganzen Hochzeitsgeschenke. Wie wollt ihr euren Haushalt ohne Hochzeitsgeschenke einrichten?«
»Wir bleiben ohnehin noch in Fanis’ Zweizimmerwohnung. Ich bin noch im Referendariat, also leben wir nur von einem Gehalt. Einen Wohnungswechsel können wir uns derzeit nicht leisten. Und unsere zwei Zimmer bieten nicht mal genug Platz für uns beide, wie sollten wir da Hochzeitsgeschenke unterbringen?«
Danach mobilisierte Adriani das Argument, kirchliche Eheschließungen endeten nicht so häufig vor dem Scheidungsrichter.
»Wo heiraten denn mehr Paare? In der Kirche oder auf dem Standesamt?«, fragte Katerina.
»Na, in der Kirche natürlich.«
»Ergo gehen auch die meisten Scheidungen auf kirchliche Trauungen zurück.«
Adriani sah, dass sie auch damit nicht landen konnte, und brachte nun die Gefühlsebene ins Spiel. Sie fragte Katerina, ob sie je daran gedacht hätte, dass sie mit dieser Entscheidung den Eltern die Freude vorenthalte, sie als Braut zu sehen.
[18] »Auf dem Standesamt werde ich doch auch eine Braut sein. Ob man jetzt kirchlich oder standesamtlich heiratet: Braut bleibt Braut.«
»Eine Braut ohne weißes Hochzeitskleid?«, sagte Adriani wie zu sich selbst, als könne sie ihren eigenen Worten nicht trauen.
»Mama, genau das halte ich nicht aus!«
»Was hältst du daran nicht aus? Erklär mir das bitte mal!«
»Hochzeitskleid, Brautschleier, Brautsträußchen, Mandelkonfekt! Wir wollen aufs Standesamt, um die Beziehung offiziell abzusegnen, und zwar ohne vorheucheln zu müssen, dass wir angeblich unser gemeinsames Leben beginnen, wo wir doch schon zwei Jahre zusammenleben!«
»Denkst du gar nicht daran, dass dein Vater Polizeibeamter ist? Wie soll er seinen Kollegen erklären, dass seine Tochter die standesamtliche einer kirchlichen Trauung vorzieht? Mir scheint, du nimmst keinerlei Rücksicht auf deinen Vater.«
Katerina tat genau das, was sie immer tut, wenn Adriani sich als allerletztes Argument auf meine Profession beruft: Sie fragte mich direkt.
»Hast du damit ein Problem, Papa?«
Da fühlte ich zum ersten Mal, wie heftig ich mir immer schon gewünscht hatte, sie einst als Braut in die Kirche zu führen. Möglicherweise hatte Katerina, vernünftig besehen, recht. Vielleicht ist die Tradition mittlerweile überholt, dass die Mädchen zu Hause bleiben, bis sie ihr Vater dem künftigen Ehegatten, ihrem neuen Herrn und Gebieter, übergibt. Vielleicht war ich bei zu vielen Hochzeiten dabei gewesen, wo einer meiner Kollegen seine Tochter zumeist [19] einem jüngeren Kollegen entgegenführte, so dass ich automatisch davon ausging, in meinem Fall würde das genau s0 ablaufen. Jedenfalls spürte ich, wie sich mein Herz zusammenkrampfte, als ich sah, wie nach dem Traum, meine Tochter als Staatsanwältin zu erleben, sich nun auch mein zweiter Traum zerschlug. Es war einer jener wenigen Momente, wo ich Wut auf Katerina in mir hochsteigen fühlte.
»Katerina, sag mal: Wie oft warst du bei mir im Büro?«
Sie blickte mich überrascht an. »Keine Ahnung, oft.«
»Und ist dir dabei nicht aufgefallen, was über meinem Schreibtisch hängt?«
»Ein Christusbild.«
»Und wie oft bist du in Gerichtssälen gewesen?«
»Okay, ich hab’s kapiert. Auch dort hängt hinter dem Richter ein Christusbild.«
»Und bestehst du trotzdem darauf, standesamtlich und nicht kirchlich zu heiraten, wenn doch Tag für Tag hinter deinem Vater ein Christusbild hängt und du Tag für Tag in deinem beruflichen Umfeld darauf stößt?«
Wenn sie mich um meine Meinung fragt, ist sie normalerweise von vornherein sicher, dass sich meine Meinung mit ihrer deckt oder dass ich mit Ausflüchten antworten werde, die Adriani auf die Palme bringen, aber nicht sie. Diesmal hatte meine Antwort sie verwirrt, und sie schien nach einem Ausweg zu suchen.
»Papa, ich verstehe deine Einwände, aber das lässt sich doch regeln«, meinte sie schließlich.
»Und wie soll das gehen?«
»Wir können doch sagen, die Hochzeit findet in [20] Konstantinopel statt, weil es unser Traum war, im alten Zentrum des Griechentums zu heiraten. Das werden deine Kollegen besonders wertschätzen.«
Ich weiß nicht, worüber ich trauriger war: über die abschätzige Meinung, die sie über meine Kollegen hatte – als würden auch sie à la Despotopoulos über die Heimholung Konstantinopels delirieren –, oder über ihre halsstarrige und uneinsichtige Haltung. Letzteres machte mir jedoch wesentlich mehr Sorgen, in beruflicher wie in privater Hinsicht. Beruflich, da Katerina nun das Metier des Rechtsanwalts gewählt hatte, wo übertriebene Prinzipientreue und moralische Halsstarrigkeit eine Sackgasse bilden, die unweigerlich zum Misserfolg führt. Eine solche Haltung ist einem Staatsanwalt angemessen, doch diesen ihr so naturgemäßen Beruf wollte Katerina ja nicht ausüben. In all meinen Dienstjahren bei der Polizei habe ich hochnäsige und eingebildete, schleimige und dreist herumtricksende Rechtsanwälte erlebt, aber ein unbeugsamer Prinzipienreiter ist mir noch nie untergekommen.
Andererseits befürchtete ich, diese Starrköpfigkeit könnte mein Erbteil sein. In meinem ganzen beruflichen Leben habe ich immer meinen Kopf durchgesetzt, sei es auf direktem oder auf indirektem Wege, ohne Rücksicht auf Verluste und auf meine Gesundheit. Das kam mich schließlich teuer zu stehen, und vor Schlimmerem bewahrte mich nur die Tatsache, dass ich Gikas vor der Nase hatte, der sich immer wieder schützend vor mich stellte, nicht weil er mich besonders mochte, sondern weil er mich für die Drecksarbeit brauchte, damit er umso strahlender im Rampenlicht stehen konnte.
[21] Als ich nun dieselbe Starrköpfigkeit bei meiner Tochter diagnostizierte, dachte ich daran zurück, wie schwer ich es durch diese Eigenschaft gehabt hatte, und mir brach der kalte Schweiß aus, wie meine selige Mutter zu sagen pflegte, begleitet von einer irrealen Attacke von Schuldbewusstsein, da Katerina dieses Manko offenbar von mir hatte.
»Was sagen eigentlich Fanis’ Eltern zu alledem?«, fragte Adriani.
Katerina zuckte mit den Schultern. »Ich weiß nicht. Er wollte selber mit ihnen reden. Aber welches Problem sollten sie denn damit haben? Ist doch egal, wo wir heiraten: Fanis trägt sowieso denselben Anzug.«
Zu ihrer Starrköpfigkeit kam leider auch noch die falsche Einschätzung der Lage hinzu. Denn Fanis’ Eltern waren mordsmäßig wütend, dass die Hochzeit nicht in der Kirche stattfinden sollte, und selbstverständlich gaben sie Katerina die Schuld daran. Ich weiß nicht, ob Fanis die standesamtliche Heirat als Katerinas Wunsch dargestellt hatte, doch selbst im gegenteiligen Fall waren Prodromos und Sevasti der Meinung, Katerina hätte auf einer kirchlichen Zeremonie im Brautkleid bestehen müssen.
So geriet die standesamtliche Trauung zu einem Trauerspiel – wir waren verbittert und todunglücklich, Fanis’ Eltern machten lange Gesichter, und Katerina hatte immer noch nicht realisiert, wohin ihre Beharrlichkeit geführt hatte, und wusste nicht, was sie machen sollte. Am Ende der Zeremonie berührten Prodromos und Sevasti Katerinas Wange gerade mal so lang, dass die Illusion eines Kusses entstand. Genauso unterkühlt verhielten sie sich uns gegenüber. Nur mit Mühe und fast widerwillig brachten sie die [22] Glückwünsche über die Lippen. Offenbar sahen sie auch uns in der Verantwortung, da wir unserer Tochter nicht beigebracht hatten, bestimmte Grundsätze und Traditionen zu respektieren. Vielleicht wunderten sie sich sogar darüber, wie ich als Polizeibeamter meine Tochter so prinzipien- und disziplinlos erziehen konnte. Katerina war zum schwarzen Schaf gestempelt und wir zu schlechten Hirten.
Mir war das im Grunde herzlich egal, und auch die langen Gesichter der Schwiegereltern kratzten mich nicht, doch Adriani war verletzt. Als hätte die Enttäuschung über die standesamtliche Trauung nicht gereicht, kam nun die beleidigte Haltung der Schwiegereltern hinzu und verdarb ihr völlig die Laune. Sie aß nicht, sprach nicht, rief Katerina nicht an, und wenn ihre Tochter anrief, ließ sie sich verleugnen. So durchlebten wir nach der Hochzeit eine Zeit tiefer Melancholie.
Da erinnerte ich mich daran, was Katerina über Istanbul gesagt hatte. Die Hochzeit hatte zwar nicht dort stattgefunden, doch Adriani und ich konnten ja zusammen eine Städtereise unternehmen, um etwas Distanz vom Krisenherd zu gewinnen. Als ich Adriani den Vorschlag machte, fürchtete ich, sie würde bockig reagieren und ablehnen, doch sie blickte mich nur an und flüsterte, als könne sie gar nicht daran glauben: »Meinst du, das täte uns gut?«
Es war nicht schwer, sie davon zu überzeugen. Nur die Anreise mit dem Mirafiori kam für sie nicht in Frage.
»Dann bleibe ich lieber hier«, erklärte sie kategorisch. »Mir reicht es, dass ich auf der Hochzeit meiner Tochter im Regen stehen musste. Noch einmal halte ich so etwas [23] nicht aus. Und deine Rostlaube gibt unterwegs garantiert den Geist auf.«
Und so fanden wir uns in einem Reisebus wieder, um die Sehenswürdigkeiten Istanbuls zu bewundern: am ersten Tag das Chora-Kloster, am zweiten die Blaue Moschee und das byzantinische Aquädukt, und heute die Hagia Sophia.
Wir befinden uns gerade auf dem Rückweg von der Hagia Sophia, als ich die Ereignisse Revue passieren lasse. Ich blicke aus dem Busfenster, während die Fremdenführerin erläutert, dass die Brücke, die wir gerade überqueren, nach Atatürk benannt und – nach der Galata-Brücke – die zweite über das Goldene Horn sei, welche die Teile Istanbuls verbinde.
Adriani sitzt in den hinteren Reihen mit Frau Mouratoglou, der sympathischsten Person der ganzen Reisegruppe. Sie stammt aus Istanbul, doch ihre Familie war gleich nach den Ausschreitungen gegen die griechische Minderheit im September 1955 fortgezogen und lebt seit damals in Athen. Alle zwei Jahre unternimmt sie jedoch eine Reise nach Istanbul und kehrt als »Wallfahrerin« in »heimatliche Gefilde« zurück. »Andere unternehmen eine Wallfahrt nach Jerusalem, wieder andere nach Mekka, ich nach Konstantinopel«, meint sie lachend.
Adriani mag sie sehr und verbringt viel Zeit mit ihr, mit der Begründung: »Frau Mouratoglou hat Niveau. Das merkt man an der Kleidung, an ihrem Benehmen, einfach an allem.« Seit unserer Ankunft in Istanbul leidet Adriani an Stimmungsschwankungen, doch es gelingt ihr, vor allem während der Führungen, ihre Sorgen zu vergessen und sich von den Sehenswürdigkeiten bezaubern zu lassen. Doch [24] sobald wir allein im Hotelzimmer sind, kehrt ihre Niedergeschlagenheit zurück. Zugleich überkommt sie die Angst, dadurch auch mir die Stimmung zu verderben. Daher liegt ihr daran, ständig draußen unterwegs zu sein und bei einem Stadtbummel Ablenkung zu finden.
Der Reisebus hat die Brücke überquert und fährt auf eine Anhöhe, an deren linker Seite sich Werftanlagen befinden. Ich blicke von oben auf das Goldene Horn mit all den Motorbooten und Lastkähnen herab und auf die Tausenden von Autos auf der Küstenstraße, die auch wir gestern auf dem Weg zum Ökumenischen Patriarchat entlanggefahren waren.
»Diese Küstenstraße hat es früher nicht gegeben«, erzählt die Mouratoglou Adriani. »Nach Fener, Haliç oder Balat ist man mit kleinen Dampfern gefahren, die elend lange brauchten, weil sie an jeder Anlegestelle haltmachten. Die Reise auf diesen winzigen Spielzeugdampfern war immer vergnüglich. Außerdem hatten es die Leute damals noch nicht so eilig wie heute.«
Ich blicke auf die Moscheen am gegenüberliegenden Ufer, die in Reih und Glied zu stehen scheinen, bis das Panorama hinter den Häusern eines breiten, aber gesichts- und charakterlosen Boulevards verschwindet, wo einsturzgefährdete Ruinen Seite an Seite mit geschmacklosen modernen Billigbauten stehen. Im Erdgeschoss sind kunterbunt durcheinander allerlei Läden untergebracht: ein Krämer, ein Geschäft für Autoersatzteile, ein Teppich- und Strohwarenladen, dann wieder ein Dessousgeschäft und dazwischen immer wieder Imbissstuben, die Toast und Fruchtsaft anbieten.
[25] »Die Straße, auf der wir uns gerade befinden, ist der Tarlabaşı-Boulevard«, informiert uns die Fremdenführerin. »Tarlabaşı war einer der ethnisch gemischten Stadtteile Istanbuls. Hier lebten Griechen, Türken, Armenier und, in geringerer Zahl, Juden.«
»Ist das jetzt hier Beyoğlu?«, fragt der Feldherr a.D. die Fremdenführerin.
»Beyoğlu ist die türkische Bezeichnung, Herr General«, erklärt die Mouratoglou. »Die Konstantinopler Griechen nannten diese Gegend Pera. La grande rue de Péra. So wurde sie nicht nur von den hiesigen Griechen genannt, sondern auch von den Franzosen. Das sollten Sie im Gedächtnis bewahren, denn wenn Sie Konstantinopel zurückholen und die alten Namen wieder einführen wollen, müssen Sie sie schließlich kennen.«
Darauf tritt Schweigen ein, und keiner hat etwas hinzuzufügen. Ich sehe im Seitenspiegel das Gesicht der Fremdenführerin, die der griechischen Minderheit von Istanbul angehört. Sie hat das Mikrophon sinken lassen und blickt lächelnd auf die Straße hinaus.
Der Reisebus hat den Taksim-Platz erreicht und biegt in die Straße ein, in der unser Hotel liegt.
[26] 3
Die Mouratoglou hat uns in ein Restaurant geführt, das »Imbros« heißt und dessen Inhaber – wie zu erwarten war – von der gleichnamigen, ehemals von vielen Griechen bewohnten, seit 1923 türkischen Ägäisinsel stammt. Wir sitzen im Freien, an einer langgezogenen Straße, auf der es fast kein Durchkommen gibt, da in der Mitte die Tischchen der Mezzelokale und Imbisse von beiden Straßenseiten aufeinandertreffen. Auf dem Weg hierher haben wir eine Straße passiert, in deren Läden nur gebratene Muscheln angeboten wurden, ein Stück weiter trafen wir auf eine Reihe von Läden, die nur gefüllte Muscheln feilboten, und dann stieg uns der Duft von orientalischen Gewürzen, scharfer Wurst und geräucherten Meeräschen kitzelnd in die Nase, die vor den Lebensmittelgeschäften baumelten wie die Weintrauben an den Obstständen unserer Wochenmärkte. Ich weiß nicht, was mir nach meiner Rückkehr nach Athen am nachdrücklichsten in Erinnerung bleiben wird: die Hagia Sophia, der Bosporus oder die Düfte dieser Stadt.
»Na, so was, sind die Türken so unersättlich?«, fragt Adriani die Mouratoglou mit verwunderter Stimme.
»Die Türken sind keine großen Esser. Wir Konstantinopler Griechen verspeisen gut und gerne doppelt so viel«, ertönt hinter uns die Stimme des Wirts aus Imbros, den uns Frau Mouratoglou als »Herrn Sotiris« vorgestellt hat.
[27] »Was Sie nicht sagen!«, wendet Adriani ein. »Auf unserem Weg hierher war doch jeder zweite Laden ein Restaurant.«
»Den Türken liegt weniger am Essen als am genießerischen Probieren, Madame«, erläutert der Mann aus Imbros. »Der Türke hat gern zehn Teller vor sich, um stundenlang davon zu kosten. Ich muss sagen, ich ziehe die Griechen als Kundschaft vor.«
»Wieso?«, frage ich.
»Weil sie gieriger und daher leichter zufriedenzustellen sind. Man stellt ihnen einen ordentlichen Braten auf den Tisch, vielleicht noch ein Moussaka, und nach einer Stunde haben sie alles verputzt und lassen den Wirt in Ruhe. Bei den Türken muss man stundenlang Teller und kleine Pfännchen hin- und hertragen.«
Nach diesen Worten begibt er sich weiter zum Nebentisch, um einen etwa fünfundsechzigjährigen Mann zu begrüßen, der alleine isst. Sie scheinen sich zu kennen, denn der Wirt aus Imbros setzt sich an seinen Tisch und verwickelt ihn in ein Gespräch. Die Mouratoglou wiegt nachdenklich den Kopf, während sie dem Wirt hinterherblickt.
»Wenn Sie wüssten, wie viele derartige Speiselokale es in Pera gegeben hat, Herr Kommissar«, meint sie zu mir. »Und nicht nur in Pera, sondern auch auf den Inseln, in Mega Revma, in Therapia. Übriggeblieben ist nur Sotiris, vielleicht noch ein Restaurant in Therapia und ein drittes auf der Insel Prinkipos.«
»Wieso, wurden sie verkauft?«, fragt Adriani.
»Einige ja, oder die Wirte sind verstorben, und ihre Kinder wollten die Lokale nicht weiterbetreiben, da sie lieber nach Griechenland ausgewandert sind …«
[28] Zu meiner großen Erleichterung führt sie das Gespräch mit Adriani fort, die als treue Zuschauerin von TV-Schnulzen solch traurige Geschichten mag. Ich jedoch habe eine angeborene Abneigung dagegen, vergangener Größe und den guten alten Zeiten nachzuweinen. Ich lasse meinen Blick über die Tische schweifen. Alle sind besetzt, und die Gäste nippen an ihren Gläsern und unterhalten sich, doch es ist nur halb so laut wie in einer Athener Taverne, wo man sein eigenes Wort nicht versteht.
Hier sind die Gespräche an den Tischen von so gedämpfter Lautstärke, dass ich sogar mein Handy klingeln höre. Ich ziehe es aus der Jackentasche und muss feststellen, dass ich mich wieder einmal getäuscht habe. Das passiert mir nun schon mehrmals täglich. Immer wieder meine ich mein Handy zu hören, und ich hole es eilig hervor. Es könnte ja Katerina sein – doch jedes Mal werde ich enttäuscht. Seit wir sie am Vortag unserer Abreise über unsere Reise nach Istanbul in Kenntnis setzten, haben wir keinen Kontakt mehr – wir haben sie nicht angerufen, und sie uns auch nicht. Die Idee, es ihr kurzfristig mitzuteilen, stammte von Adriani. Katerina sollte merken, dass wir wegfahren, um die unangenehmen Erfahrungen rund um ihre Hochzeit zu vergessen. Wenn sich Adriani einmal in Verbitterung und Traurigkeit hineingesteigert hat, kann sie sich nur schwer wieder einkriegen. Katerina verstand den Unterton und wünschte uns eine gute Reise. Doch ihre Begleitung zum Flughafen bot sie uns nicht an.
Dieser Abschied trug noch mehr zur Unterkühlung unserer Beziehung bei und erfüllte mich mit Angst vor der künftigen Entwicklung der Dinge. Daher klingelt mir jetzt [29] ständig mein Handy im Ohr. Auch Adriani ist meine neue Liebe zum Handy aufgefallen, und sie verfolgt sie aufmerksam, aber kommentarlos.
Ich weiche ihrem Blick aus und sehe dabei, wie ein Mittsechziger sich erhebt und auf unseren Tisch zukommt. Er bleibt vor der Mouratoglou stehen und mustert uns, während wir darauf warten, dass er sich vorstellt. Das tut er aber nicht, sondern stellt unvermittelt die Frage: »Entschuldigen Sie, kommen Sie aus Griechenland?«
Der einfachste Weg, ins Gespräch zu kommen, ist beim Offensichtlichen anzusetzen. Die Mouratoglou denkt anscheinend dasselbe, denn sie entgegnet leicht ironisch: »Ganz recht. Und Sie?«
Der Mann überhört die Mouratoglou geflissentlich und fährt auf sehr zuvorkommende Weise mit seinen eigenen Fragen fort. »Entschuldigen Sie, dass ich Sie beim Essen störe, aber könnten Sie mir sagen, ob Sie mit dem Flugzeug oder mit dem Reisebus gekommen sind?«
»Mit dem Flugzeug aus Athen«, bringt die Stefanakou Licht ins Dunkel.
»Und wo wohnen Sie, wenn ich fragen darf?«
»Im Hotel Eresin in Taksim«, gibt die Mouratoglou Auskunft.
»Somit kann sie nicht mit Ihnen gefahren sein und auch nicht im Hotel wohnen«, sagt der ältere Herr mehr zu sich selbst als zu uns.
»Entschuldigung, ich bin Polizeikommissar, warum fragen Sie?«, mische ich mich etwas abrupt ein, da gewöhnlich ich es bin, der die Fragen stellt und nicht umgekehrt.
»Ich wollte wissen, ob eine alte Dame mit Ihnen gereist [30] ist, der man ein bisschen ansieht, dass sie vom Land kommt. Aber sie kann unmöglich aus Athen mit dem Flugzeug angereist sein. Vermutlich ist sie von Thessaloniki mit dem Reisebus gekommen.«
Wir blicken uns an und versuchen uns zu besinnen. Mehr der Höflichkeit halber, denn wir sind uns eigentlich sicher, dass keine solche Person der Reisegruppe angehört. Die Mouratoglou antwortet schließlich für uns alle: »Es tut mir leid, aber ich kann mich nicht an eine solche Mitreisende erinnern. Zu mir würde zwar das Alter, nicht jedoch das Erscheinungsbild passen«, fügt sie als kleinen Scherz hinzu. Enttäuscht kehrt der Unbekannte an seinen Tisch zurück, nachdem er sich bedankt und nochmals für die Störung entschuldigt hat.
Als wir wieder nach »Pera« kommen – wie die Mouratoglou den Stadtteil nennt –, ist es fast Mitternacht, doch der Verkehr ist noch genauso lebhaft wie um acht, als wir aufgebrochen sind. Die Leute besuchen nach wie vor die Geschäfte, die immer noch aufhaben, und zwar nicht nur die Schnellrestaurants, sondern auch die Buchhandlungen, die Musik- und die Klamottenläden.
»Nein, was für ein gewaltiges Menschenmeer!«, ruft Adriani aus und fügt eine ihrer historischen Sentenzen hinzu, auf die sie in solchen Fällen gerne zurückgreift: »Der Zug der Zehntausend!«
So ein Menschengewühl wie auf der Pera-Straße kurz nach Mitternacht trifft man in Athen weder auf der Panepistimiou-Straße noch auf dem Omonia-Platz zur Stoßzeit an. Die Menschenmenge in der Fußgängerzone ist so dicht, dass die Sichtweite der Spaziergänger gerade mal auf den [31] Rücken des Vordermannes beschränkt bleibt. Aus den Seitenstraßen strömen pro Minute mindestens zehn Menschen in die Fußgängerzone und bilden den Nachschub für die Cafés und Bars.
»War das immer schon so?«, fragt Adriani die Mouratoglou, die mit einem Lächeln antwortet: »Als wir die Stadt verlassen haben, hatte Istanbul gerade mal eine Million Einwohner, Frau Charitou. Nun sind es offiziell vierzehn, inoffiziell sechzehn und unter der Hand siebzehn Millionen. Aber hier pulsierte immer schon das Herz der Stadt, damals wie heute.«
»Sind Sie oft hierhergekommen?«, fragt Adriani weiter.
»Wir haben in Feriköy gewohnt, auf der anderen Seite des Taksim-Platzes, in der Nähe von Kurtuluş. Doch zum Einkaufen sind wir immer nach Pera gekommen.« Sie blickt sich kurz um und meint dann mit einem Anflug von Bitterkeit: »Doch der alte Glanz ist leider Gottes dahin, denn mittlerweile hat, genau wie in Athen, jede Wohngegend ihre eigenen Einkaufsstraßen.«
Jeder zweite Laden links und rechts der Straße ist ein Speiselokal. Nicht dass wir in Athen da zurückstünden, aber hier findet man keine Fastfood-Ketten oder Souflakibuden, sondern es sind ausschließlich Selbstbedienungsrestaurants, wobei hinter den in den Vitrinen ausgestellten Speisen Bedienstete mit strahlend weißen Schürzen und Kochmützen auf Kundschaft warten.
Ich sehe, wie Adriani auf die Vitrine eines Speiselokals zugeht. Anfänglich denke ich, sie möchte sich einen kleinen Nachschlag holen, da ihr vorhin im Lokal der ohnehin schon schwache Appetit bei meinem ständigen Liebäugeln [32] mit dem Handy zur Gänze vergangen war. Sie bleibt knapp vor der Vitrine stehen und inspiziert das Essen. Sie schwelgt im Anblick der in Öl geschmorten Speisen, in der Vielfalt der Hackfleischbällchen, der Pilaws und Fleischsorten, blickt zu den Gyrosspießen im Hintergrund und kann die Augen gar nicht mehr abwenden.
»Sie kochen wohl gerne, Frau Charitou?«, fragt die Mouratoglou.
»Woran haben Sie das gemerkt?«
»An Ihrem fachmännischen Blick.« Sie hält kurz inne und fügt dann zögernd hinzu: »In dem ein bisschen Neid aufscheint.«
Die Mouratoglou sagt es freundlich und ohne Hintergedanken, doch ich bereite mich schon darauf vor einzuschreiten, falls Adriani es in die falsche Kehle bekommt, damit wir uns nicht mit dem einzigen Menschen überwerfen, mit dem wir uns auf der Reise angefreundet haben. Doch ich habe Adriani wieder mal falsch eingeschätzt, denn sie erwidert lächelnd: »Alle guten Köchinnen sind neidisch, Frau Mouratoglou, und ich finde es schön, dass man das reiche Speisenangebot erst einmal ausgiebig begutachten kann.«
Wir gehen die Pera-Straße weiter hoch in Richtung Taksim-Platz, wobei wir uns immer wieder den Weg durch die dichte Menge bahnen müssen.
»Ihre Kollegen, Herr Kommissar«, flüstert mir die Mouratoglou zu und deutet auf die Straße zu meiner Linken.
Dort steht mindestens eine Einheit behelmter, mit Schutzschilden und Schlagstöcken ausgerüsteter Polizisten, welche die ganze Straße abgesperrt haben und beim kleinsten [33] Anlass bereit zum Eingreifen sind. Ich male mir aus, was wir, der Minister und die gesamte Regierung in Griechenland zu hören kriegten, wenn wir jeden Abend eine Einheit der Sondereinsatztruppe auf der Santarosa- oder der Charilaou-Trikoupi-Straße stationierten. Wohl die ganze Bandbreite vom zärtlichen »Bullen« über das verächtliche »Faschisten« bis zum gejohlten »Polizeistaat«.
»Sind die jeden Abend hier, oder gibt es heute einen besonderen Anlass?«, frage ich die Mouratoglou.
»Ich bin zwar nicht jeden Abend hier, wie Sie wissen, aber ich sehe sie jedes Mal, wenn ich hier vorbeikomme.«
Auf dem Taksim-Platz verläuft sich das Gedränge, genauso wie auf dem Syntagma-Platz in Athen. Und wir überqueren den Platz und biegen links ein zu unserer Bleibe, dem Hotel Eresin.
Die Reihenfolge, wer wann ins Badezimmer geht, hat sich zwischen Adriani und mir schon im ersten Monat nach unserer Hochzeit eingependelt. Ich gehe zuerst, weil es bei mir schneller geht, und dann folgt Adriani und kann sich alle Zeit der Welt lassen. Wir sind so aufeinander eingespielt, dass sie errät, wann ich fertig bin und ihrerseits schon parat steht.
So auch heute Abend, nur dass sie vor dem Eintreten ins Badezimmer an der Tür innehält und mich anblickt. »Das Verhalten unseres Töchterchens liegt dir wieder auf dem Magen«, sagt sie.
»Stimmt. Dir etwa nicht?«
Sie scheint nachzudenken und antwortet nicht sofort. »Ihre trotzige Haltung geht mir an die Nieren«, meint sie dann.
»Trotzige Haltung?«
[34] »Komm schon, jetzt stell dich nicht dümmer, als du bist. Diese Halsstarrigkeit, dass sie lieber unseren Seelenfrieden – samt dem von Fanis und seinen Eltern – aufs Spiel setzt, als einmal darauf zu verzichten, ihren Kopf durchzusetzen. Völlig abgesehen davon, dass sie auf mich überhaupt keine Rücksicht nimmt. Auf dich übrigens auch nicht, wo du doch ihr großer Liebling bist. Und jetzt setzt sie dieses verbohrte Verhalten fort, indem sie nicht einmal anruft. Eines sage ich dir. Wenn die Eltern so einen Dickkopf nicht aushalten, wie dann Fanis? Da darf man sich nicht wundern, wenn in ein paar Jahren die Scheidung ins Haus steht. Und man muss hoffen, dass sie dann noch kein Kind haben, weil so ist es ja Mode geworden: Zuerst setzt man ein Kind in die Welt, dann trennt man sich, und dann halst man es der Großmutter auf, die es aufziehen soll.«
»Rede doch das Unglück nicht herbei!«, rufe ich außer mir. »Sie hat doch gerade erst geheiratet!«
»So, wie sie geheiratet hat, zählt es sowieso nicht, aber um die Scheidung kommt man trotzdem nicht herum.« Wenn Adriani so richtig wütend ist, findet sie, sowie man den Mund aufmacht, stets ein schlagendes Gegenargument.
»Wir könnten ja anrufen und das Schweigen brechen.«
»Wie soll ich denn mit Katerina reden, wenn ich insgeheim Fanis’ Eltern recht gebe und genauso enttäuscht bin von ihr wie sie?«
»Ich könnte ja mit ihr sprechen.« Doch sogleich bereue ich meinen Vorstoß, denn ich weiß, was nun folgt.
»Na klar, du und dein Töchterchen«, schreit sie. »Immer macht ihr alles untereinander klar, und ich bin außen vor. Und wenn ich manchmal wage, ein wenig Druck auf sie [35] auszuüben, um ihr ein paar nützliche Dinge beizubringen, stellst du dich gleich schützend vor sie. Einmal war es die Schule, dann das Studium, dann wieder das Doktorat. Egal, ob sie nun Hausfrau, Rechtsanwältin oder Ministerin wird – hättest du mich nur gelassen, ihr ein paar grundlegende Dinge ans Herz zu legen, wäre es nicht so weit gekommen. Denn ich bin es, die jetzt alles ausbaden muss. Doch du hast es ja so gewollt.«
Wir haben ganz vergessen, wo wir uns befinden, und schreien uns an, als wären wir in unseren eigenen vier Wänden, als nebenan ein Hotelgast an die Wand hämmert, damit wir den Mund halten. Jäh verstummen wir und blicken uns erschrocken an. Adriani schlüpft eilig ins Bad, als wolle sie sich vor den unsichtbaren tadelnden Blicken verstecken. Und ich lege mich aufs Bett, drehe mich zur Seite und hefte den Blick auf das Fenster gegenüber. Schon allein diese Körperhaltung lässt eine weitere schlaflose Nacht erwarten.
[36] 4
In der Kirche enden die Vigilien immer mit der Frühmesse, während unsere Nachtwache in einem Schweigegelübde gipfelt. Am Morgen stehen wir wortlos auf, kleiden uns stumm an, dann geht Adriani hinunter zum Frühstück, immer noch schweigsam. Ich überlege, mir einen Kaffee aufs Zimmer zu bestellen, um sowohl ihrer finsteren Miene als auch der frühmorgendlichen Gier der übrigen Reiseteilnehmer zu entgehen, die mit turmhoch beladenen Tellern vom Büfett an ihren Tisch zurückkehren.
Doch dann überlege ich, dass ich mir dadurch einen Genuss entgehen lasse, den ich jahrelang vermisst habe. Beim Frühstück gibt es alles Mögliche, nur keine Croissants. Als ich das am ersten Tag feststellte, atmete ich erleichtert auf. So würde ich zumindest nicht an das Croissant erinnert, das ich jeden Morgen an meinem Schreibtisch esse. Dagegen gab es hier meine geliebten Sesamkringel, die mich an die guten alten Zeiten erinnerten, als wir in der Dienststelle noch ein zünftiges Gabelfrühstück zu uns nahmen, unsere Sesamkringel durchschnitten und mit einer hauchdünnen Scheibe Käse belegten. Seit dieser Entdeckung esse ich jeden Morgen genüsslich einen Käsekringel zum Frühstück. Und darauf will ich auch heute nicht verzichten. Ich lasse mich doch nicht von Adriani ins Zimmer verbannen, nur weil ich eine Schwäche für meine Tochter habe.
[37]