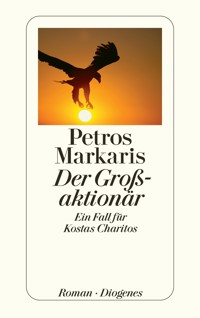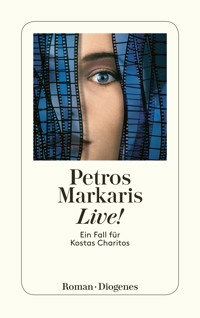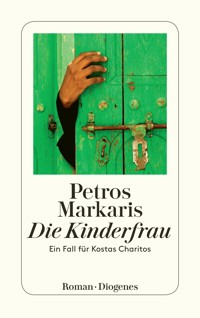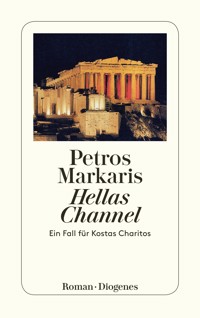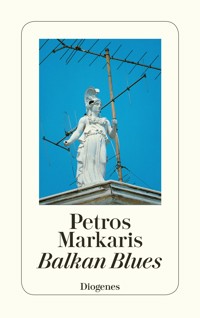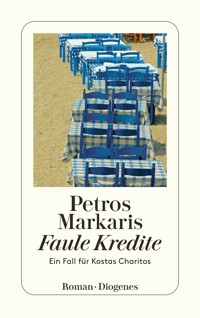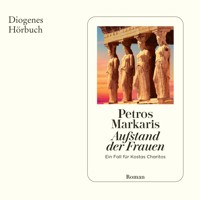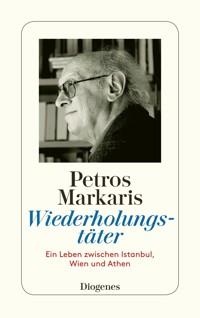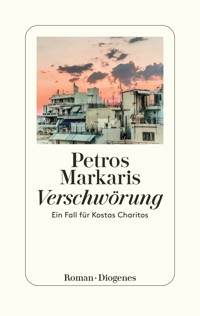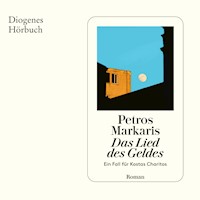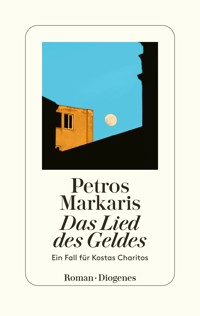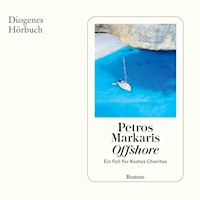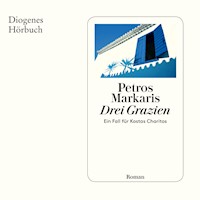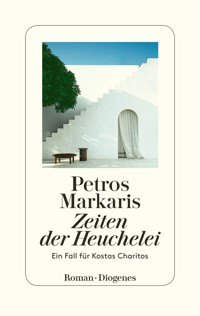9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Kostas Charitos
- Sprache: Deutsch
Kommissar Charitos ist krank. Eigentlich sollte er sich ausruhen und von seiner Frau verwöhnen lassen. Doch so etwas tut ein wahrer Bulle nicht. Eher steckt er bei Hitze und Smog im Stau, stopft sich mit Tabletten voll und jagt im Schritttempo eine Gruppe von Verbrechern, die die halbe Halbwelt Athens in ihrer Gewalt hat.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 597
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Petros Markaris
Nachtfalter
Ein Fall fürKostas Charitos
Roman
Aus dem Neugriechischen vonMichaela Prinzinger
Titel der 1998 bei
Samuel Gavrielides Editions, Athen,
erschienenen Originalausgabe: ›Amyna Zonis‹
Copyright © 1998 by Petros Markaris
Der Text wurde für die 2001 im Diogenes Verlag
erschienene deutsche Erstausgabe
in Zusammenarbeit mit dem Autor
nochmals durchgesehen
Umschlagfoto: Tono Stano, ›Sense‹, 1992
Copyright © 1992 by Tono Stano
Für Josefina
Alle Rechte vorbehalten
Copyright © 2013
Diogenes Verlag AG Zürich
www.diogenes.ch
ISBN Buchausgabe 978 3 257 23353 7 (14.Auflage)
ISBN E-Book 978 3 257 60324 8
Die grauen Zahlen im Text entsprechen den Seitenzahlen der im Impressum genannten Buchausgabe.
[5] Alle modischen Laster gelten als Tugenden
Molière, Don Juan, 5. Akt, 2. Szene
[7] 1
Die Erschütterung ist fast unmerklich. So, als ob jemand im oberen Stockwerk hin und her liefe.
»Ein Erdbeben!« kreischt Adriani. Bei Hungersnöten, Erdbeben und Unwettern ist sie in ihrem Element.
»Ach was, reine Einbildung!« sage ich, während ich den Blick von Dimitrakos’ Wörterbuch hebe, wo ich gerade den Eintrag zum Wort Sommerfrischler durchlese.
Wir sind auf die Insel gekommen, um unseren Urlaub hier zu verbringen, und wohnen bei Adrianis Schwester. Ich ließ mich nur halbherzig darauf ein, weil ich ungern irgendwo zu Gast bin, wo ich mich nicht richtig gehenlassen kann. Aber erstens wollte Adriani ihre Schwester besuchen, und zweitens müssen wir unseren Gürtel in diesem Jahr ohnehin enger schnallen, wegen des Studiums unserer Tochter Katerina in Thessaloniki. Nicht einmal ein Zimmer mit Außentoilette – ein room to let, wie auf jedem ehemaligen Ziegenstall der Insel zu lesen steht – können wir uns leisten. Geschweige denn ein Bed & Breakfast, wie sich Adriani ausdrückt. Früher gab es Ziegenställe und Ziegen. Heute nur mehr Ziegenställe und Touristen.
[8] Das Haus ist zweistöckig, liegt aber nicht direkt am Meer, sondern auf einer Anhöhe im Landesinneren, unweit des Hauptortes der Insel. Mein Schwager hat es mit seinem Bruder im goldenen Zeitalter der EU-Subventionen für die griechische Landwirtschaft gebaut. Mein Schwager ist Schmied, sein Bruder betreibt ein Kafenion – also weit und breit keine Beziehung zum stolzen Bauernstand. Sie hatten aber ein Stück Acker von ihrem Vater geerbt, ließen es durch irgendwelche Albaner bestellen, sackten die Ernte ein und kassierten die Subventionen. So kamen sie zu einem Mehrfamilienhaus. Wenn man die Schicht Ziegel mit dem bißchen draufgepappten Verputz überhaupt Haus nennen kann.
Am ersten Nachmittag hatte ich mich ein Stündchen aufs Ohr gelegt, als ich plötzlich von einem mächtigen Krawall aufgeweckt wurde. Das Haus wurde bis in die Grundfesten erschüttert, und eine weibliche Stimme schrie: »Ach… ach… ach…!« Da mir mein Polizistendasein in Fleisch und Blut übergegangen ist, dachte ich zunächst, der Bruder meines Schwagers würde seine Frau schlagen. Ich brauchte eine Weile, um zu begreifen, daß er sie nicht schlug, sondern vögelte und ich durch ihr Stöhnen aus dem Schlaf gerissen worden war.
»Psst, du wirst doch nicht horchen, schäm dich!« zischte mir Adriani zu, die eine schlüpfrige Phantasie hat, weshalb sie sich auch in der Fastenzeit streng kasteit.
»Vier Uhr nachmittags – wie bringt er sich um die Zeit bloß in Stimmung?«
»Ja, begreifst du denn nicht? Die Kinder sind gerade außer Haus.«
[9] Die besagten Kinder sind zwei Jungen – ein Steppke von ungefähr zehn und ein Dreikäsehoch von ungefähr acht Jahren, die beide Basketballspieler werden wollen. Und ihr Herr Papa hatte im Fernsehen von den Millionen gehört, die man als langer Lulatsch einstreichen kann, egal welcher Nationalität man angehört. Also hat er ihnen einen löchrigen Korb im Wohnzimmer aufgestellt, damit sie lernen, von der Glasvitrine wie von einer unsichtbaren Dreipunktelinie aus Würfe auszuführen. Das Training war hart, zweimal täglich, morgens und abends, mit Ball- und Sprungübungen, Geschrei und Geschimpfe. Ich verkrümelte mich regelmäßig und setzte mich in das Kafenion ihres Vaters, wo ich für eine Tasse Kaffee einen Fünfhunderter hinblättern mußte, statt Schmerzensgeld zu erhalten.
An das Getrappel des Basketballtrainings gewöhnt, sage ich zu Adriani, das Erdbeben bilde sie sich bloß ein. Aber die weitere Entwicklung straft mich Lügen. Das Haus löst sich nämlich von seinen Grundmauern, schwebt unentschlossen in der Luft und stürzt mit einem schrecklichen Krachen wieder auf den Boden. Das Bild mit den beiden Schäfchen an der Quelle knallt herunter, während die beiden über dem Bild hängenden Ziegenglocken wie wild bimmeln.
Das Erdbeben hält einen Augenblick inne, um mit neuerlicher, noch größerer Wucht wieder einzusetzen. Das Haus erzittert, und die Möbel rutschen hin und her. An der Wand gegenüber klafft mit einem Mal ein riesiger Riß und bietet einen so dramatischen Anblick, als wollte sich der Peloponnes vom Festland lösen. Mauerbrocken stürzen [10] auf die bordeauxrote Sitzgarnitur mit Goldstreifen im Wohnzimmer, die mein Schwager bei einer Billigkette erstanden hat. Die Wand begräbt bei ihrem Einsturz die pseudokorinthische Vase mit den vergoldeten Artischocken unter sich, während der von der Decke baumelnde, mehrarmige Leuchter wie ein Weihrauchkessel aussieht, den ein Pope lässig hin- und herschwenkt.
Adriani fährt aus ihrem Sessel hoch und rennt unter den Türrahmen.
»Was soll das denn?« rufe ich.
»Bei einem Erdbeben soll man sich immer unter den Türrahmen stellen. Das ist der einzige Teil, der stehenbleibt«, sagt sie zitternd.
Ich werfe den Dimitrakos von mir, packe sie an der Hand und schleife sie zur Haustür, während die Zimmerwände mal aufeinander zustürzen, mal wieder ins Lot kommen.
Als wir durch die Tür stolpern, löst sich gerade ein Teil des Daches. Ich spüre, wie die Splitter um mich herumfliegen und Tausende kleiner Nadelstiche meine Haut durchdringen.
Kaum haben wir das Haus verlassen, höre ich eine Frauenstimme rufen: »Hilfe! Hilfe!«
»Lauf bloß schnell weg!« rufe ich Adriani zu und laufe in Richtung der Stimme.
Stawria, die Frau des Bruders meines Schwagers, steht auf der Treppe. Sie hält ihre beiden Jungen fest an der Hand und schreit hysterisch um Hilfe.
»Die Kinder, Kostas! Nimm die Kinder!«
Ich spüre beim Hinaufgehen, wie die Treppe bedrohlich zittert, als würde sie jeden Augenblick unter mir [11] zusammenbrechen. Ich packe die beiden Kinder, doch der Dreikäsehoch beginnt heftig nach mir zu treten.
»Mein Ball, ich will meinen Ball haben!«
»Jetzt ist nicht der Augenblick zum Ballspielen«, sage ich zu ihm, doch er läßt nicht davon ab, meine Schienbeine zu traktieren und nach seinem Ball zu schreien.
»Macht schon, ich werf euch den Ball runter!« ruft Stawria von oben.
»Bleib bloß draußen!« rufe ich, doch sie ist bereits im Inneren des Hauses verschwunden.
Sobald wir die letzte Treppenstufe erreichen, kommt der Ball hinter uns hergeschossen. Der Dreikäsehoch läßt meine Hand los und will ihn an sich reißen, während ein fürchterlicher Krach von berstendem Glas und Stawrias klagende Stimme aus dem Haus dringen.
»Mein Leuchter!«
Schlagartig hört das Beben auf, anscheinend legt es eine kleine schöpferische Pause ein. Stawria tritt mit zerrauften Haaren auf die Türschwelle. »Mein Leuchter ist hin!«
Sie besitzt den gleichen Leuchter wie mein Schwager. Keine Ahnung, warum sie die im Doppelpack gekauft haben. Vielleicht, um die Osternacht zu Hause zu feiern. Man schaltet sie ein, zündet seine Osterkerzen an, tauscht den Gruß »Christus ist auferstanden« aus und erspart sich die Mühe, dreihundertfünfzig Stufen bis zur Höhlenkapelle der Heiligen Jungfrau hochzujapsen.
»Jetzt laß mal den Leuchter und komm runter, bevor es mit dem Erdbeben wieder losgeht«, sage ich.
Sie würdigt mich keines Blickes. Sie sitzt auf dem Treppenabsatz und kämpft mit den Tränen.
[12] »Ist der Basketballkorb heil geblieben?« fragt der Knirps voller Besorgnis.
»Dein Basketballkorb ist mir Wurscht«, entgegnet sie wie ein bockiges Kind.
»Jedenfalls: Der letzte Korb, den du geworfen hast, zählt nicht. Du hast mich gefoult«, sagt der Steppke zum Dreikäsehoch.
[13] 2
Der Marktplatz des Inselhauptortes liegt etwas erhöht und sieht wie das Konzertpodium einer dörflichen Blaskapelle aus. Drei Sträßchen kreuzen sich auf dem Marktplatz. Das eine schlängelt sich aus dem Ort hinaus, das zweite führt zur Endhaltestelle der Buslinie, die zwischen dem Hafen und dem Hauptort verkehrt, und das dritte endet vor der Kirche. In den engen Gassen rund um den Marktplatz spielt sich das gesamte Leben des Ortes ab – im unmittelbaren Umfeld eines Tante-Emma-Ladens, einer Gemüsehandlung mit Fleischtheke und eines Geschäfts, in dem von Kunsthandwerk bis zu Gummistiefeln alles zu finden ist. Dann sind da noch das Kafenion des Bruders meines Schwagers, eine Taverne, ein altmodischer Biergarten und zwei Souflakibuden, wovon sich die eine einen internationalen Anstrich gibt, die andere auf griechisches Flair setzt. Die internationale Souflakibude unterscheidet sich von der griechischen darin, daß ihr Namensschild sie nicht als »Grillstube« ausweist, sondern hochtrabend als »Souflaquerie« bezeichnet. Augenscheinlich glaubt der Wirt, die vielen französischen Touristen so auf seine Seite ziehen zu können. Vermutlich ein Schlag ins Wasser, denn die griechischen Gäste ziehen die einheimische Grillstube der Souflaquerie vor, und die Franzosen, die möglicherweise der Souflaquerie den Vorzug gegeben hätten, können [14] das Schild nicht lesen, da es mit griechischen Buchstaben geschrieben ist. Die Läden auf dem Marktplatz sind die einzigen, die bei dem Erdbeben keinen Schaden davongetragen haben, da sie eng aneinandergebaut sind. Ihr Zusammenhalt hat sie vor dem Schlimmsten bewahrt.
Es sind drei Stunden vergangen, seitdem ich mit Adriani ins Freie gestürzt bin. Ich sitze auf dem Blaskapellenpodium, gegenüber der Souflaquerie. Das Schild kann ich nicht erkennen, weil es stockdunkel ist. Licht und Telefon sind ausgefallen. Aus den Transistorradios erfahren wir, daß sich das Epizentrum in der Gegend von Kreta befand und das Erdbeben die Stärke von 5,8Grad auf der Richter-Skala erreicht hat. In den vergangenen drei Stunden haben die Inselbewohner siebenunddreißig Erdstöße gezählt, doch um den letzten ist ein heftiger Streit ausgebrochen. Die eine Hälfte der Insulaner behauptet, er müsse mitgezählt werden, während die andere Hälfte meint, er bilde bloß eine kleine Draufgabe zur vorletzten Erschütterung. Sie reden sich also die Köpfe heiß, um nur ja keine Möglichkeit ungenutzt zu lassen, sich in ihrem Unglück zu suhlen.
»Beim Erdbeben von Kalamata wurden innerhalb von drei Stunden zweiundfünfzig Erdstöße gezählt«, sagt einer, der neben mir auf dem Gehsteig sitzt, als wäre er traurig darüber, daß seine Insel nicht in Führung liegt.
Der ganze Ort hat sich auf dem Marktplatz versammelt. Etliche sitzen auf den Stühlen der Taverne oder des geschlossenen Biergartens, andere im Kafenion des Bruders meines Schwagers, das geöffnet hat und Limonade, Coca-Cola und Eiskaffee ausschenkt. Wer sich keinen Sitzplatz in den Lokalen sichern konnte, spaziert zwischen den [15] umhertollenden, Ball spielenden Kindern über den Platz. Der Krach ist ohrenbetäubend, da nicht nur die Kinder kreischen, sondern sich auch die Erwachsenen lautstark vom Kafenion quer über den Platz, vom Platz zur Taverne und von der Taverne in den Biergarten hinüber unterhalten. Nur in den beiden Souflakibuden klingelt die Kasse. Die Kinder sind hungrig, und es gibt sonst nirgendwo etwas zu essen. Die Souflakibuden haben Holzkohle zum Glühen gebracht und brutzeln eifrig Fleischspießchen, die sie mit einer Scheibe Landbrot verteilen. Zum Schluß geht ihnen das Brot aus, und sie servieren das Fleisch ohne Beilage. Nur das Holzkohlenfeuer erhellt den Marktplatz.
Die wenigen Touristen, die im September noch übriggeblieben sind, wurden vom Marktplatz verdrängt und haben sich zur Bushaltestelle geflüchtet. Liebend gerne würden sie abreisen, doch der dort abgestellte Bus wagt nicht loszufahren, und sie trauen sich nicht, in die Häuser zurückzukehren und ihre Sachen zu holen. Einige haben sich vor den Souflakibuden angestellt, doch sie kommen nicht zum Zuge, weil die Einheimischen sich ständig vordrängeln.
Es wird immer später, und die Erdstöße wollen nicht enden, da lähmt die Angst schließlich auch die Schreihälse, und der Lärm ebbt ab. Als wäre das alles nicht schon Unglück genug, setzt auch noch ein dünner Nieselregen ein, der neues Protestgeschrei hervorruft. Der Kombi der Stromgesellschaft fährt zum vierten Mal mit quietschenden Reifen vorbei und hupt wie wild, um die Leute von der Straße zu scheuchen.
»He, Lambros, was ist? Wann haben wir wieder Strom?« fragt der Mann neben mir den Beifahrer des Wagens.
[16] »Stell dich lieber auf eine längere Wartezeit ein. Das Kabel ist beschädigt, und das kann dauern«, entgegnet der andere, zufrieden, daß diesmal der Strom mit gutem Grund ausfiel und nicht wie sonst zweimal täglich ohne ersichtlichen Anlaß.
»Schämt ihr euch denn gar nicht, ihr Schmarotzer!« ruft mein Nachbar hinter dem Wagen her.
Er würde gerne weiterschimpfen, doch eine heftige Erschütterung bringt ihn aus dem Gleichgewicht, und er rutscht vom Gehsteig. Ein Gezeter unterschiedlichster Stimmlagen erhebt sich über dem Marktplatz. Es reicht vom »Hoppla, schon wieder!« der Mutigsten bis zum hysterischen Gekreische der Frauen.
»Ach, da bist du ja! Wir suchen dich schon auf dem ganzen Marktplatz«, höre ich Adrianis Stimme neben mir.
Sie ist in Begleitung von Eleni, ihrer Schwester, und Aspa, Elenis Tochter, die in die dritte Klasse des Gymnasiums geht und ein besonnenes, aufgewecktes Mädchen und das sympathischste Mitglied der Familie meiner Schwägerin ist.
»Ist alles in Ordnung?« frage ich Eleni, mehr aus Pflichtbewußtsein als aus echter Sorge, da ich ja sehe, daß mit ihr alles in Ordnung ist.
»Sei still, ich zittere immer noch am ganzen Leib. Ich war im Ortsverschönerungsverein, wir wollten unsere Vorgangsweise gegen Theologou, diesen Gauner, besprechen. Der will nämlich ein Hotel am Kap bauen und sich den ganzen Strand unter den Nagel reißen. Da merke ich plötzlich, wie der Boden unter meinen Füßen nachgibt! Bis ich bei der Schule angekommen bin, um Aspa in Sicherheit zu bringen, habe ich Höllenqualen durchlitten!«
[17] »Du hast das Unglück herbeigeredet! ›Wieso fahren wir denn weg, zu Hause ist es doch viel schöner, wozu brauchen wir Urlaub…‹ Wie hätte es da nicht zu einem Erdbeben kommen sollen, wenn man ständig lamentiert?« sagt Adriani zu mir, und mit einem Mal finde ich mich in der Rolle des Sündenbocks wieder, der das Erdbeben verursacht hat.
Ich bin knapp davor, aus der Haut zu fahren. Wäre sie auf meinen Vorschlag eingegangen, doch lieber zu Hause zu bleiben, müßte sie jetzt auch nicht in den traurigen Trümmerhaufen nach unserer Unterwäsche stöbern. Plötzlich spüre ich einen bohrenden, stechenden Schmerz im Rücken und springe auf.
»Was hast du? Wieder die Schmerzen?« fragt mich Adriani, die seit fünfundzwanzig Jahren jede meiner kleinsten Bewegungen mit Argusaugen verfolgt. »Geschieht dir recht, wenn du nicht zum Arzt gehst. Du zahlst vollkommen umsonst so hohe Beiträge an die Krankenkasse.«
»Sie hat recht, warum gehst du mit deinen Schmerzen nicht zum Arzt?« mischt sich Eleni ein.
»Weil er Angst davor hat wie alle Männer! Ein gestandener Hauptkommissar, Leiter der Mordkommission, der den ganzen Tag mit Mördern und Messerstechern zu tun hat, fürchtet sich vor dem Doktor!«
»Es ist nur ein eingeklemmter Nerv. Ich renn doch wegen eines eingeklemmten Nervs nicht gleich zum Arzt.«
«Ach, die Diagnose hat er auch schon parat«, sagt Adriani verächtlich.
Das ganze Gespräch findet unter leichten Erdstößen statt, als befänden wir uns auf einem schaukelnden [18] Tragflügelboot, und der Nieselregen wird langsam stärker. Seit einem Monat etwa taucht dieser plötzliche, heftige Schmerz in der linken Schulter auf, zieht sich in meinen Arm hinunter und klingt nach zehn Minuten wieder ab. Ich gehe nicht zum Arzt, da man immer, wenn man nachbohrt, mehr zutage fördert, als einem lieb ist.
Ich höre auf, daran zu denken, nicht weil ich einen so eisernen Willen hätte, sondern weil sich auf dem Marktplatz ein aufrührerisches Geheul erhebt. Ich wende mich um und sehe, wie der Bürgermeister auf das Konzertpodium steigt und auf die Menge einzureden versucht.
»Ruhe! Laßt mich doch zu Wort kommen!« ruft er, und der Tumult beruhigt sich etwas. »Ich habe mit der Präfektur gesprochen. Zelte und Wolldecken sind unterwegs«, ergänzt er zufrieden, doch seine Befriedigung bricht sogleich wieder in sich zusammen, da die Nachricht die Menge eher aufbringt als beruhigt.
»Wann werden sie das alles schicken? Nächstes Jahr?«
»Wir harren jetzt schon fünf Stunden im Finstern aus, sind vollkommen durchnäßt, und du kommst daher und willst uns weismachen, daß die Sachen unterwegs sind?« Mit Betonung auf dem »unterwegs«.
»Ist dir klar, daß die Leute in Kalamata noch heute, zehn Jahre danach, in Wohnwagen hausen?«
»So ein Staat kann mir gestohlen bleiben! Die können doch nur Steuern aus einem rauspressen!«
Der Bürgermeister nimmt noch einen Anlauf. »Habt etwas Geduld, Leute! Wir sind nicht die einzigen, die schlimm dran sind.«
»Wir sind zwar nicht die einzigen, aber wir werden [19] die letzten sein, die Hilfe erhalten. Dank deines Einsatzes!«
»Ich hab’s immer gesagt, wir hätten ihn nicht wählen sollen, doch ihr habt ja nicht auf mich gehört«, sagt jemand unüberhörbar zu seinem Nachbarn.
»Sie werden bestimmt kommen, ihr habt mein Wort«, versichert ihnen der Bürgermeister, beunruhigt darüber, daß er Stimmen zu verlieren beginnt. Er sucht Halt und findet mich in der Menge.
»Sehen Sie, was wir alles am Hals haben, Herr Kommissar? Es ist die reinste Odyssee, bis etwas hierher gelangt. Leider begreifen Ihre Kollegen in Athen das nicht.«
»Die Leute hier haben nicht unrecht«, mischt sich Adriani ein, die sich darin gefällt, streunende Katzen und Hunde sowie Recht- und Heimatlose zu verteidigen, solange sie sie nicht im eigenen Haus beherbergen muß. »Warum schicken Sie keinen Hubschrauber los, um die Sachen zu holen? Sie haben doch einen Hubschrauberlandeplatz auf der Insel.«
»Wir haben zwar einen Hubschrauberlandeplatz, liebe Frau«, sagt der Bürgermeister und schüttelt betrübt den Kopf. »Aber keinen Hubschrauber. Man hat den Landeplatz errichtet, und seit sechs Jahren warten wir auf den Hubschrauber. Wenn es einen Notfall gibt, kommt ein Hubschrauber aus Athen.«
Es scheint jedoch, daß ihm heute niemand recht geben will, denn kaum hat er seine Worte zu Ende gesprochen, bricht der Fluglärm eines Hubschraubers über uns herein.
»Na also, da ist er ja! Hab ich es euch nicht gesagt?!« bricht der Bürgermeister in ein Triumphgeheul aus.
[20] In der Ferne erblicken wir die schwarzen Umrisse des Hubschraubers, der sich mit Blinklicht nähert. Die ganze Polizeitruppe der Insel, also ein Polizeiobermeister und zwei einfache Beamte, ist versammelt und versucht, die Leute im Zaum zu halten. Sie haben sich an den Händen gepackt, doch beim ersten Ansturm wird man sie überrennen. Ohne ein weiteres Wort stelle ich mich schützend vor sie.
»Nur keine Aufregung«, sage ich sanft zu der Menge. »Diejenigen, die die Sachen bringen, werden sie auch verteilen. Ihr werdet alle etwas bekommen.«
Ich weiß nicht, ob sich meine Persönlichkeit durchgesetzt hat oder ob sie der Wirbelwind zurückdrängt, der sich bei der Landung des Hubschraubers erhebt. Jedenfalls beginnen sie zurückzuweichen.
Der Hubschrauber setzt auf dem Beton auf, die Tür öffnet sich, und eine etwa fünfundzwanzigjährige Frau steigt aus, dick geschminkt und aufgedonnert, von der Sorte, die wir früher auf dem Dorf ›flotte Biene‹ nannten.
»Da wären wir!« ruft sie hocherfreut.
Plötzlich bricht die Menge in Applaus aus, und sie wiegt sich geschmeichelt in den Hüften. Hinter ihr tauchen statt Zelten und Wolldecken ein bärtiger Kameramann und zwei Typen auf, die Kisten, Stative und Scheinwerfer ausladen.
»Mann, die sind ja vom Fernsehen«, hört man eine enttäuschte Stimme, und der Applaus fällt in sich zusammen wie der Schaum eines frisch gezapften Bieres.
»Sind Sie vom Fernsehen?« Der Bürgermeister nähert sich der jungen Frau, bereit, sich in die Bresche zu werfen.
»Später, später«, sagt sie hektisch. »Zuerst möchte ich [21] die eingestürzten Häuser sehen. Gibt es hier eingestürzte Häuser?«
»Nein, zum Glück nicht, aber –«
»Hab ich dir doch gesagt, daß wir nichts finden werden«, sagt der Kameramann zu der Reporterin. »Wir sind ganz umsonst hergekommen, laß uns wieder abhauen.«
»Ausgeschlossen«, antwortet sie und packt das Mikrofon. »Wir sind schon spät dran, mir geht sonst die Live-Schaltung durch die Lappen.«
»Zählen denn, um Himmels willen, nur eingestürzte Häuser?« echauffiert sich der Bürgermeister. »Wir stehen seit fünf Stunden im Regen auf der Straße, ohne Licht, ohne Telefon, wir trauen uns nicht in unsere Häuser zurück, und keiner schert sich um uns. Was wollt ihr noch? Sollen wir eigenhändig unsere Häuser einreißen, damit man sich endlich für uns interessiert?«
»Das ist es!« ruft die flotte Biene begeistert. »Die verbrecherische Gleichgültigkeit des Staates! Wer ist der Bürgermeister? Gibt’s hier so was wie einen Bürgermeister?«
»Der bin ich.«
»Ach so, Sie sind das.« Er entspricht zwar nicht ganz ihren Erwartungen, aber in der Not frißt der Teufel Fliegen. »Wie heißen Sie?«
»Jagos Kalokyris.«
»Schön, Herr Kalokyris. Bleiben Sie in meiner Nähe. Ich werde Sie gleich vor die Kamera rufen.«
Sie packt das Mikrofon und wartet voller Anspannung darauf, live in die Nachrichtensendung geschaltet zu werden. Und da heutzutage alle ohne Ausnahme für das Fernsehen arbeiten, Gott inbegriffen, krachen plötzlich zwei [22] Donnerschläge hernieder und ein heftiger Regenschauer setzt ein.
»Guten Abend, Jorgos… Guten Abend, meine Damen und Herren…«, sagt die flotte Biene ins Mikrofon, und daran erkennen wir, daß wir auf Sendung sind.
»Die Situation in dieser Randzone Griechenlands ist dramatisch, Jorgos. Die Bewohner der Insel sind beim ersten Erdstoß der Stärke 5,8 auf der Richter-Skala aus ihren Häusern gestürzt. Seitdem sind fünf Stunden vergangen, und die offiziellen staatlichen Institutionen glänzen durch Abwesenheit. Wie man sieht, gießt es hier in Strömen, und die Bewohner warten vergeblich auf Wolldecken und Zelte, um die erste Nacht nach der Katastrophe im Freien zu verbringen…«
»Wie hoch ist das Ausmaß der Schäden?« fragt der Moderator.
»Auf jeden Fall hoch, Jorgos, doch derzeit ist es noch nicht abzusehen, denn die Stromversorgung ist zusammengebrochen, und auf der Insel ist es stockdunkel. Hier neben mir steht der Bürgermeister Herr…« Sie hat seinen Namen vergessen.
»Kalokyris…«, ergänzt der Bürgermeister.
»…Herr Kalokyris, der uns eine genaue Beschreibung der herrschenden Lage auf der Insel geben wird. Wie stehen die Dinge zur Stunde, Herr Bürgermeister?«
»Die Situation ist dramatisch, wie Sie schon sagten. Ein weiteres Mal sind wir mit der verbrecherischen Gleichgültigkeit des Staates konfrontiert. Vor geschlagenen fünf Stunden habe ich mit der Präfektur telefoniert, ich habe die Lage erläutert, und man hat mir Hilfe zugesagt, doch [23] bislang ist sie nicht eingetroffen. Die Erdstöße gehen immer noch weiter, unsere Kinder stehen hilflos im Regen, weil wir uns nicht in unsere Häuser zurücktrauen… Krankheiten könnten sich verbreiten, Seuchen ausbrechen…«
Ich sehe, wie die Einwohner nicken und zustimmend murmeln, und bewundere die kaltschnäuzige Unverfrorenheit, mit der er das Ruder herumreißen konnte. Sollte er in diesem Augenblick erneut kandidieren, bekäme er keine einzige Gegenstimme.
»Ich appelliere über Ihren Sender an die zuständigen –«
»Machen Sie nicht weiter, wir sind nicht mehr auf Sendung«, würgt ihn die Reporterin ab. »Machen wir uns auf die Socken, Jungs«, sagt sie zum Aufnahmeteam, das angefangen hat, seine Siebensachen zusammenzupacken und zum Hubschrauber zu laufen.
»Vielen Dank«, sagt die Reporterin und läuft ebenfalls dorthin. Auf halbem Wege bleibt sie mit ihrem Stöckel hängen, ringt um ihr Gleichgewicht, entgeht um Haaresbreite einem Sturz in den Schlamm und erreicht den rettenden Hubschrauber. Bevor sie einsteigt, wendet sie sich halb um, als habe sie sich plötzlich an etwas erinnert.
»Alles Gute«, ruft sie.
»Warum wünscht sie uns alles Gute?« fragt ein junger Mann. »Hat hier vielleicht einer Geburtstag?«
Das ist der beste Kommentar, den ich den ganzen Abend über gehört habe.
[24] 3
Gegen Mitternacht schließlich trafen die Zelte und Decken doch noch ein. Allerdings waren die meisten Einwohner der Insel schon bis auf die Haut durchnäßt und hätten Badetücher besser gebrauchen können. Der Bürgermeister schlug vor, sofort provisorische Unterkünfte aus Zeltplanen zu errichten, doch die Leute waren am Ende ihrer Kräfte und ihrer Geduld angelangt und meinten, er solle sie selber aufstellen, dafür hätten sie ihn ja schließlich zum Bürgermeister gewählt. Einige, die sich bereit erklärt hatten, mit anzupacken, klopften sich mit den Hämmern auf die Finger, da sie die Pflöcke im Dunkeln nicht erkennen konnten, und gaben schließlich auf. Zuletzt kauerten sich alle irgendwohin – die einen in ihre Wagen, die anderen wickelten sich in Wolldecken, und manche besonders Wagemutige meinten, es sei ohnehin alles egal, und kehrten in ihre Wohnhäuser zurück.
Wir fanden in der Schmiedewerkstatt meines Schwagers Unterschlupf, zusammen mit seiner Frau, seiner Tochter, der Familie seines Bruders und einer Schar Dorfbewohner, die er auf dem Marktplatz aufgelesen hatte. Das traute Beisammensein, die Gespräche und die Erinnerungen an das Erdbeben vertrieben den Schrecken der Nacht. Es fehlte nur noch das Halva, das meine Mutter immer zubereitete, wenn sie die Nachbarn zu einer Zusammenkunft einlud. [25] Der einzige Muffel war Christos, der Bruder meines Schwagers, der ihm mit gedämpfter Stimme vorpredigte, daß ihm am nächsten Tag die Hälfte der Eisenstangen fehlen würde, weil die anderen sie mitgehen ließen, um ihre Häuser zu reparieren, und daß es immer so gewesen sei mit ihm, er sei immer bestohlen und reingelegt worden, während er, sein Bruder, gestern trotz des ganzen Aufruhrs keine einzige Limonade verschenkt hätte.
Es ist jetzt zehn Uhr, und was die Nacht verhüllt hat, liegt im Morgenlicht offen zutage. Von außen besehen hat sich nichts verändert, der Hauptort ist so, wie er war. Nur in den Häusern hört man Wehklagen, Schluchzen und Stoßseufzer, zwar nicht im Chorgesang, doch vereinzelt wie Koloraturarien, weil eine Sachverständigenkommission eingetroffen ist und die Gebäude reihum besichtigt. Und das Wehgeschrei erhebt sich in den Wohnhäusern, die für unbewohnbar erklärt werden.
Das Haus meiner Schwägerin sieht aus wie ein bosnisches Haus nach dem Bürgerkrieg. Der Verputz ist abgebröckelt, und die Ziegelsteine liegen nackt und bloß in der Sonne. Der mehrarmige Leuchter hat die Hälfte seines schmückenden Beiwerks verloren und baumelt schief und ramponiert von der Decke. Ein Teil der Decke ist auf die Schrankvitrine herabgestürzt, und die Mauerstücke sind zwischen den Ausstellungsstücken gelandet. Nur der Fernseher ist unversehrt geblieben und starrt uns finster an. Eleni, meine Schwägerin, hält einen kleinen Besen in der Hand und säubert wortlos und mit verbissenem Eifer die bordeauxrote Sitzgarnitur, als wäre sie mitten im Weihnachtsputz.
[26] »Mensch, Mama, jetzt mach mal halblang«, sagt ihre Tochter. »Dein Sauberkeitsfimmel bringt dich noch um den Verstand.«
Eleni wendet sich um und wirft ihrer Tochter einen Blick zu, als wolle sie ihr an die Gurgel springen. »Weißt du, wie viele Jahre ich mir diese Sitzgarnitur gewünscht habe? Und schau dir an, wie sie jetzt aussieht. Schau nur!« fährt sie ihre Tochter an, als wäre sie an dem Erdbeben schuld.
»Eleni, laß das lieber bleiben, bis die Leute aus Athen hier gewesen sind«, meint ihr Mann kleinlaut, aus Angst, er könne sie damit noch mehr in Rage bringen. »Nicht, daß die unser Haus in schönster Ordnung vorfinden und uns die Zweihunderttausend Soforthilfe streichen.«
»Ganz abgesehen davon, daß sie das Haus für unbewohnbar erklären könnten«, ergänzt die Tochter.
Eleni blickt sie wild entschlossen an, als würde sie keinerlei Widerspruch dulden. »Ich weiche keinen Schritt aus meinem Haus. Und wenn es über mir zusammenstürzt.«
Adriani tut das einzig Richtige in dieser Situation. Sie sagt gar nichts, sondern geht auf ihre Schwester zu und drückt sie an sich. Eleni legt ihre Arme um die Hüften ihrer Schwester, lehnt den Kopf an ihre Brust, ihr ganzer Trotz fällt in sich zusammen, und sie bricht in heftiges Schluchzen aus.
Gerade als die beiden Schwestern einander zärtlich in den Armen liegen, taucht der Polizeiobermeister auf und unterbricht die rührselige Szene. Er steht in der Wohnzimmertür, hält seine Dienstmütze in der Hand und sieht mich betreten an.
[27] »Was gibt’s?« frage ich.
»Entschuldigen Sie bitte, ich weiß, ich komme ungelegen, aber könnten Sie kurz mitkommen?«
»Jetzt sofort?«
»Ja. Ich möchte Ihnen etwas zeigen.«
Er steckt mich mit seiner Verlegenheit an, und ich werfe Adriani, die Eleni immer noch im Arm hält, einen kurzen Blick zu. Sie nickt unmerklich und scheint dasselbe zu denken wie ich: daß es besser ist, wenn ich gehe, weil ich hier irgendwie nicht ins Bild passe.
»Gehen wir«, sage ich zum Polizeiobermeister.
Draußen wartet bereits das einzige Einsatzfahrzeug der Inselpolizei. Er setzt sich auf den Beifahrersitz und überläßt mir den Platz, der für offizielle Würdenträger reserviert ist – den Rücksitz, schräg hinter dem Fahrer.
Wir nehmen die Strecke hinauf nach Palatini – ein Bergdorf, das in der einzigen landwirtschaftlich nutzbaren Gegend liegt. Die Straße ist schmal und gewunden, zwei Autos können gerade mal aneinander vorbeifahren.
Der Regen hat die Landschaft blank geputzt. Unten breitet sich das Meer friedlich aus und umspült die kleinen Buchten, die Felsvorsprünge und Klippen der Insel. Nicht, daß ich eine besondere Liebe zur Natur hege. Als ich klein war, hing mir die Natureinsamkeit zum Hals raus, und ich zählte jedes Mal die Tage, bis wir nach Athen zurückfuhren. Doch dieser Anblick ist selbst für mich ein Erlebnis.
Ich komme durch die Stimme des Polizeiobermeisters wieder zu mir. »Nicht genug mit dem ganzen Unglück, jetzt haben wir auch noch mit Erdrutschen zu kämpfen«, murmelt er.
[28] »Aus diesem Grund haben Sie mich hierhergebracht? Wegen eines Erdrutsches?«
»Nein, nicht wegen eines Erdrutsches. Ich möchte Ihnen etwas anderes zeigen. Wir sind gleich da.«
Ich bin drauf und dran, ihn zum Teufel zu schicken, denn seine Geheimniskrämerei beginnt mir auf den Senkel zu gehen. Doch der Streifenwagen biegt nach links ab und fährt eine kleine Schlucht zum Meer hinunter. Aus dem Wagenfenster sehe ich, daß sich die Anhöhe rechter Hand vom Berg gelöst hat, ganze Brocken hinabgestürzt und erst hundert Meter von der Bucht entfernt zum Stillstand gekommen sind.
Am Rand des Hügels, der durch das Geröll und die Erdmassen entstanden ist, schiebt einer der beiden Polizeibeamten der Insel Wache. Der andere lenkt den Einsatzwagen und bringt ihn neben seinem Kollegen zum Stehen.
»Kommen Sie«, sagt der Polizeiobermeister und führt mich zum Hügel.
Beim zweiten Schritt halte ich inne. Inmitten der Erdreste ist ein dunkler Umriß zu erkennen. Hätte nicht der Kopf herausgeragt, hätte ich darin schwerlich einen Menschen erkannt.
»Aus diesem Grund habe ich Sie hergebracht«, höre ich den Polizeiobermeister sagen. »Englische Hippies haben ihn gefunden, solche von der ungewaschenen Sorte, die sich hier in der Einöde einmieten, um ihre Joints zu drehen.«
Die Gestalt ist vornübergestürzt, und das Gesicht hat sich in die Erde gebohrt. Nur die schwarzen, kurzgeschnittenen Haare sind zu erkennen, daraus schließe ich, [29] daß es sich um einen Mann handeln muß. Ich blicke zum Berg hoch. Der ganze Abhang sieht aus, als sei er mit einem Messerschnitt fein säuberlich von der Bergspitze getrennt worden.
»Wir haben ihn überhaupt nicht angefaßt«, fährt der Polizeiobermeister fort, stolz, daß er sich noch an einige Grundregeln aus der Polizeischule erinnert.
»Auch wenn Sie ihn angefaßt hätten, hätte das nichts ausgemacht. Seine Stellung ist ohnehin verändert worden. Er wurde oben eingegraben, und die Leiche ist durch den Erdrutsch ans Tageslicht gekommen.«
Ich hebe einen Ast auf und beginne die Leiche damit von Steinen und Erde zu befreien. Würmer werden dadurch aufgeschreckt, und eine Eidechse, ein weiteres Opfer des Erdrutsches, sucht sich eilig anderswo Unterschlupf.
Der Polizeiobermeister steht neben mir und sieht mir über die Schulter. »Vielleicht war es ein Unfall, und wir haben Sie ganz umsonst herbemüht.«
Nach und nach kommt der Körper eines Mannes zum Vorschein, nackt bis auf die Unterhose – keinerlei Kleidungsstücke weit und breit, nicht einmal Socken oder Schuhe.
»Ein Unfall?« sage ich zum Polizeiobermeister. »Und was hat er mit seinen Kleidern gemacht? Hat er sie etwa ausgezogen, damit sie nicht zerknittern?«
Er blickt mich an, als wäre ich Hercule Poirot mit dem martialischen Schnauzbart. »Deshalb habe ich Sie doch gerufen. Weil Sie von der Mordkommission sind und bei solchen Dingen Bescheid wissen. Wir hier auf der Insel sehen zum ersten Mal eine Leiche.«
[30] »Packen Sie mal mit an, damit wir ihn umdrehen können«, sage ich zum Wache schiebenden Polizisten. Er weicht einen Schritt zurück und wird bleich. Er sieht aus wie ein vergilbtes Baumblatt und beginnt am ganzen Leib zu zittern. »Packen Sie an, er tut Ihnen schon nichts. Er ist ja tot.«
»Karambetsos!« erklingt die befehlende Stimme des Polizeiobermeisters, doch er selbst rührt die Leiche nicht an.
Ich beuge mich hinunter und fasse den Toten an den Beinen, um mit gutem Beispiel voranzugehen. Ich schaffe es, ihn aufzurichten, und warte auf den Polizeibeamten, der gegen seine Übelkeit ankämpft. Endlich gibt er sich einen Ruck und faßt den Toten mit spitzen Fingern an den Schultern an, während er den Kopf zur Seite dreht und seinen Blick auf das Meer heftet.
Als wir ihn umdrehen, läuft eine Schar Ameisen und Ungeziefer aufgeschreckt durcheinander. Die Leiche plumpst mit einem dumpfen Geräusch auf den Rücken. Der Polizeibeamte läßt sie prompt los, rennt zum nächstgelegenen Baum und reibt seine Hände an der Rinde ab. Ich stehe über die Leiche gebeugt und mustere sie. Es handelt sich um einen jungen, ungefähr eins siebzig großen Mann. Seine Augen sind offen, und sein glasiger Blick ist auf die Sonne in der Ferne geheftet, als wundere er sich darüber, sie nochmals zu Gesicht zu bekommen. Seine Wangen sind halb verwest, ein Wurm ist in seinem Nasenloch zugange.
Auf den ersten Blick kann ich keine Spuren von Gewaltanwendung feststellen, doch das ist nicht ausschlaggebend. Allein die Tatsache, daß er nackt ist, reicht aus, um mich davon zu überzeugen, daß es Mord war.
[31] Der Polizeiobermeister wendet sich um, verfällt in Trab und läuft zum Einsatzwagen. Er öffnet den Kofferraum und zieht ein weißes Bettlaken hervor. Er entfaltet es auf dem Weg zurück, bedeckt damit den Toten und atmet erleichtert auf.
»Wie wollen wir ihn fortschaffen?« frage ich.
»Ganz einfach. Ich schicke Thymios mit seinem Pritschenwagen vorbei, mit dem er Transportfahrten zum Hafen übernimmt. Viel schwieriger ist es, einen Ort zu finden, wo wir ihn zwischenlagern können. Wir haben hier keine geeigneten Räumlichkeiten. Selbst das Bettlaken habe ich von zu Hause mitgebracht. Jetzt kann man es nicht mehr benutzen, und ich weiß nicht, wie ich das abrechnen soll.«
Seine Buchhaltung läßt mich kalt. »Wer genau hat die Leiche gefunden?«
»Sie wohnen dort drüben.« Der Polizeiobermeister deutet auf ein zweistöckiges Gästehaus, das zehn Meter vom Kieselstrand entfernt liegt. Im Erdgeschoß liegt eine Taverne. Das obere Stockwerk weist fünf oder sechs nebeneinanderliegende Fremdenzimmer auf, Türen und Fensterläden sind blau gestrichen, vor der Taverne stehen kleine Tische und Stühle. Ein blonder, bärtiger Mann hat sich in einen Stuhl gefläzt und seine Beine auf einen zweiten gehievt. Er trägt die klassische Ausrüstung des Rucksacktouristen: abgeschnittene Jeans, ansonsten ist er nackt und barfuß. Er hat eine Gitarre auf seinen Bauch gestützt und schrammt auf ihr herum. Die Katzenmusik dringt schwach an meine Ohren.
»Zum Glück treiben die sich hier herum und kommen nicht in den Hauptort«, meint der Polizeiobermeister.
[32] »Mal sehen, was sie uns zu sagen haben.«
Als wir uns nähern, sehe ich, wie eine junge Frau mit streng nach hinten gekämmten, dunklen, doch vom Salzwasser etwas ausgebleichten Haaren aus der Taverne tritt. Aus der Ferne wirkt sie nicht älter als achtzehn. Sie trägt ein Bikini-Oberteil, eine kurze Hose und Sandalen. Sie stellt sich hinter den Bärtigen und beginnt, ihm den Rücken zu bearbeiten. Ich weiß nicht, ob sie ihn massiert oder ihm den Dreck abschrubbt, jedenfalls scheint es der Bärtige zu genießen. Er läßt die Gitarre los und legt seinen Kopf in den Nacken. Die junge Frau beugt sich hinunter und küßt ihn. Er bringt den Kuß hinter sich und fährt mit seiner Katzenmusik fort, die er augenscheinlich für wichtiger hält.
Der Gedanke, daß ich zu unserer Verständigung auf mein miserables Englisch zurückgreifen muß, macht meine Laune nicht besser. Als wir bei ihnen eintreffen, blicken sie durch uns hindurch. Der Bärtige schrammt weiterhin teilnahmslos auf seiner Gitarre herum, und die junge Frau setzt die Massage fort. Aus der Nähe sieht sie älter aus, um die Fünfundzwanzig.
»You found the dead?« frage ich wie aus der Pistole geschossen, da ich die Frage schon während unseres Anmarsches vorbereitet habe.
Er hebt halb den Blick und sieht mich leicht genervt an, als hätte ich ihn im Zwiegespräch mit Eric Clapton unterbrochen. Die junge Frau läßt nicht von ihm ab.
»No, Hugo did and then he called us. Anita, would you fetch Hugo, dear?«
Die junge Frau unterbricht ihre Handarbeit und geht [33] Hugo holen, während der Bärtige wieder an seiner Gitarre herumfingert.
Ich wende mich zum Polizeiobermeister um. Der schüttelt schicksalsergeben den Kopf. »Sagen Sie gar nichts, ich muß mich jeden Tag mit so was herumschlagen.«
»What’s your name?« frage ich den Bärtigen. Solange ich Sätze aus drei bis vier Wörtern bilde, komme ich gut voran. Darüber hinaus komme ich ins Stottern.
»Jerry. Jerry Parker…«
Anita und Hugo kommen die Treppe vom oberen Stockwerk herunter. Hugo ist ein an die zwei Meter großer Hüne mit kahlgeschorenem Schädel, einem gewaltigen Schnurrbart, der bis zum Kinn herunterreicht, und einem bronzenen Ohrstecker im linken Ohr. Er trägt einen geblümten Kaftan, folglich ist er ein Fixer. Trüge er ein Tigerfell, könnte er als Zirkusdompteur durchgehen.
Die gleiche Frage noch mal, zum Aufwärmen. »What’s your name?«
»Hugo Hofer.«
»You found the dead?«
»Yes«, entgegnet er. Es stellt sich heraus, daß er Deutscher ist und schlechter Englisch spricht als ich, was mir moralischen Auftrieb gibt. Unangenehm ist nur, daß ich kein Sterbenswörtchen seines Englisch mit deutschem Akzent verstehe.
»Kapieren Sie was?« frage ich den Polizeiobermeister.
Er zuckt verlegen die Schultern. »Kein Wort.«
»Hören Sie… Ich erkläre Ihnen alles, damit Sie wissen, worum es geht«, sagt Anita plötzlich in fehlerfreiem Griechisch.
[34] Ich könnte ihr ein paar Ohrfeigen verpassen.
»Sie sind Griechin?«
»Ja…, Anita Stamouli…«
Ein Engländer, ein Deutscher und eine Griechin. Schön und gut, sage ich erleichtert zu mir selbst. Wenigstens auf der Ebene der Taugenichtse erfüllen wir die Maastrichtkriterien.
»Nun erzählen Sie uns schon, was passiert ist. Muß ich Ihnen alles aus der Nase ziehen?«
»Gestern haben wir wegen des Erdbebens die ganze Nacht im Freien verbracht. Man konnte gar nicht an den Strand gehen, weil dort riesige Brecher heranrollten. Plötzlich, ungefähr um zehn Uhr abends, sehen wir, wie nach einem Erdstoß der Berg in Bewegung kommt und auseinanderbricht. Wirklich, so etwas habe ich noch nie gesehen. Wir sahen den Abhang herunterstürzen und sagten uns, jetzt begräbt er uns alle unter sich. Zum Glück sind wir heil davongekommen. Heute morgen – so gegen neun – meinte Hugo, er wolle mit seinem Motorrad kurz in den Hauptort fahren, um zu sehen, was sich so tut. Zwei Minuten später kam er zurück. Kommt, meinte er, ich muß euch was zeigen. Wir sind mitgegangen, und da haben wir die Leiche gesehen. Hugo ist mit dem Motorrad zur Polizei gefahren und hat sie verständigt. Das ist alles.«
Mit ihren klaren Angaben kann man etwas anfangen. »Sie werden mit uns auf die Wache kommen müssen, um Ihre Aussage zu machen«, sage ich.
»Alles klar, ich darf also die Dolmetscherin spielen. Ich weiß zwar nicht, wozu das gut sein soll… Dieser Mensch ist seit gut drei Monaten tot.« Sie blickt mir in die Augen, und [35] ein spöttisches Lächeln spielt um ihre Mundwinkel. »Wenn Sie seinen Hals genau betrachten, werden Sie feststellen, daß er Spuren eines Kampfes aufweist«, setzt sie hinzu.
»Woher wollen Sie das wissen?« frage ich sie neugierig.
»Ich studiere Medizin in London, mein Freund Jerry ist Mathematiker. Hugo haben wir hier kennengelernt, er schreibt seine Doktorarbeit in Philosophie und kam hierher, um sich davon zu erholen.«
»Und wieso haben Sie nicht gesagt, daß Sie Griechin sind, und haben uns auflaufen lassen?«
»Ich habe Ihren Blick gesehen, deshalb. Ich war sicher, daß Sie uns für Fixer halten.«
Immer noch hat sie das spöttische Lächeln auf den Lippen. Sie weiß, daß sie mich in die Tasche gesteckt hat, und blickt mich von oben herab an.
»Kommen Sie und zeigen Sie mir die Spuren, die Sie gesehen haben«, sage ich. »Und dann kommen Sie und der Deutsche mit mir auf die Polizeiwache, um Ihre Aussage zu machen.«
Wir kehren zum Scheitelpunkt des Erdrutsches zurück. Der Polizeibeamte hat sich von der Leiche abgewendet und steht rauchend an einen Baum gelehnt. Ich ziehe das Bettlaken herunter.
»Zeigen Sie her.«
Sie kniet sich neben die Leiche. »Bitte schön, hier.«
Ich beuge mich hinunter und betrachte die Stelle. Tatsächlich weist die dem Berg zugewandte linke Halsseite einige fast unsichtbare Kratzer auf. Ich schlucke und ärgere mich über mich selbst. Da wir ihn nackt fanden, hielt ich es für sicher, daß es Mord war, und suchte nicht mehr [36] weiter. Ich muß zugeben, daß die junge Frau recht hat, doch ihr Gesichtsausdruck ärgert mich, und ich sage nichts.
Ich höre das Tuckern eines Motorrads, das hinter uns stehenbleibt. Ich drehe mich, um und erblicke Hugo auf einem altmodischen Modell von der Sorte, wie sie die Deutschen im Krieg gebrauchten. Bestimmt war sein Großvater ein Nazi und hat es ihm vererbt.
»Wir können Sie im Einsatzwagen mitnehmen. Das wäre doch bequemer für Sie«, meine ich zu der jungen Frau.
Wieder setzt sie ihr ironisches Lächeln auf. »Ich nehme lieber das Motorrad. Wenn ich mit Ihnen im Streifenwagen fahre, glaubt der ganze Ort, Sie hätten mich mit Drogen erwischt.«
Sie steigt hinter Hugo auf, und das Motorrad fährt mit ohrenbetäubendem Geknatter los.
[37] 4
Dreimal ertönt das Horn, und der Schornstein der Fähre taucht an der Spitze der Hafenmole auf. Kurz darauf schiebt sich der Bug ins Bild, seine weiße Masse wird immer länger und füllt bald die ganze Hafeneinfahrt aus. Das Schiff dreht nach links ab und beginnt, sich im Rückwärtsgang der Anlegestelle zu nähern, während die Heckklappe langsam heruntersinkt.
Etwa dreißig Passagiere und ein halbes Dutzend Autos – die traurigen Überbleibsel des Sommers – warten darauf, sich nach Piräus einzuschiffen. Es sind gerade mal vier Tage seit dem Erdbeben vergangen, doch hier im Hafen, mit seinen spärlichen Häusern und den beiden Strandtavernen, erinnert nichts mehr daran. Das Meer ist spiegelglatt, die Sonnenstrahlen werfen ihr goldenes Licht darauf, zwei Schnellboote fahren mit aufheulendem Außenbordmotor im Hafenbecken auf und ab.
Wäre da nicht die Leiche des Unbekannten gewesen, wir hätten gleich am Tag nach dem Erdbeben unsere Koffer gepackt, um der Familie meiner Schwägerin nicht zur Last zu fallen. Gewiß, das Haus ist nicht für unbewohnbar erklärt worden, doch sie müssen es von Grund auf renovieren. Meine Schwägerin ist so mitgenommen, als wache sie am Krankenbett eines nahen Verwandten, von dem man nicht weiß, ob er dem Tod noch einmal von der Schippe springt. [38] Eigentlich wäre das eine gute Gelegenheit gewesen, diskret, aber entschlossen den Rückzug an unseren ruhigen häuslichen Herd anzutreten.
Doch die Leiche machte uns einen Strich durch die Rechnung. Ich rief die Polizeidirektion in Ermoupoli an, doch dort hatte man wegen des Erdbebens alle Hände voll zu tun. Von der Leiche wollte man nichts hören.
»Sehen Sie doch wenigstens mal nach, ob es irgendeine vermißte Person gibt, auf die die Beschreibung paßt.«
Der Polizeirat erklärte sich bereit, mir fünf Minuten seiner wertvollen Zeit zu opfern. »Ich habe hier einen Franzosen, zwei Engländer und eine Holländerin. Ich kann Ihnen auch noch einen Achtzigjährigen mit Gehirnerweichung anbieten. Können Sie damit was anfangen?«
»Nein.«
»Ein Grund mehr, daß ich ihn mir nicht aufhalsen lasse. Höchstwahrscheinlich ist er aus Ihrem Zuständigkeitsbereich, ein Tourist, der auf die Insel kam und hier von seinen Kumpanen umgelegt wurde.«
Ich sah, daß ich auf keinen grünen Zweig kam, und rief meinen Vorgesetzten Gikas an, den Leitenden Kriminaldirektor für den Distrikt Attika.
»Ein Unglück kommt selten allein«, sagte er lachend. »Da fahren Sie endlich einmal in die Ferien, und schon rasseln Sie von einer Katastrophe in die nächste.«
»Nichts zu machen, ich bin eben ein geborener Pechvogel. Aber was soll ich jetzt mit der Leiche anfangen?«
»Wenn Sie die Leiche nicht loswerden können, müssen Sie sie eben hierher schaffen und den Fall übernehmen.«
Ich war hin- und hergerissen zwischen zwei Reaktionen: [39] einerseits der des Beamten, der seinen Chef zum Teufel wünscht, andererseits der des masochistischen Polizisten, der Blut geleckt hat. Die zweite Reaktion gewann die Oberhand, und ich rief den Gerichtsmediziner Markidis in Athen an.
»Ich bin doch nicht verrückt geworden, daß ich mich auf eine zehnstündige Schiffsreise mache, um mir auf einer erdbebengeschüttelten Insel eine durch einen Erdrutsch aufgetauchte Leiche anzusehen«, meinte er. »Schicken Sie sie mir als Frachtgut, und ich sehe zu, was ich für Sie tun kann.«
So stehe ich jetzt mit Adriani und drei Koffern an der Anlegestelle und warte darauf, die Fähre zu besteigen. Die Leute drängeln nach vorn und sichern sich eine gute Ausgangsposition, um dann, sobald der Mitarbeiter der Hafenbehörde die Absperrung freigibt, in den Aufenthaltsraum zu stürmen und rechtzeitig einen Tisch zum Birimba-Spielen oder einen Sitzplatz vorm Fernseher zu ergattern.
Thymios’ Pritschenwagen mit dem Sarg des Unbekannten auf der Ladefläche hat sich etwas verspätet und trifft gerade ein, als wir die Laderampe betreten wollen.
»Meine Güte, ein Toter als Reisebegleiter! Nach dem Erdbeben nun auch noch das«, sagt eine korpulente Fünfzigjährige mit pistazienfarbener, hautenger Stretchhose und bekreuzigt sich.
»Das wird wohl der sein, den man nach dem Erdbeben auf dem Berg gefunden hat«, meint ihre Freundin gleichen Kalibers, die sich in enganliegende Jeans gezwängt hat.
[40] »Muß man ihn denn unbedingt mit dem Linienschiff transportieren? Gibt es da keine andere Möglichkeit?«
»Wir sind doch in Griechenland, was erwartest du anderes?«
»Wieso? Paßt es Ihnen vielleicht nicht, mit dem Toten zusammen zu reisen?« tritt Adriani dazwischen, während ich an ihrer Bluse zupfe, um sie zum Schweigen zu bringen. Obwohl ich weiß, daß das nichts fruchtet.
»Was glauben Sie denn?« sagt die mit der Stretchhose. »Das bringt Unglück, Gott im Himmel! Wir gehen doch auf eine Seereise!«
»Ach ja, richtig, wie konnte ich das vergessen! Auf dem Landweg hätte sein Transport kein Unglück gebracht.« Sie verspritzt ihr Gift mit einem honigsüßen Lächeln.
»Wenn Sie sich nicht daran stören, dann leisten Sie der Leiche doch Gesellschaft, wir halten Sie nicht zurück«, meint die andere mit den enganliegenden Jeans, während sie die Laderampe dann doch überquert.
Die Fähre ist fast leer. Adriani wählt zwei Plastikstühle am Heck aus, damit uns die Sonne ein wenig wärmt. Auf den Bänken liegen, in ihre Schlafsäcke gehüllt, einige Touristen und schlummern selig. Ganz hinten sitzen Anita und Jerry und knutschen unablässig. Irgendwann wendet sich der Engländer um, und unsere Blicke treffen sich, doch mein Gesicht scheint ihm nichts zu sagen.
Adriani holt ihre Handarbeit hervor und beginnt an ihren Deckchen zu sticken. Ich beobachte sie und frage mich, wo sie die neue Stickerei bloß unterbringen will. Seit ich sie kenne, widmet sie sich dieser Tätigkeit, doch seit Katerina in Thessaloniki Jura studiert und sie viel allein ist, [41] hat sich die Situation zugespitzt. Dann aber läßt sie die Handarbeit sinken und ihren Blick über die Schaumkronen schweifen, und ein abgrundtiefer Seufzer entringt sich ihrer Brust.
»Was ist los?« frage ich.
»Ich denke gerade an Eleni. Was sie jetzt wohl macht?«
»Sie putzt bestimmt die Sitzgarnitur oder hilft Sotiris beim Aufhängen des Leuchters.«
Sie blickt mich von der Seite an, weil sie weiß, worauf ich hinauswill. »Lüster nennt man das heutzutage.«
»Na schön. Wie die Lüster, die in Kathedralen hängen.«
»Du bist eben ein Lästermaul. Manchmal frage ich mich, wie du eigentlich über unsere Wohnung sprichst.«
Besser, sie weiß es nicht. Jerry und Anita haben das Knutschen schließlich satt und verharren in einer Umarmung. Sie ähneln den zu Stein gewordenen verbrannten Baumstrünken auf Euböa. Ich beuge mich vor und entnehme Adrianis Tasche das Wörterbuch von Dimitrakos. Ich blättere darin herum und stoße auf den Eintrag
beben
Als ich gerade zum Begriff Erdbeben übergehen möchte, weil ich von Erregung, Kälte und Fieber genug habe, höre ich eine Stimme über mir.
»Und was ist mit der Leiche? Was haben Sie mit ihr gemacht?«
Ich hebe meinen Kopf und erblicke Anita. Mein Blick wandert zum Engländer, der mit offenem Mund auf dem Rücken liegt und im Morgenlicht sanft schnarcht.
[42] »Sie ist unten. Wollen Sie sie sehen?«
»Nein danke. Zweimal reicht mir.«
Adriani hebt ihren Blick von der Stickerei hoch, mustert uns, kommt zu dem Schluß, daß eine so gestylte junge Frau sicherlich nicht auf Polizisten steht, und wendet sich wieder ihrer Nadel zu.
Doch Anita läßt nicht locker. Sie wirft einen Blick auf den Engländer, der noch immer mit offenem Mund döst. Dann wendet sie sich wieder mir zu und sieht mich unschlüssig an.
»Sie wollen mir wohl etwas sagen. Nur zu«, meine ich.
»Hugo hat mir am Tag seiner Abreise noch etwas erzählt.«
»Was denn?«
»Daß er den Typen gesehen hat, bevor er umgebracht wurde.«
»Wo?«
»Auf Santorini. Zusammen mit einer jungen Frau.«
»Einer jungen Frau? Was für einer jungen Frau?«
»Keine Ahnung. Jedenfalls muß sie Griechin gewesen sein, da sie miteinander griechisch sprachen.«
Das kommt ja immer schlimmer. Besser, es wäre eine solo reisende Touristin gewesen, die er auf Santorini aufgegabelt hat. »Und warum hat er das nicht bei seiner Aussage erzählt?«
»Weil man ihn eine Stunde lang warten ließ und er die Schnauze voll hatte. Hätte er die junge Frau erwähnt, dann wäre er von Ihnen noch länger aufgehalten worden, und er hatte es eilig.«
»Wieso denn? Mußte er die Löwen füttern?«
[43] Sie braucht eine halbe Minute, um sich den Zirkusphilosophen mit dem Ohrstecker zu vergegenwärtigen, und bricht in Gelächter aus.
»Ziehen Sie aus seinem Äußeren keine falschen Schlüsse. Er ist total klug«, sagt sie.
»Wenn er klug wäre, hätte er mir von der jungen Frau erzählt. Haben Sie seine Adresse in Deutschland?«
»Nein. So was ist eine reine Urlaubsbekanntschaft. Im Herbst ist die schon wieder vergessen.«
Kann sein, daß sie mir die Adresse nicht preisgibt, um ihm Unannehmlichkeiten zu ersparen. Der Engländer hat seine Augen aufgeschlagen und räkelt sich. Sie läßt mich sitzen und läuft zu ihm, um ihn keine Sekunde lang ihrer Gegenwart zu berauben.
»Meinst du, es handelt sich um eine Liebestragödie?« fragt Adriani.
So viele Morde geschehen tagtäglich in Athen – Fixer, die sich wegen ein bißchen Heroin ein Messer zwischen die Rippen jagen, Albaner, die wegen eines schmutzigen Taschentuchs zum Mörder werden, russische Mafiosi, die sich wegen eines Datsun mit abgelaufenem TÜV die Köpfe einschlagen, und Adriani glaubt immer noch, daß alle Verbrechen aus Leidenschaft verübt werden. Durch eine heftige innere Erregung sozusagen, die Dimitrakos durch das Lemma Affekt wiedergeben würde.
»Klar. Sie hat ihn erwürgt und dann ausgezogen, um die Kleider als Souvenir zu behalten. Dann hat sie Hacke und Schaufel gepackt, ein Loch gegraben und ihn verscharrt.«
»Wieso denn nicht? Kommt dir das so abwegig vor?«
[44] »Was weiß ich. Dein TV-Bulle jedenfalls würde es ganz und gar nicht abwegig finden.«
Ich spiele dabei auf den Kommissar aus einer Fernsehserie an, die sie ausnahmslos jeden Nachmittag verfolgt.
»Das gucke ich nicht mehr«, sagt sie. »Und ›Schön und reich‹ auch nicht. Du kannst dir deine spitzen Bemerkungen sparen.«
Ich bin überrascht, doch ich lasse mir nichts anmerken. »Um so besser. Du hast immerhin drei Jahre gebraucht, um draufzukommen, daß er nichts wert ist.«
Sie schleudert mir einen wütenden Blick entgegen, rollt ihre Stickerei zusammen, hebt den Stuhl unter ihrem Hintern in die Höhe und setzt sich damit fünf Meter weiter weg in die Sonne.
In solchen Stunden stört mich ihre Genervtheit überhaupt nicht, weil ich dann endlich meine Ruhe habe. Die Sache mit der unidentifizierten Leiche gefällt mir jedoch ganz und gar nicht. Sollte das Opfer tatsächlich mit einer jungen Frau – möglicherweise sogar einer Griechin – zusammen gesehen worden sein, warum ging sie dann nicht zur Polizei, um das Verschwinden ihres Freundes anzuzeigen? Eine Möglichkeit wäre, daß sie nicht weit von ihrem Freund entfernt verscharrt wurde, ihre Leiche jedoch durch den Erdrutsch nicht freigelegt worden war. Hätte der hünenhafte Deutsche mir das auf der Insel erzählt, hätte ich die ganze Umgebung umgraben lassen, um völlig sicherzugehen. Nun muß ich einen Funkspruch an die Polizeiwache schicken und kann mich nicht darauf verlassen, daß sie sorgfältig graben. Wenn sie nicht gefunden wird, heißt das entweder, sie haben sich getrennt, oder, sie steckt [45] mit dem Täter unter einer Decke, oder aber, sie hat sich aus Angst aus dem Staub gemacht. Ganz schön vertrackt. Und damit noch nicht genug: Ich muß auch noch einen Funkspruch mit den Personalien des Zirkusphilosophen an die deutsche Polizei schicken, damit sie ihn ausfindig macht und für eine zusätzliche Zeugenaussage vorlädt. Und all das, weil es ihm zum Hals raushing, noch weitere zehn Minuten auf der Polizeiwache zu warten.
Während ich mich beim rhythmischen Stampfen des Schiffsmotors in diese Gedanken versenke, nicke ich ein. Ich weiß nicht, wie lang ich geschlafen habe, doch als ich aufwache, hat es zu dämmern begonnen, und ich brauche eine gute Minute, um mir darüber klarzuwerden, daß das Schiff mitten auf dem Meer zum Stillstand gekommen ist. Ich blicke auf Adrianis Stuhl. Er ist leer. Weder der Engländer noch Anita sind auf ihren Plätzen.
Ich erhebe mich, um nach Adriani zu suchen. Ich finde sie in einem Sessel im Aufenthaltsraum, wie sie einen Fünfunddreißigjährigen mit grünem Sakko, braunem Hemd und granatfarbener Hose auf der Mattscheibe verfolgt, der sich mit einer Vierzigjährigen unterhält, die vollkommen in Tränen aufgelöst ist. In einem Fensterchen gibt jemand über eine Live-Schaltung seinen Senf dazu. Rundherum verdichten sich Zigarettenrauch, Gesprächslärm und die Rufe der Kartenspieler, so daß man kein Wort verstehen kann. Doch Adriani hängt völlig gebannt an den Lippen des buntscheckigen Fünfunddreißigjährigen. Ich tippe ihr auf die Schulter, und sie fährt zusammen wie ein erschrecktes Vögelchen. Sie erkennt, daß ich es bin, und wendet ihren Blick wieder der Mattscheibe zu.
[46] »Bist du aufgewacht?«
»Warum haben wir angehalten?«
»Aus technischen Gründen, heißt es.«
»Motorschaden?«
»Was sonst?« wirft ein Weißhaariger neben Adriani dazwischen. »Was kann man anderes erwarten? Das ist mir schon zweimal auf diesem Schrottkahn passiert.«
»Hab ich’s doch gesagt, daß es Unglück bringt, mit einem Toten an Bord zu reisen, aber Sie wollten das ja nicht glauben!« Die Dicke mit der Stretchhose baut sich vor mir auf und triumphiert, weil sich ihre Weissagung erfüllt hat.
Schließlich treffen wir mit dreistündiger Verspätung in Piräus ein. Der Krankenwagen steht schon bereit, der Fahrer und der Sanitäter sind von der Warterei ganz geschlaucht. Ich sorge für die Übergabe der Leiche und reihe mich dann mit Adriani in die Warteschlange am Taxistand ein. Alle fünf Minuten taucht eines am Horizont auf. Einen Verkehrspolizisten gibt es um diese Tageszeit nicht, und die Autos drängen sich ungeordnet und hupend aus dem Schiffsbauch. Wir sind inzwischen an die Spitze der Warteschlange vorgerückt, doch das zählt nicht, denn alle anderen schnappen uns die Taxis vor der Nase weg. Ein Taxifahrer hat gerade ein Ehepaar verstaut und sucht noch zwei zusätzliche Kunden.
»Wohin wollen Sie?« fragt er mich.
»Pangrati.«
»Das kann ich nicht brauchen«, meint er, steigt in sein Taxi und fährt los.
»Warum hast du ihm nicht deinen Dienstausweis [47] gezeigt, damit er uns mitnehmen muß?« sagt Adriani ärgerlich zu mir.
»Bist du verrückt? Damit er mich als Faschisten beschimpft?«
»Na und? Würdest du lieber als Kommunist bezeichnet werden? Die guten alten Zeiten sind endgültig vorbei«, fügt sie hinzu und seufzt.
Faschisten, Kommunisten und Liberale, es gibt sie längst nicht mehr. Mutterseelenallein stehen wir beide da mit unseren drei Koffern und warten darauf, daß uns irgendein verirrtes Taxi aufnimmt.
[48] 5
Der Mirafiori erwartet mich genau so, wie ich ihn vor zehn Tagen zurückgelassen habe. Geschlagene fünf Minuten lang ziert er sich, bevor er anspringt, wahrscheinlich weil ich ihn nicht mit in die Ferien genommen habe. Als ich von der Aristokleous- in die Aroni-Straße einbiege, erhebt sich vor mir ein kleiner Hügel, der aussieht wie eine Miniaturausgabe des Lykavittos. Ich steige voll auf die Bremse, und ein alter Mann springt erschrocken zur Seite und schnauzt mich an.
»Sind Sie blind? Wollen Sie mich zum Krüppel fahren?« Er haut mit der Faust auf die Motorhaube.
Jetzt erst erkenne ich, daß mein Wagen nicht vor einem kleinen Hügel zum Stehen gekommen ist, sondern vor einem wahren Gebirge aus Plastiktüten, Bananenschachteln, Pizzakartons, Hundeknochen, Fischgräten und mit Silberpapier ausgeschlagenen Fast-food-Behältern. Was auf dem Lykavittos die kleine Kapelle, ist hier eine ausgeleierte Matratze, die den erschöpften Bergsteiger zum Verweilen einlädt.
»Was ist los? Streikt die Müllabfuhr?« frage ich.
»Wo kommen Sie denn her? Aus der EU?«
»Nein, aus dem Urlaub.«
»Na dann, willkommen in Athen«, meint er und dreht mir den Rücken zu.
[49] Auf der Imittos-Straße türmt sich der Müll bis zum Hochparterre. Man öffnet morgens die Fensterläden, und statt sich an Thymianduft zu ergötzen, wie die Vembo in ihrem berühmten Lied, schlägt einem der widerliche Gestank von verfaultem Fleisch und Obst entgegen. Manche haben ihren Müll um die dürren Bäumchen drapiert, die von der Stadtverwaltung gepflanzt wurden, um den Athenern die Illusion schattiger Alleen vorzugaukeln. Der Müll erinnert mich an die Nadeln und Zapfen, die wir um die Kiefern unseres Dorfes als Dünger aufhäuften.
Ich gelange zum Gebäude des Polizeipräsidiums auf dem Alexandras-Boulevard und begebe mich in die dritte Etage, wo sich die Mordkommission befindet. Der Gang ist menschenleer. Bevor ich mein Büro betrete, werfe ich einen raschen Blick in das gegenüberliegende Zimmer, wo die beiden Kriminalobermeister unserer Abteilung, Vlassopoulos und Dermitzakis, sitzen.
»Was, schon aus dem Urlaub zurück, Herr Kommissar?« meint Vlassopoulos. »Sind Sie vor dem Erdbeben geflüchtet, oder hat Sie die Sehnsucht nach uns eingeholt?«
»Ersteres und eine Leiche. Ihr seid mir gar nicht abgegangen. Kommt mit.«
Sie folgen mir in mein Büro und lassen sich auf den beiden Stühlen nieder, während ich mit Markidis, dem Gerichtsmediziner, konferiere.
»Warum rufen Sie mich schon um neun an?« ärgert er sich. »Glauben Sie denn, ich stehe im Morgengrauen auf, um Ihre Leiche zu obduzieren?«
»Wann können Sie mir etwas dazu sagen?«
»Jetzt gleich, aber es wird Ihnen nicht gefallen.«
[50] »Überrascht mich nicht.«
»Wenn Sie vorhatten, den Toten anhand seiner Fingerabdrücke zu identifizieren, haben Sie aufs falsche Pferd gesetzt.«
»Wieso?«
»Weil sämtliche Fingerspitzen verbrannt sind.«
Ich nehme es zur Kenntnis, und meine Hoffnungen sinken gegen den Gefrierpunkt. Wir haben es mit der Leiche eines Unbekannten zu tun, dessen Fingerkuppen unkenntlich gemacht wurden und den man mit einer jungen Frau, deren Personalien nicht feststellbar sind, auf einer Insel gesehen hat. Das wird ja immer schöner.
»Ich habe aber noch eine gute Nachricht für Sie«, höre ich Markidis’ Stimme am anderen Ende sagen. »Ich habe die Spurensicherung verständigt, damit sie ihn fotografieren, bevor ich ihn zerschnipple.«
»Vielen Dank. Sobald Sie auf etwas stoßen, setzen Sie mich bitte davon in Kenntnis.« Ich lege den Hörer auf und erstatte meinen beiden Gehilfen Bericht.
»Andere bringen aus dem Urlaub Honigmandeln und Sesamplätzchen mit – Sie eine Leiche«, meint Vlassopoulos.
Ich enthalte mich jeden Kommentars, wie immer, wenn meine Untergebenen recht haben. »Ruft die Leute von der Spurensicherung an und gebt ihnen Bescheid, sie sollen sich mit den Fotografien beeilen. Und schickt einen Funkspruch an die Polizeiwache der Insel, sie sollen den Berg an der Stelle umgraben, wo der Erdrutsch abgegangen ist, vielleicht stoßen sie auf die Leiche der jungen Begleiterin.«
[51] »Die können graben, bis sie schwarz werden«, meint Dermitzakis.
»Woher willst du das wissen?«
»Das sind doch Urlaubsflirts, ein schneller Fick und tschüs.«
Ich wünsche mir, daß er recht behält. Wir treten alle zusammen aus dem Büro. Sie kehren in ihr Zimmer zurück, und ich nehme den Fahrstuhl, um mich in die fünfte Etage zu Gikas, meinem Chef, zu begeben.
Koula, das Fotomodell, das sich bei ihm als Sekretärin verdingt hat, schnellt aus ihrem Stuhl hoch, sobald sie mich erblickt.
»Nein, so ein Pech! Da fahren Sie nach zwei Jahren zum ersten Mal in die Ferien, und dann ein Erdbeben!«
»Reden wir lieber nicht davon«, sage ich und nehme die betretene Miene an, die man von einem erwartet, der seinen Urlaub gezwungenermaßen unterbrechen mußte.
»Das liegt am bösen Blick. Jemand wünscht Ihnen nichts Gutes, darüber müssen Sie sich klar sein.«
»Wer sollte mir denn Böses wünschen, Koula? Der Kriminaldirektor? Ausgeschlossen, der neidet mir meinen Urlaub nicht, der ist ja selber ständig in den Ferien.«
Sie schmunzelt verschwörerisch, wie jedes Mal, wenn ich etwas zu Gikas’ Ungunsten von mir gebe.
»Ich habe noch eine Überraschung für Sie.« Sie öffnet die oberste Lade ihres Schreibtisches und holt ein Kästchen hervor. Auf dem Deckel ist ein mit einem Pfeil durchbohrtes Herzchen aufgemalt. Ich mache ihn auf und erblicke glacierte Mandeln und Pistazien, wie sie bei Hochzeiten verteilt werden.
[52] »Sie werden doch nicht heiraten, oder?« frage ich mit Unschuldsmiene.
»Nein, aber mich verloben. Besser gesagt, ich habe mich gerade verlobt.« Und sie streckt mir stolzgeschwellt den Verlobungsring an ihrer linken Hand entgegen.
»Bravo, Koula. Herzlichen Glückwunsch! Und wer ist der Glückliche? Ein Kollege etwa?«
»Um Himmels willen, das fehlte mir gerade noch!« meint sie aufgebracht. »Polizistin bin ich nur geworden, um einen sicheren Posten zu ergattern, aber zum Heiraten suche ich mir doch keinen Bullen aus. Mein Verlobter ist Bauunternehmer, er hat ein Ingenieurbüro in Dionysos.«
Sieh mal einer an, denke ich mir. Tiefer kann man nicht sinken. Die Bauunternehmer in Dionysos sind bekannt dafür, daß sie Hütten ohne Baugenehmigung hochziehen.
»Alles Gute für die Hochzeit.«