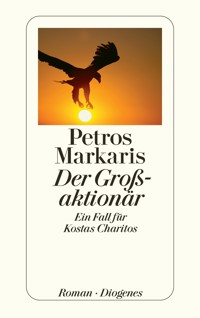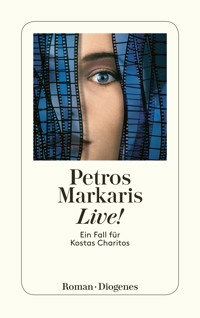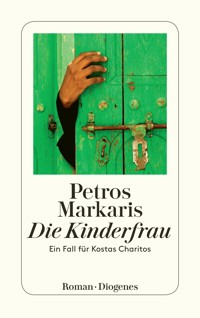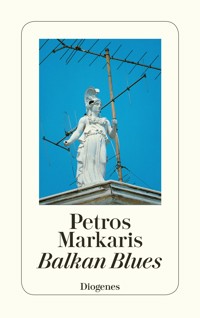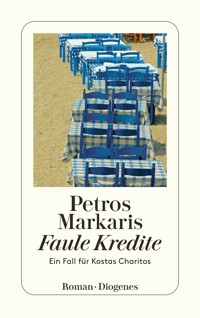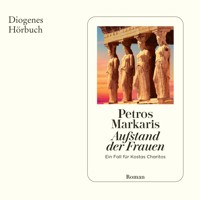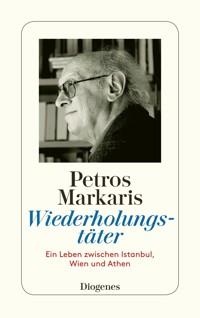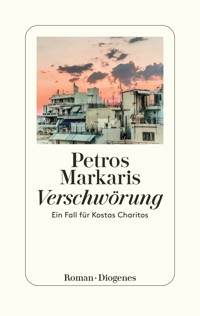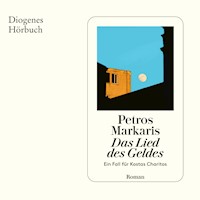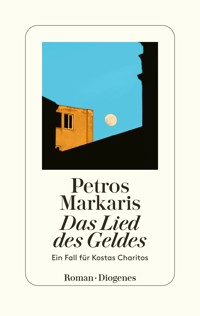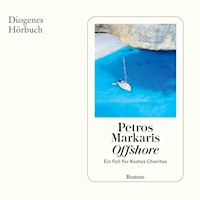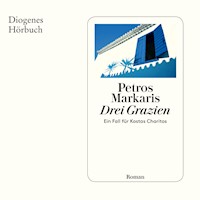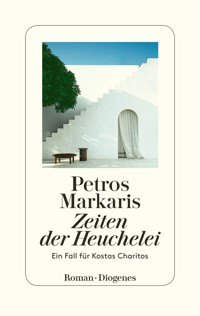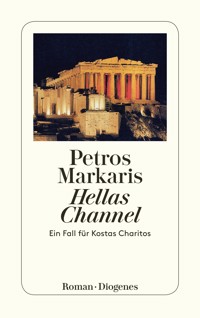
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Kostas Charitos
- Sprache: Deutsch
Er liebt es, Souflaki aus der Tüte zu essen, dabei im Wörterbuch zu blättern und sich die neuesten Amerikanismen einzuverleiben. Seine Arbeit bei der Athener Polizei dagegen ist kein Honigschlecken. Im Trubel um den Mord an der Reporterin von ›Hellas Channel‹ gelingt es Kostas Charitos dennoch stets, er selbst zu bleiben – ein hitziger Einzelgänger, ein Nostalgiker im modernen Athen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 518
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Petros Markaris
Hellas Channel
Ein Fall fürKostas Charitos
Roman
Aus dem Neugriechischen vonMichaela Prinzinger
Titel der 1995
bei Samuel Gavrielides Editions, Athen,
erschienenen Originalausgabe:
›Νυχτερινό δελτίο‹
Copyright © 1995 by Petros Markaris
Die deutsche Erstausgabe
erschien 2000 im Diogenes Verlag
Der Verlag dankt
dem griechischen Kulturministerium
für die Übersetzungsförderung
Umschlagfoto von G. Sioen
Copyright © Istituto Geografico
De Agostini, Novara
Für Sophia,
Rania und Philippos
Spät, aber doch
Alle Rechte vorbehalten
Copyright © 2013
Diogenes Verlag AG Zürich
www.diogenes.ch
ISBN Buchausgabe 978 3 257 23282 0 (23.Auflage)
ISBN E-Book 978 3 257 60322 4
Die grauen Zahlen im Text entsprechen den Seitenzahlen der im Impressum genannten Buchausgabe.
[5] 1
Jeden Morgen um Punkt neun starren wir einander wortlos an. Er steht vor meinem Schreibtisch. Sein Blick scheint ungefähr in Augenhöhe, irgendwo zwischen meinen Augenbrauen und Wimpern, hängenzubleiben. »Ich bin ein verdammter Wichser«, sagt er.
Nur mit seinem Blick sagt er es, er spricht es nicht aus. Ich sitze hinter meinem Schreibtisch und schaue ihm geradewegs in die Pupillen. Denn ich bin sein Vorgesetzter und darf ihm in die Augen starren. Er hingegen hat seinen Blick niederzuschlagen. »Ich weiß, daß du ein verdammter Wichser bist«, sage ich zu ihm. Kein Laut kommt über meine Lippen. Mein Blick spricht für sich. Diesen lautlosen Wortwechsel tauschen wir zwölf Monate im Jahr aus, mit Ausnahme der zwei Monate, in denen wir Urlaub haben. Zwölf Monate im Jahr, fünf Tage in der Woche, von Montag bis Freitag unterhalten wir uns wortlos, nur unsere Blicke sprechen. »Ich bin ein verdammter Wichser – Ich weiß, daß du ein verdammter Wichser bist.«
Auf jeder Dienststelle ist ein gewisser Prozentsatz Versager. Es können nicht alle gerissene Spürhunde sein, es müssen immer auch ein paar miese Stümper dabeisein. Thanassis gehört eindeutig in die zweite Kategorie. Er hatte sich in die Polizeischule eingeschrieben und dann die Ausbildung abgebrochen. Mit Mühe arbeitete er sich zum [6] Kriminalhauptwachtmeister hoch, und in dieser Position saß er sich den Arsch breit.
Er hatte keinen Funken Ehrgeiz. Er wollte einfach nicht weiterkommen. Von seinem ersten Arbeitstag an setzte er alles daran, mir unmißverständlich klarzumachen, daß er ein verdammter Wichser war. Und ich wußte seine Aufrichtigkeit zu schätzen. Sie bewahrte ihn vor allen schwierigen Missionen – den Nachtschichten, den Straßensperren, den Verfolgungsjagden. Ich setzte ihn für Büroarbeiten ein. Irgendein problemloses Verhör oder Tätigkeiten im Archiv, irgendeine Kleinigkeit im Briefverkehr mit der gerichtsmedizinischen Abteilung oder dem Ministerium. Dabei herrscht seit Jahren chronischer Personalmangel bei der Polizei, wir kommen den ganzen Einsätzen nicht hinterher. Er jedoch erinnert mich beständig und tagtäglich daran, daß er ein verdammter Wichser ist. Damit ich es nicht vergesse und er sich nicht irrtümlicherweise in einem Streifenwagen wiederfindet.
Nach einem kurzen Blick auf meinen Schreibtisch registriere ich, daß das Croissant und der Kaffee fehlen. Seine einzige regelmäßige Aufgabe besteht darin, mir jeden Morgen meinen Kaffee und mein Croissant zu bringen. Ich hebe den Blick und schaue ihn verwundert an.
»He, Thanassis, wo ist denn heute mein Frühstück geblieben? Hast du das vergessen?«
Während meiner Anfangszeit im Polizeidienst aßen wir alle Sesamkringel. Wir wischten mit der flachen Hand die Sesamkörner vom Tisch, während uns irgendein Totschläger, jugendlicher Strauchdieb oder gefinkelter Taschenspieler namens Dimos, Menios oder Lambros gegenübersaß.
[7] Thanassis grinst. »Der Chef hat angerufen und will Sie dringend sprechen. Ich dachte, ich bring es Ihnen später.«
Es ging bestimmt um den Albaner. Man hatte ihn um das Haus schleichen sehen, in dem wir letzten Dienstag das erschlagene Ehepaar aufgefunden hatten. Den ganzen Morgen über hatte die Haustür offengestanden. Doch keiner hatte sich die Mühe gemacht, einen Blick hineinzuwerfen. Was gibt es auch in einem verliesartigen Rohbau zu holen, wo das eine Fenster unverglast und das andere mit Brettern vernagelt ist? Schließlich faßte sich gegen Mittag eine neugierige Nachbarin, die die sperrangelweit geöffnete Tür beobachtet hatte, ein Herz. Sie brauchte etwa eine Stunde, um uns zu verständigen, da sie zwischendurch immer wieder in Ohnmacht fiel. Als wir eintrafen, waren gerade zwei Frauen dabei, ihr Wasser ins Gesicht zu spritzen. So wie man es mit Fischen macht, damit sie fangfrisch aussehen.
Eine nackte Matratze war auf dem Zementboden ausgebreitet. Darauf lag eine ungefähr fünfundzwanzigjährige Frau. An ihrem Hals klaffte eine Schnittwunde, die wie ein aufgerissener blutender Mund aussah. Ihre rechte Hand war in die Matratze verkrallt. Die Farbe ihres Nachthemds war nicht mehr zu erkennen. Es war blutüberströmt. Der Mann neben ihr war vielleicht fünf Jahre älter. Er war vornübergestürzt, und sein Brustkorb ragte über die Matratze hinaus. Seine Augen schienen auf einen Kakerlak zu starren, der in diesem Augenblick in aller Gemütsruhe vorbeimarschierte. Er hatte fünf Messerstiche im Rücken: drei aufeinanderfolgende waagrechte, von der Höhe des Herzens in Richtung der rechten Schulter über den Rücken verteilt, und zwei senkrechte, als ob der Mörder ihm den Buchstaben ›E‹ für [8] sein Ende in den Rücken ritzen wollte. Die ganze Behausung sah aus, als wären ihre Bewohner von einer Hölle in die nächste unterwegs. Ein Klapptisch, zwei Plastikstühle und eine Gasflasche mit einer Kochflamme.
Zwei erschlagene Albaner sind für die Fernsehsender nur von Interesse, wenn die Schlächterei sich gut fotografieren läßt und den Leuten ordentlich Brechreiz verursacht, bevor sie sich um neun zum Abendessen setzen. Früher gab es Sesamkringel und Griechen. Heute Croissants und Albaner.
Wir brauchten eine knappe Stunde für die erste Phase der Untersuchungen: die beiden Leichen zu fotografieren, die Fingerabdrücke abzunehmen, die fünf Fundstücke in Plastikbeutel zu packen und die Tür zu versiegeln. Nicht einmal der Gerichtsmediziner bemühte sich an den Tatort. Er begnügte sich damit, die Leichen im Seziersaal in Empfang zu nehmen. Eine Hausdurchsuchung war nicht nötig. Was sollte man auch durchsuchen? Es stand ja nicht einmal ein Schrank in dem Zimmer. Die paar Kleiderfetzen der Frau hingen an einem Haken an der Wand. Die des Mannes lagen neben ihm, auf dem Zementboden.
»Sollten wir nicht nach Geld suchen?« fragte mich Sotiris, der pingelige Kriminalobermeister.
»Du kannst ruhig danach suchen und es einsacken, aber du wirst keine einzige Drachme finden. Sei es, weil sie gar kein Geld hatten oder weil der Mörder alles mitgenommen hat. Was nicht heißen soll, daß es sich notwendigerweise um Raubmord handelt. Denn auch wenn es ein Rachedelikt war – das Geld hätte er auf jeden Fall eingesteckt. Die lassen doch nichts liegen!« Er suchte herum und fand schließlich ein Loch in der Matratze. Ohne Geld.
[9] Die Nachbarn hatten nichts bemerkt. Das behaupteten zumindest alle. Kann sein, daß sie uns gegenüber schwiegen, um dann um so effektvoller vor laufender Kamera auszusagen. Uns blieb nur, zur Durchführung der zweiten Phase in die Dienststelle zurückzukehren: um einen Bericht zu schreiben, der geradewegs ins Archiv wandern würde. Wozu nach dem Mörder suchen? Es wäre verlorene Liebesmüh.
Als wir gerade dabei waren, die Unterkunft zu versiegeln, tauchte sie plötzlich wie ein Tagmond auf. Ihr rundes Gesicht leuchtete ebenso wie ihre glänzende Bluse, in der sich zwei große Brüste den Platz streitig machten. Ihren Hintern hatte sie in einen engen Rock gezwängt, daher war er hinten etwas kürzer. Ihre Füße steckten in lilafarbenen Pantoffeln. Ich saß gerade im Streifenwagen, als ich sie auf die zwei Männer zugehen sah, die die Tür versiegelten. Sie flüsterte ihnen etwas zu, und die beiden deuteten auf mich. Sie machte kehrt und kam auf mich zu.
»Wo kann ich mit Ihnen sprechen?« fragte sie, als ginge es um ein heimliches Rendezvous.
»Hier auf der Stelle. Schießen Sie los…«
»In den letzten Tagen hat sich ein Mann in der Nähe des Hauses herumgetrieben. Er klopfte an und wollte rein, doch die Frau hat ihn jedesmal abgewiesen und ihm die Tür vor der Nase zugeschlagen. Er war mittelgroß, dunkelblond, mit einer Narbe an der linken Wange. Er trug eine hellblaue Sportjacke, am Knie geflickte Jeans und Turnschuhe. Vorgestern habe ich ihn zum letzten Mal gesehen. Er hat geklopft, und sie hat die Tür wieder zugeschlagen.«
»Und warum haben Sie das nicht dem Kriminalbeamten gesagt, der die Verhöre durchgeführt hat?«
[10] »Ich habe es mir eben gut überlegt. Ich wollte nicht in irgendeinen Prozeß hineingezogen werden.«
Wie oft saß sie wohl am Fenster und beobachtete die Straße, die Nachbarn und die Passanten? Wahrscheinlich trat sie gleich nach dem Aufstehen ihre Schicht am Fenster an, nur unterbrochen von Kochen und Essen.
»Na schön. Wenn wir Sie brauchen, werden wir auf Sie zurückkommen.«
Im Büro wollte ich die Angelegenheit spontan ins Archiv abschieben. Wir haben genug mit Terroristen, Einbrüchen, Rauschgiftdelikten zu tun – wer hat die Zeit, sich mit Albanern herumzuschlagen? Es war ja schließlich kein Grieche zu Schaden gekommen. Keiner von denen, die im Zeitalter der Croissants schnell in eine ›Snackbar‹ oder ›Crêperie‹ gehen. Dann sähe die Sache anders aus. Untereinander können die Albaner aufführen, was sie wollen. Solange wir genügend Krankenwagen für ihren Abtransport haben.
Wenn jemand behauptet, daß man aus seinen Fehlern lernt, kann ich nur lachen. Immer wieder tappe ich in dieselbe Falle. Anfangs sage ich mir noch, daß ich mich in die Sache nicht reinhängen werde. Doch dann beginnt der Holzwurm im Gebälk zu arbeiten. Vielleicht weil mich das Büro anödet oder weil noch ein kleiner Überrest kriminalistischer Neugier in mir steckt, der noch nicht von der ganzen Routine aufgefressen wurde. Dann ergreift mich manchmal die Lust, tätig zu werden. Ich schickte also die Beschreibung des Albaners, die mir die Dicke gegeben hatte, über Funk an andere Polizeidienststellen. Meistens muß man in solchen Fällen nicht lange suchen. Man braucht nur bestimmte Athener Plätze abzuklappern, den Omonia-[11] Platz, den Vathis-Platz, den Kotzia-Platz, den Koumoundourou-Platz, den Bahnhofsplatz der Hochbahn in Kifissia, eben ganz bestimmte Athener Plätze… Die Welt ist wie ein zoologischer Garten unter umgekehrten Vorzeichen. Wir Menschen sind in Käfige eingesperrt, und die Tiere streifen auf den Plätzen umher und beobachten uns. Trotzdem hatte ich so eine Vorahnung, daß unsere Suche diesmal erfolglos bleiben würde. Ich hatte nicht die geringste Hoffnung, ihn zu finden. Erstaunlicherweise bekamen wir ihn aber nach drei Tagen expreß aus Loutsa zugeschickt.
Die Dicke tanzte in derselben Aufmachung wie am Tatort an. Nur trug sie diesmal ein Paar altmodische hochhackige Schuhe, deren Absätze bei jedem ihrer Schritte unter ihrem Gewicht einzuknicken drohten. Die Stöckel bogen sich gefährlich nach innen, dann wieder bereuten sie die unerwartete Nähe, rissen sich voneinander los und bogen sich nach außen. »Der ist es!« rief sie aus, als sie den Albaner erblickte. Ich glaubte ihr aufs Wort und dankte Gott dem Herrn, daß ich sie nicht zur Nachbarin hatte und tagein, tagaus vor ihr Revue passieren mußte. Ihr entging nichts.
Aus diesem Grund also zitierte mich der Chef zu sich. Um mich zu fragen, wie das Verhör voranging. Und deshalb hatte mir Thanassis das Frühstück nicht gebracht. In der sicheren Annahme, daß ich alles stehen- und liegenlassen würde, um zum Chef zu laufen.
»Deine Aufgabe ist es, mir mein Croissant und meinen Kaffee zu bringen. Wann ich zum Chef gehe, entscheide ich selbst«, sage ich unwirsch zu ihm und vergrabe mich in meinen Bürosessel, um zu signalisieren, daß ich mich den ganzen Morgen über nicht aus dem Büro rühren werde.
[12] Das Grinsen verschwindet schlagartig von seinen Lippen. Seine ganze Selbstsicherheit ist wie weggeblasen. »Ja, jawohl«, stottert er.
»Bist du noch nicht fort?«
Er macht auf der Stelle kehrt und stürzt aus dem Büro. Ich warte eine Minute, dann stehe ich auf, um zum Chef zu gehen. Thanassis ist imstande, mich zu verpfeifen und weiterzutratschen, daß ich dem Chef die kalte Schulter zeigen wollte. Der Chef ist mit allen Wassern gewaschen und hat überall seine Finger drin. Der kann einem schaden, wenn er will. Außerdem ist er auch noch komplexbeladen. Da gebe ich lieber klein bei.
[13] 2
Mein Büro hat die Nummer 321 und liegt in der dritten Etage. Das Büro des Leitenden Kriminaldirektors liegt in der fünften. Der Fahrstuhl hat seine Macken. Je nachdem schwankt die Wartezeit zwischen fünf und zehn Minuten. Wenn man ungeduldig wird und ununterbrochen auf den Knopf drückt, dann kann es bis zu einer Viertelstunde dauern. Man hört ihn schon in die zweite Etage hochächzen und jubelt bereits, doch plötzlich macht er reuevoll kehrt und fährt wieder abwärts. Manchmal packt mich die Wut, und ich beginne in Riesensätzen die Treppen hochzulaufen. Nicht etwa, weil ich es so eilig hätte, sondern weil ich meinen Ärger loswerden muß. Manchmal packt mich der Trotz, und ich frage mich: Wozu renne ich mir wie ein Irrer die Hacken ab? Es beeilt sich ja auch sonst keiner! Selbst die automatische Tür des Fahrstuhls hat man so eingestellt, daß sie im Schneckentempo aufgeht.
In der fünften Etage sind die höheren Chargen untergebracht. Man hat sie vermutlich dort zusammengezogen, damit sie kollektiv ihre Denkarbeit verrichten können. Oder damit man sie kollektiv von uns anderen absondert, um zu verhindern, daß sie uns von der Arbeit abhalten. Das kommt auf den Blickwinkel an.
Das Büro des Leitenden Kriminaldirektors trägt die Nummer 504, doch an der Tür steht keine Zahl. Er hat sie [14] abmontieren lassen. Er fühlte sich wahrscheinlich wie in einem Krankenhaus oder einem Hotel, und nicht wie unser Chef. Statt dessen ließ er ein Schild anbringen: Nikolaos Gikas – Leitender Kriminaldirektor. »In Amerika gibt es gar keine Nummern an den Türen. Nur Namen«, pflegte er drei Monate lang immer wieder zornentbrannt von sich zu geben. Er redete so lange davon, bis er schließlich zur Tat schritt, die Nummer abnahm und seinen Namen dranschreiben ließ. Das blieb die einzige Reform, die er nach seinem sechsmonatigen Fortbildungsseminar beim FBI durchführte.
»Treten Sie ein, er erwartet Sie schon«, sagt Koula, die aufgedonnerte Polizeitippse, die sich bei ihm als Sekretärin verdingt hat.
Das Büro ist groß und hell, mit Spannteppich am Boden und Gardinen vor den Fenstern. Ursprünglich sollten alle Büros Gardinen erhalten, doch das Budget war bald ausgeschöpft, und so beschränkte man sich auf die fünfte Etage. Neben der Tür befindet sich eine Sitzecke für Besucher mit einem rechteckigen Tisch und sechs Stühlen. Der Chef sitzt mit dem Rücken zum Fenster, sein Schreibtisch ist gut drei Meter lang. Ein modisches Modell mit Metallbeschlägen an den Ecken. Benötigt man ein Schriftstück vom anderen Ende des Schreibtisches, dann braucht man einen Kran mit Greifarmen.
Ich sehe auf und bemerke, daß sein Blick auf mir ruht. »Etwas Neues in der Albanerfrage?« meint er.
»Nichts von Belang, Chef. Das Verhör ist aber noch nicht beendet.«
»Noch Beweismaterial aufgetaucht?« Knappe Fragen, [15] knappe Antworten. Das ist sein Stil: nur das Notwendigste, um zu verstehen zu geben, daß er erstens gestreßt, zweitens effektiv und drittens auf das Wesentliche und Konkrete beschränkt ist. Amerikanischer Stil, wie gesagt.
»Nein. Aber, wie Sie wissen, haben wir eine Augenzeugin, die ihn wiedererkannt hat.«
»Das bedeutet noch nicht unbedingt, daß sie ihn belastet. Sie hat ihn um das Haus schleichen sehen. Sie hat ihn weder rein- noch rausgehen sehen. Fingerabdrücke?«
»Jede Menge. Die meisten vom Ehepaar. Keine vom Verdächtigen. Tatwaffe wurde auch nicht gefunden.« Er verleitet mich auch zum Telegrammstil, der Holzkopf.
»Gut. Sagen Sie den Journalisten, daß es vorläufig keine offiziellen Erklärungen geben wird.«
Das hätte er sich sparen können. Denn wenn es eine Presseerklärung gibt, dann verliest er sie stets selbst. Ich muß ihm vorher alles fein säuberlich aufschreiben, und er lernt es dann Wort für Wort auswendig. Das sage ich jetzt nicht etwa, weil ich mich zurückgesetzt fühle. Es stört mich absolut nicht. Die Reporter liegen mir ohnehin im Magen. Das ist so wie mit dem Sesamkringel und dem Croissant. Früher gab es Journalisten und Tageszeitungen, heutzutage Reporter und Kameras.
Auf einer Dienstleitung lasse ich den Albaner zum Verhör rufen. Es findet in einem schmucklosen Büro mit nackten Wänden, einem Tisch und drei Stühlen statt. Als ich eintrete, sitzt der Albaner in Handschellen auf einem Stuhl.
»Soll ich ihm die Handschellen abnehmen?« fragt der Kriminalbeamte, der ihn hereingeführt hat.
[16] »Vorerst nicht. Warten wir lieber ab, ob er sich als Mensch oder Schweinehund erweist.«
Ich betrachte mir den Albaner. Seine Hände ruhen auf der Tischkante. Zwei schwielige Hände mit dicken Fingern und langen Nägeln mit schwarzen Trauerrändern. Sein Blick fällt auf sie. Er sieht sie verwundert an, wie zum allerersten Mal. Worüber wundert er sich? Daß er mit ihnen getötet hat? Oder daß sie so feist und dreckig sind? Oder daß Gott ihn mitsamt diesen Händen erschaffen hat?
»Sagst du mir nun, warum du sie umgebracht hast?« frage ich.
Er löst langsam den Blick von seinen Händen. »Haste Zigarett?«
»Geben Sie ihm eine von Ihren«, sage ich zu dem Kriminalbeamten.
Er schaut mich überrascht an. Will ich wirklich eine Zigarette schnorren? Scharfe Auffassungsgabe, der Junge! Er raucht Marlboro, während ich bei einer griechischen Marke geblieben bin. Ich gebe dem Albaner eine Marlboro, um ihn in Sicherheit zu wiegen. Der Beamte steckt ihm die Zigarette in den Mund, und ich zünde sie ihm an. Er saugt gierig zwei tiefe Züge ein. Er hält den Rauch in seiner Lunge förmlich gefangen. Dann läßt er ihn ganz langsam wieder herausströmen, um ihn möglichst lange zu genießen. Er hebt beide Hände gleichzeitig hoch und klemmt die Zigarette zwischen Daumen und Zeigefinger seiner rechten Hand.
»Ich nix umbringen«, sagt er, und im selben Augenblick bewegen sich seine beiden Hände blitzschnell mit der Zigarette zum Mund. Gleichzeitig schwillt seine Brust, um den [17] Rauch aufzunehmen. Sein Instinkt sagt ihm, daß ich ihm die Zigarette gleich wieder wegnehmen werde, da ich von ihm nicht das Erwünschte gehört habe. Deshalb raucht er so hastig.
»Du hältst mich wohl zum Narren, du Hurenbock, du Scheißalbaner!« schreie ich außer mir. »Ich hänge dir sämtliche unaufgeklärten Morde an, in die albanische Penner in den letzten drei Jahren verwickelt waren. Da kriegst du lebenslänglich, und außerdem scheiß ich auf deinen Berisha!«
»Ich drei Jahre nicht hier. Ich kommen –«, er hält inne, weil er den Ausdruck für ›letztes Jahr‹ nicht kennt und nach einem anderen Wort sucht. »Ich kommen zweiundneinzig«, ergänzt er – zufrieden, daß er die sprachliche Hürde genommen hat. Jetzt hält er seine Hände unter dem Tisch verborgen, damit ich nicht mehr an die Zigarette denke.
»Und wie willst du das beweisen? Mit deinem Paß, du Arschgeige?«
Plötzlich stürze ich auf ihn los, packe ihn am Kragen und reiße ihn in die Höhe. Darauf war er nicht vorbereitet. Seine Hände knallen gegen die Unterkante des Tisches, und die Zigarette fällt ihm aus den Fingern. Er wirft einen flüchtigen, besorgten Blick auf die Zigarette unter dem Tisch, danach richtet er ihn beunruhigt auf mich. Der Kriminalbeamte tritt mit einem genüßlichen Grinsen die Zigarette aus. Kluger Junge, er hat die Sachlage erfaßt.
»Du bist illegal nach Griechenland eingereist, du tauchst in keiner Statistik auf, hast weder Visum noch Einreisestempel. Du bist ein absolutes Nichts. Wenn du verschwindest, fragt keiner, was aus dir geworden ist. Niemand hat dich je [18] gesehen und je gekannt, weil du überhaupt nicht existierst! Du existierst überhaupt nicht, hörst du?«
»Ich wegen Frau kommen«, sagt er erschrocken, während ich ihn hin- und herschüttle.
»Du warst scharf auf sie, was?« Ich lasse ihn wieder auf den Stuhl fallen.
»Ja.«
»Deshalb hast du dich den ganzen Tag vor dem Haus herumgetrieben. Du wolltest sie aufs Kreuz legen, aber sie hat dir nicht aufgemacht.«
»Ja«, wiederholt er und lächelt zufrieden, weil ich psychologisch ins Schwarze getroffen habe.
»Und weil sie dir nicht geöffnet hat, hast du rot gesehen, bist in der Nacht eingedrungen und hast die beiden abgeschlachtet!«
»Nein!« schreit er voll Furcht auf.
Ich sitze auf meinem Stuhl und blicke ihm in die Augen. Ich sage nichts und lasse ein wenig Zeit vergehen. Er kann sich mein Schweigen nicht erklären, und seine Angst wächst. Glücklicherweise merkt er nicht, daß ich mich in eine Sackgasse manövriert habe. Was soll ich jetzt mit ihm anfangen? Soll ich ihm die Essensration entziehen? Das geht ihm am Arsch vorbei, denn er ißt ohnehin nur alle drei Tage. Soll ich zwei durchtrainierte Hünen herbeordern, die ihm die Fresse polieren? Der hat schon so viel Schläge eingesteckt in seinem Leben, der nimmt sein Schicksal ohne zu murren hin und läßt den lieben Gott einen guten Mann sein.
»Hör zu«, meine ich ruhig und sanft. »Alles, was wir jetzt besprochen haben, schreibe ich auf, und du setzt deine Unterschrift drunter. Dann laß ich dich in Ruhe.«
[19] Er sagt nichts. Er sieht mich nur unentschlossen und zweifelnd an. Das Gefängnis schreckt ihn nicht. Er hat einfach nur gelernt, mißtrauisch zu sein. Er glaubt nicht daran, daß das Übel eines Tages ein Ende hat und er aufatmen kann. Er fürchtet, wenn ihm das eine Delikt nachgewiesen wird, dann wird ihm sogleich ein zweites und ein drittes in die Schuhe geschoben. So war das immer gewesen in seinem Leben.
Ich muß wohl noch etwas nachhelfen, um ihn zu überzeugen. »Im Endeffekt geht’s dir im Gefängnis gar nicht schlecht«, sage ich in freundschaftlichem Plauderton zu ihm. »Da hast du dein eigenes Bett, dreimal Essen am Tag, und alles gratis. Du tust nichts, und trotzdem ist für dich gesorgt, so wie früher bei euch daheim. Und wenn du schlau bist, dann schließt du dich in kürzester Zeit einer Bande an und sackst auch noch Gewinn ein. Das Gefängnis ist der einzige Ort, an dem keine Arbeitslosigkeit herrscht. Mit ein bißchen Grips kommst du da mit einer Menge Ersparnisse wieder raus.«
Er blickt mich unausgesetzt stumm an. Nur in seinem Auge blitzt ein Funke auf, als ob ihm die Idee gefiele. Ich sage jedoch nichts. Ich weiß, daß er darüber nachdenken will, und stehe auf. »Du mußt mir nicht sofort antworten«, meine ich. »Überleg es dir, und wir sprechen morgen darüber.«
Während ich zur Tür gehe, sehe ich, daß der Kriminalbeamte ihm noch eine Marlboro anbietet. Diesen Jungen muß ich in meine Abteilung versetzen lassen und in meine Obhut nehmen.
Vor meinem Büro drängeln sie sich schon. Die einen [20] halten Mikrofone in der Hand, die anderen Aufnahmegeräte. Alle haben sie diesen lechzenden ruhelosen Blick. Eine Schar Heißhungriger, die auf die neueste Nachricht wartet wie der Soldat auf die Gulaschkanone. Die Kameraleute sehen mich kommen und schultern ihre Geräte.
»Kommt rein, Leute.« Ich öffne die Tür zu meinem Büro, und zu mir selbst sage ich: »Geht doch alle zum Teufel, Kanaillen, und laßt mich in Ruhe!« Alle zwängen sich hinter mir herein und plazieren auf meinem Schreibtisch die Mikrofone mit den Kürzeln ihrer Sender, die Kabel und die Aufnahmegeräte. Innerhalb weniger Minuten hat sich mein Schreibtisch in einen Trödelladen verwandelt.
»Was haben Sie uns Neues über den Albaner zu sagen, Kommissar?« fragt mich Sotiropoulos. Er trägt ein gestreiftes Hemd von Armani, einen britischen Trenchcoat, Wildlederschuhe der Marke Timberland und eine Brille mit einer runden Metallfassung, wie sie früher vom seligen Himmler getragen und später von Intellektuellen wiederentdeckt wurde. Die Anrede ›Herr‹ hat er schon seit geraumer Zeit fallengelassen, er sagt einfach ›Kommissar‹. Jedesmal beginnt er seine Frage mit ›Was haben Sie uns zu sagen‹, um mich in die Position eines Prüflings zu drängen, den er zu benoten hat. Nun ja, er meint, aus ihm spreche die Stimme des Volkes. Und vor dem Volk gelten keine Unterschiede. Da fällt eine gewisse Höflichkeitsform schnell unter den Tisch. Sein wachsames Auge läßt nie von dir ab, es ist jederzeit bereit, dich zu prüfen und zu mahnen. Der moderne Robespierre mit Kamera und Mikrofon.
Ich übersehe ihn geflissentlich und wende mich an alle zusammen. Will er Gleichberechtigung, so soll er sie haben. [21] »Ich habe Ihnen nichts mitzuteilen, meine Damen und Herren«, sage ich mit einem freundlichen Lächeln. »Das Verhör ist noch nicht abgeschlossen.«
Sie schauen mich enttäuscht an. Eine kleine Runzlige mit roten Strümpfen macht noch einen Versuch, mir eine weitere Information zu entreißen. Nur so, wegen der Berufsehre.
»Haben Sie Hinweise, daß er der Mörder sein könnte?« fragt sie.
»Ich sagte Ihnen doch, wir verhören ihn noch immer«, entgegne ich. Und um ihnen zu signalisieren, daß die Diskussion beendet ist, nehme ich das Croissant, das mir Thanassis hingelegt hat, aus der Zellophanhülle und beiße herzhaft hinein.
Sie beginnen ihre Utensilien zusammenzupacken, und mein Schreibtisch nimmt wieder gesunde Formen an. Wie ein Todkranker, den man nach überstandener Krise vom Beatmungsgerät abkoppelt.
Janna Karajorgi bleibt als letzte zurück. Sie läßt sich absichtlich Zeit und wartet, bis die anderen draußen sind. Die kann ich noch weniger als alle anderen ausstehen. Nur so, ohne bestimmten Grund. Sie sieht nicht älter als fünfunddreißig aus, ist immer elegant gekleidet, ohne exaltiert zu wirken. Weite Hosen, Jackett, teure Halskette mit einem Kreuz oder Medaillon. Ich weiß nicht warum, aber ich kann mich des Gedankens nicht erwehren, daß sie lesbisch ist. Sie ist eine schöne Frau, doch ihr kurzes Haar und die Kleidung lassen sie männlich wirken. Kann natürlich sein, daß nichts von alledem zutrifft und mich nur meine krankhafte Phantasie aufs Glatteis führt. Jetzt steht sie neben der Tür. Sie [22] wirft einen Blick hinaus, um zu prüfen, ob sich die anderen entfernt haben. Dann schließt sie die Tür. Ich esse mein Croissant weiter, als ob nichts geschehen wäre.
»Wissen Sie, ob das getötete Ehepaar Kinder hatte?« fragt sie mich plötzlich.
Ich wende mich ihr überrascht zu. Sie hat ihren arroganten Blick aufgesetzt und lächelt mich an. Genau diese aus der Luft gegriffenen Fragen sind es, die mich aufregen. Die sie spontan in den Raum wirft und mit einem ironischen Lächeln unterstreicht, um dir zu verstehen zu geben, daß sie mehr weiß als du und es dir nicht sagt. Um dich damit zu quälen. Sie weiß nichts, sie tappt im dunkeln.
»Meinen Sie, daß es Kinder gibt und wir sie übersehen hätten?«
»Möglicherweise waren sie nicht mehr dort, als die Polizei den Tatort aufsuchte.«
»Was soll ich Ihnen dazu sagen? Vielleicht haben ihre Eltern sie an eine amerikanische Universität geschickt. In diesem Fall hat man sie noch nicht ausfindig machen können.«
»Ich meine keine erwachsenen Kinder, sondern ganz kleine Kinder«, entgegnet sie. »Im Krabbelalter, höchstens zweijährig.«
Irgend etwas weiß sie und amüsiert sich dabei, mit mir rumzuspielen. Ich entschließe mich dazu, ihr auf die sanfte und freundliche Tour entgegenzukommen. Vielleicht kann ich so an ihr journalistisches Ehrgefühl appellieren. Ich biete ihr den Stuhl vor meinem Schreibtisch an.
»Setzen Sie sich doch, und reden wir in aller Ruhe über das Ganze«, sage ich.
»Unmöglich, ich muß zum Sender. Ein andermal.« [23] Schlagartig scheint sie Taranteln im Hintern zu haben. Das macht sie absichtlich, die Hure, um mich auf Nadeln sitzen zu lassen.
Als sie die Tür öffnet, trifft sie auf Thanassis, der gerade mit einem Schriftstück das Zimmer betreten will. Sie blicken sich in die Augen, und die Karajorgi lächelt ihn an. Thanassis wendet schnell seinen Blick ab, doch die Karajorgi läßt ihre Augen eindringlich und herausfordernd auf ihm ruhen. Es sieht so aus, als ob sie scharf auf ihn wäre. Damit zeigt sie keinen schlechten Geschmack, denn Thanassis sieht durchaus gut aus. Großgewachsen, dunkelhäutig, kräftig gebaut. Ich werde ihn wohl auf sie ansetzen müssen, um zwei Dinge herauszufinden: erstens, ob sie tatsächlich etwas über die Albaner weiß und es vor mir verbirgt, und zweitens, ob sie lesbisch ist.
Sie winkt mir zu, als wolle sie mich zum Abschied freundschaftlich grüßen. Doch in Wirklichkeit will sie mir damit zu verstehen geben: ›Warte, bis du schwarz wirst, du Pfeife.‹ Sie schließt die Tür hinter sich. Thanassis kommt auf mich zu und überreicht mir das Schriftstück.
»Der Obduktionsbefund des albanischen Ehepaars«, sagt er. Das Augenspiel mit der Karajorgi hat ihn in Verlegenheit gebracht, und seine Hand zittert, als er mir das Blatt Papier übergibt. Er ist sich nicht sicher, ob ich es bemerkt habe und wie ich darauf reagieren werde.
»Gut«, sage ich zu ihm, »laß den Befund hier.« Ich bin nicht in der Stimmung, ihn zu lesen. Was soll er mir denn Neues sagen? Was die Leichen zu offenbaren hatten, war mit bloßem Auge zu erkennen. Nur die genaue Tatzeit war nicht ersichtlich, aber die hat auch wenig Bedeutung. Wäre ja noch [24] schöner, wenn der Albaner ein glaubwürdiges Alibi nachweisen könnte und wir es ihm widerlegen müßten. Die Karajorgi weiß auch nichts. Sie blufft, wie alle Reporter. Sie will meine Neugier anstacheln und mich dazu bringen, ein paar Informationen lockerzumachen. Es gibt keine Kinder. Wenn es welche gäbe und sie verschwunden wären, hätten wir das von den Nachbarn erfahren.
[25] 3
Adriani starrt in den Fernseher. Vor geschlagenen fünf Minuten habe ich das Wohnzimmer betreten, und noch immer beachtet sie mich in keiner Weise. Sie hält die Fernbedienung krampfhaft umklammert. Doch ihr Zeigefinger ist jederzeit bereit, den Sender zu wechseln, sobald der Werbeblock über die Zuschauer hereinbricht. Auf dem Bildschirm knurrt ein kraushaariger Polizeibeamter eine dunkelblonde Frau an. Jeden Abend treffe ich auf ihn, entweder verhört er gerade jemanden, oder er trägt Gewissensbisse zur Schau. In beiden Fällen knurrt er. Wären Polizisten tatsächlich so wie im Fernsehen, dann säßen wir alle mit Vierzig nach einem Herzinfarkt im Rollstuhl.
»Wozu fletscht er denn die ganze Zeit die Zähne, der Wichser?« frage ich unvermittelt. ›Wichser‹ füge ich deswegen hinzu, weil ich weiß, daß es sie auf die Palme bringt, wenn ich mich verächtlich über die Helden ihrer Lieblingsserien äußere. Ich will sie aufstacheln, damit sie mir Beachtung schenkt. Doch ich habe mich verrechnet.
»Ssst!« zischt sie heftig, während ihr Blick immer noch an dem uniformierten Kraushaarigen hängt. »Was glotzt du denn, du Armleuchter! Mach endlich den Mund auf!« pflegte mir mein Vater zuzurufen, bevor er mir eine Ohrfeige verpaßte. Was er jetzt wohl täte, wo doch keiner mehr den Mund aufmacht und jeder bloß in die Glotze [26] starrt. Gut, daß er tot ist, der Alte verstünde die Welt nicht mehr.
Wie jeden Abend ziehe ich mich ins Schlafzimmer zurück und nehme das Wörterbuch von Dimitrakos aus dem Regal. Die Ablage mit vier Querbrettern bedeutungsvoll ›Bücherregal‹ zu nennen wäre eine heillose Übertreibung. Auf dem obersten Brett befinden sich die Wörterbücher: das Große Lexikon der griechischen Sprache von Liddell-Scott, das Rechtschreib- und Bedeutungswörterbuch von Dimitrakos, das Lexikon der sinn- und sachverwandten Wörter von Vostantzoglou, das Herkunftswörterbuch von N.P. Andriotis und das griechische Lexikon von Tegopoulos-Fytrakis. Wörterbücher sind mein einziges Hobby. Ich bin weder Fußballanhänger noch Heimwerker. Wenn irgend jemand unser Bücherregal betrachtet, wird er sich wundern. Denn nur das oberste Brett beeindruckt durch die Sammlung der Wörterbücher. Schweift der Blick über die drei weiteren Regalböden, drängeln sich dort Schundromane und Billigdrucke. Ich habe sozusagen das Dachgeschoß für mich reserviert und die drei unteren Etagen Adriani überlassen. Oben zusammengestoppeltes Wissen, unten erniedrigender Verfall. Als wollte man ganz Griechenland auf vier Brettern darstellen.
Ich nehme das Dimitrakos-Lexikon in den Arm und lege mich ins Bett. Ich öffne es unter dem Eintrag sehen.
»Der menschliche Geist sieht und hört alles«, sagte mein Vater immer. Jeden Abend, eine halbe Stunde vor seiner Heimkehr, legte ich die aufgeschlagenen Schulbücher auf [27] den Küchentisch und stürzte mich in die Hausaufgaben. Um ihm zu zeigen, daß ich mit Feuereifer dabei war. Er blieb in der Uniform des Polizeimeisters an der Türschwelle stehen und sah mich an. Ich gab keinen Mucks von mir. Ich war so in das Studium versunken, daß keinerlei Störung meine Wahrnehmung erreichte. Mit einem Mal trat er auf mich zu, packte mein Ohr und zog mich langsam vom Stuhl hoch.
»Schon wieder ein ›ungenügend‹ im Rechnen, du Armleuchter«, sagte er.
Ich hatte die Note noch gar nicht erfahren, denn die Arbeit sollte erst am nächsten Tag zurückgegeben werden. Er wußte immer schon am Vortag Bescheid.
»Woher weißt du das?« fragte ich verwundert.
»Der menschliche Geist sieht und hört alles«, war seine Antwort.
Bis ich eines Tages zufällig in seinem Büro bei der Gendarmerie war und begriff, daß es nicht der menschliche Geist war, der alles sah und hörte. Es war das Telefon, das klingelte. Mein Vater hatte dem Rechenlehrer eine kleine Gefälligkeit unter Freunden erwiesen, ihm einen Jagdschein verschafft oder etwas Ähnliches. Und der Rechenlehrer rief ihn jedesmal sofort an, sobald er meine Arbeit in Händen hielt, um sich für sein Entgegenkommen zu revanchieren. Das Seltsame ist, daß ich, immer wenn ich mir eines guten Ergebnisses sicher war, nur ein knappes ›mangelhaft‹ oder gar ein ›ungenügend‹ einheimste. Im Jahreszeugnis dagegen benotete er mich stets mit ›gut‹, damit sich mein Vater freute, daß die Gefälligkeit nicht umsonst gewesen war.
»Liegst du schon wieder mit den Schuhen auf dem Bett?« höre ich Adriani kreischen und schnelle in die Höhe. Aus, [28] Schluß mit dem Tagtraum. Was entspricht der Dauer eines Traums? Die Länge einer Fernsehserie. Ende der Fernsehserie, Ende des Traums.
»Sobald du nach Hause kommst, stürzt du dich auf dieses blöde Buch, statt dich mit mir zu unterhalten. Wo ich doch den ganzen Tag einsam herumsitze. Und wenn du dann endlich da bist, verdreckst du mir das Bett mit deinen Mistschuhen.«
»Wie soll ich mich denn mit dir unterhalten, wenn du nicht vom Fernseher hochsiehst und mir kaum guten Abend wünschst?«
»Das war gerade die spannendste Stelle. Warum kannst du nicht mal fünf Minuten warten? Warum mußt du immer schnurstracks zu deinen Haarspaltereien laufen?« ›Haarspaltereien‹ nennt sie den Inhalt der Wörterbücher. »Hast du immer noch nicht genug davon? Zwanzig Jahre lang liest du immer wieder dieselben Wörter! Ich an deiner Stelle könnte sie schon im Schlaf aufsagen!«
»Dumme Gans, du meinst, ich soll mir den idiotischen Bullen anschauen, den ich, wenn er in meiner Truppe wäre, längst zum Patronenzählen abkommandiert hätte? Oder die zweite Halbzeit mit dieser Zimtzicke abwarten, die so tut, als wäre sie Staatsanwältin und sich sechshundert Folgen lang nicht dazu durchringen kann, mit ihrem Mann ins Bett zu gehen?«
»Ach du«, sagt sie herablassend, »du bist so beschränkt, daß du eben mit dem Glamour der Filmwelt nichts anfangen kannst.«
Sie dreht sich um und rauscht hinaus wie eine Diva. Sie hat es geschafft, mir einen Stachel ins Fleisch zu setzen. [29] Denn ich weiß nicht genau, was Glamour bedeutet. Und außerdem weiß ich auch nicht, woher sie das Wort kennt, mit dem sie sich wichtig macht.
Ich gehe zum Bücherregal und ziehe das Oxford English-Greek Learner’s Dictionary heraus, das einzige Englischwörterbuch in meinem Besitz. Ich hatte es mir im Jahr ’77 zugelegt, als ich bei der Suchtgiftfahndung war und man uns Ausländer zum Verhör brachte, die in Indien gewesen waren. Angeblich auf der Suche nach einem Guru. Doch sie kehrten mit jeder Menge gelblichem Tabak, Halsketten mit enormen Amuletten und Schnee zurück, den sie zusammengerollt wie Fieberzäpfchen zwischen ihren Arschbacken nach Griechenland einführten. Damals entschloß ich mich, ein paar Brocken Englisch zu lernen, um sicherzugehen, daß mir nicht irgendeine strähnige Rothaarige ein fuck you! hinwirft und ich nicht einmal weiß, ob sie mich beschimpft oder nur was zu essen will.
Ich suche den Eintrag zu Glamur, aber ich kann ihn nicht finden. Dann suche ich unter Glamor und werde auf Glamour verwiesen. Die verdammten Engländer springen zwischen o und ou hin und her, nur um mir das Leben schwerzumachen. Glamour also.
Blendender, betörender Glanz, dem etwas Mythisches anhaftet. Glamourous film stars: blendende, betörende Filmstars.
Das also wollte sie mir sagen – daß mir das Blendende und Betörende an sich und damit auch die blendenden und betörenden Filmstars nichts bedeuten, weil ich beschränkt bin. Da es dich gut dreißig Jahre gekostet hat, um die Kurve vom Sesamkringel zum Croissant zu schaffen, wirst du dich nie [30] dazu aufschwingen können, auch nur das Geringste von der Filmwelt zu begreifen!
Entnervt setze ich mich vor den Fernseher. Es ist nach halb neun, und ich möchte die Abendnachrichten sehen, vielleicht bringen sie etwas über die Albaner. Die halbe Sendung dreht sich um Politik und um Bosnien, zwei Fixer, die an einer Überdosis krepiert sind, und einen Achtzigjährigen, der seine siebzigjährige Schwägerin vergewaltigt und umgebracht hat. Ich freue mich gerade, daß wir zum Kleinkram überwechseln, als der Fernsehmoderator eine betrübte Miene aufsetzt. Sein Gesicht verfinstert sich, er hebt seine Hände vom Studiotisch in die Höhe, als tue es ihm sehr leid um die Betroffenheit, die er bei den Zuschauern auslösen wird, und ihm entfährt ein fast unmerklicher Seufzer. Die Worte kommen einzeln aus seinem Mund, wie die letzten Stammgäste eines Kaffeehauses, die sich auf der Straße zerstreuen, ehe der Rolladen heruntergelassen wird. In der Brusttasche seines Jacketts trägt er stets ein Taschentuch. Jedesmal rechne ich damit, daß er es herauszieht und seine Tränen abtupft. Doch bislang hat er es noch nie getan. Wer weiß, vielleicht hebt er es sich als letzten Trumpf auf, falls die Quote sinkt.
»Was das andere Verbrechen betrifft, meine Damen und Herren«, sagt er, »im Falle der grausamen Ermordung zweier Albaner im Athener Bezirk Ajios Ioannis Rentis gibt es keine weiteren Erkenntnisse der Ermittlungsbehörden.«
Janna Karajorgi gestaltet ihren Auftritt als Kavallerieattacke. Sie hält das Mikrofon in der Hand und trägt dieselbe Kleidung wie am Morgen. Was auch ganz natürlich ist, [31] denn sie befindet sich bei der Fernsehaufzeichnung auf dem Gang vor meinem Büro.
»Die Kriminalpolizei hat mit Ausnahme der Festnahme eines Albaners, der sich im Athener Polizeipräsidium in Gewahrsam befindet, keine neuen Erkenntnisse zum Mord aufzuweisen. Wie Kommissar Kostas Charitos, der Leiter der Mordkommission, mitteilte, wird das Verhör des Albaners noch fortgesetzt. Die Polizei nimmt an, daß das Ehepaar ein Kind hatte, das jedoch bislang noch nicht ausfindig gemacht werden konnte.«
Außer mir stürme ich auf den Bildschirm los. Doch sie entwischt mir, und an ihrer Stelle taucht die Dicke auf. Sie beginnt die Beschreibung des Albaners und die Erzählung von der Verständigung der Polizei ins Mikrofon zu trompeten. Zum dritten Mal hintereinander zeigt man dieselbe Szene. Die Dicke sagt jedesmal genau dasselbe, sie trägt ihre glänzende Bluse und den zu engen Rock. Ohne jeglichen Glamour. Wie soll ich meinem Vorgesetzten morgen bloß erklären, daß sich die Karajorgi alles aus den Fingern gesogen hat?
»Wer hängt jetzt vor dem Fernseher, du oder ich?« triumphiert Adrianis Stimme aus der Küche. »Na komm schon, wir können essen.«
Das sagt sie so, dabei ißt sie nie zusammen mit mir. Sie setzt sich mir gegenüber auf einen Stuhl und schaut mir zu. »Ich muß dir was erzählen«, meint sie, sobald ich die Gabel mit dem Nudelauflauf zum Mund führe.
»Was denn?«
»Katerina hat heute angerufen.« Sie sagt es und lächelt.
»Und warum sagst du mir das jetzt erst?«
[32] »Ich wollte bis zum Essen warten, damit du Appetit bekommst.«
Unsinn. Sie hat es absichtlich für sich behalten, weil ich mich nicht neben sie vor den Fernseher setzen wollte. Sie kennt meine Schwäche für meine Tochter, und auf ihre Art rächt sie sich dafür.
»Also, sie kommt zu Weihnachten«, sagt sie und lächelt ununterbrochen selig vor sich hin.
Katerina studiert Jura in Thessaloniki. Sie ist im dritten Semester und hat alle Prüfungen ohne Ausnahme bestanden. Sie hat vor, Staatsanwältin zu werden. Innerlich flehe ich, daß ich dann noch nicht in Rente gegangen bin, damit ich ihr Angeklagte überstellen kann. Um dann unter den Zuhörern zu sitzen und stolz auf sie zu sein, wie sie die Anklageschrift verliest, die Zeugen befragt und ihr Plädoyer hält.
»Ich muß ihr Geld für das Flugticket schicken.«
»Nicht nötig, sie will mit dem Bus kommen, zusammen mit Panos«, entgegnet Adriani.
Natürlich, da ist auch noch der Kleiderschrank, den hatte ich ja ganz vergessen. Oder vielmehr versuche ich mich nicht an ihn zu erinnern. Im Grunde ist er kein schlechter Kerl, er studiert Agrarökonomie. Was mich stört, ist, daß er ein athletischer Muskelprotz ist, der nur in T-Shirt, Jeans und Sportschuhen herumläuft. Diesen Typus kenne ich aus unserer Polizeitruppe, das sind alles Pfeifen. Was soll man machen, er gehört eben auch zur ›Generation der fünfzig Wörter‹. Ich nenne sie so, weil ihr Wortschatz auf alles in allem fünfzig Ausdrücke beschränkt ist. Wenn man ›Scheiß drauf‹, ›schwule Sau‹ und ›verdammter Wichser‹ abzieht, [33] dann bleiben unter dem Strich siebenundvierzig Wörter übrig. Zu versteuerndes Reinvermögen: siebenundvierzig, wie der Steuerberater sagen würde. Ich erinnere mich an den Anfang der siebziger Jahre, an die Studentenproteste, die Besetzung der Universitäten, die Parole ›Brot, Bildung, Freiheit‹. Uns schickte man damals aus, die Studenten aufzuhalten und in die Flucht zu schlagen. Frontale Zusammenstöße, Verfolgungsjagden auf den Straßen, eingeschlagene Schädel. Sie verfluchten uns, und wir schickten sie zum Teufel. Woher sollte man damals wissen, daß die ganze Streiterei bei fünfzig Wörtern enden sollte. Vielleicht wären wir dann alle ganz friedlich nach Hause gegangen, weil es der Mühe nicht wert gewesen wäre.
»Hättest du das Geld für das Flugticket überhaupt, oder müßtest du es dir erst leihen?« Sie fragt ganz unschuldig, doch ich sehe die Hinterlist in ihrem Blick.
»Nein, ich hab’s flüssig«, antworte ich. »Ich habe etwas von den Gehaltsnachzahlungen auf die Seite gelegt.«
»Da du es nicht für die Fahrkarte brauchst, könntest du es mir doch für das Paar Stiefel geben, von dem ich dir erzählt habe.« Sie läßt ein Lächeln aufblühen, das betörend sein soll, doch nur bauernschlau wirkt.
»Laß mal, warten wir ab.« Ich werde ihr das Geld geben, doch ich lasse sie noch im unklaren, damit ich sie ein wenig auf die Folter spannen und meine Rachegelüste befriedigen kann. Die erste Phase des Familienlebens ist durch die Freude am Zusammensein gekennzeichnet. Die zweite Phase durch die Freude am eigenen Kind. Die dritte und längste besteht nur aus Rachefeldzügen. Wenn man so weit gekommen ist, weiß man, daß man endgültig im Hafen der [34] Ehe eingelaufen ist und sich nichts mehr ändern wird. Dein Kind wird bald seine eigenen Wege gehen, und du wirst jeden Abend nach Hause kommen und wissen, daß deine Frau auf dich wartet, das Essen und die Rache.
»Komm schon, Kostas, ich habe wirklich keine ordentlichen Stiefel!«
»Mal sehen!« sage ich schroff und beende die Diskussion.
Im Bett drängt sie sich an mich. Sie legt ihren Arm um meine Hüfte und beginnt mich zu küssen, aufs Ohr, auf den Hals. Ich rühre mich nicht. Sie legt ihren Schenkel auf mein Knie und beginnt ihn rauf- und runterzustreichen, vom Knie fast bis zum Bauchnabel und wieder retour.
»Wieviel brauchst du für die Stiefel?« frage ich.
»Ich habe ein sehr schönes Paar gesehen, aber der Preis ist ein wenig happig. Fünfunddreißigtausend. Aber die trage ich mehrere Jahre.«
»In Ordnung, ich gebe dir das Geld.«
Ihr Schenkel streicht noch ein letztes Mal nach unten, so wie der Fahrstuhl von der dritten Etage zum Erdgeschoß fährt, um dort endgültig stehenzubleiben. Sie zieht ihre Hand von meiner Hüfte zurück. Sie drückt mir einen Kuß auf die Backe und zieht sich sogleich in ihre Hoheitsgewässer zurück.
»Gute Nacht«, sagt sie erleichtert.
»Gute Nacht«, antworte ich, ebenfalls erleichtert, und schlage das Wörterbuch von Liddell-Scott auf, das ich vor dem Schlafengehen aus dem Regal geholt habe.
Ich kann mich nicht konzentrieren. Meine Gedanken sind bei der Karajorgi und bei ihrer fixen Idee bezüglich des Kindes. Sie kann nicht nur so daherreden, irgend etwas führt sie [35] im Schilde. Plötzlich kommt mir der Einfall, den Albaner dazu zu befragen, vielleicht weiß er etwas. Ich verhöre lieber ihn zuerst, und dann sehen wir mit der Karajorgi weiter. Zur Not leite ich in die Wege, woran ich am Morgen gedacht hatte: Thanassis auf sie anzusetzen, um ihr einige Informationen zu entlocken.
In der Nacht träume ich von der Wohnung der beiden Albaner. Nur ihre Leichen sind nicht mehr dort, und über die Matratze ist eine Decke geworfen. Auf dem Klapptisch steht eine Tragetasche. Ich beuge mich darüber und sehe einen Säugling. Er ist nicht älter als drei Monate und bebt vor lauter Schreien. Vor dem Gaskocher sehe ich die Karajorgi, wie sie dem Wickelkind die Flasche wärmt.
»Was machen Sie denn hier?« frage ich verwundert.
»Ich bin hier als Babysitter engagiert«, entgegnet sie mir.
[36] 4
Gerade habe ich mein Croissant angebissen und den ersten Schluck Kaffee getrunken, als Thanassis in mein Büro kommt. Er sieht mir in die Augen und grinst. Es handelt sich um einen der seltenen Augenblicke, wo er mir nicht sagt, daß er ein verdammter Wichser ist. Das passiert einmal im Jahr, höchstens zweimal.
»Das ist für Sie«, meint er und streckt mir ein Blatt Papier entgegen.
»Gut, laß es hier liegen.«
Im Lauf der Jahre habe ich mir ein Prinzip zugelegt: die Papiere, die man mir übergibt, niemals unmittelbar entgegenzunehmen. Üblicherweise sind es Anweisungen, Verbote, Einschränkungen, irgend etwas Entnervendes. Deshalb lasse ich sie auf meinen Schreibtisch regnen und warte erst einmal ab, bis ich innerlich soweit bin, sie zu lesen. Thanassis läßt das Blatt jedoch nicht aus der Hand fallen. Er streckt es mir nach wie vor triumphierend entgegen: »Das Geständnis des Albaners.«
Ich bleibe wie vom Blitz getroffen sitzen. Schließlich nehme ich die Aussage entgegen. »Wie hast du das denn geschafft?« frage ich, ohne meine Ungläubigkeit verbergen zu können.
»Vlassis hat mir den Tip gegeben«, antwortet er lachend.
»Vlassis?«
[37] »Das ist der Kollege, der die Untersuchungshäftlinge betreut. Wir tranken Kaffee in der Kantine, und da hat er mir erzählt, daß Sie den Albaner davon überzeugen wollten, daß er im Gefängnis besser dran ist. Ich habe mich hingesetzt, die Aussage getippt und sie ihn unterschreiben lassen.«
Ich sehe mir die erste Seite an. Zwei Fingerbreit oberhalb des unteren Blattrandes erkenne ich eine Kinderzeichnung, die wie der Athener Imittos-Hügel aussieht. Es ist die Unterschrift des Albaners. Ich überfliege den offiziellen Teil und wende mich gleich der Aussage zu. Sie enthält ausnahmslos alles, was er mir gestern während des Verhörs erzählt hatte: daß er die junge Frau bereits von früher kannte und scharf auf sie war, daß er tagelang um das Haus schlich, sie ihn jedoch stets abwies. Er habe ihre Ablehnung persönlich genommen, sich entschlossen, in das Haus einzudringen und sie zu vergewaltigen. Er habe ein Brett aus dem Verschlag vor dem Fensterloch gelockert und sei hineingeschlüpft. Er habe angenommen, daß der Mann nicht zu Hause sei. Als er ihn an ihrer Seite liegen sah, sei er in Panik geraten. Und als der Mann sich auf ihn stürzte, habe er sein Messer gezogen und zuerst ihn abgestochen und dann die Frau. Eine klare und ordentliche Aussage, ohne Lücken oder offene Fragen. Nichts dran auszusetzen.
»Bravo, Thanassis!« sage ich bewundernd. »Ein tadelloser Bericht.«
Er sieht mich strahlend an. Da unterbricht uns das klingelnde Telefon. Ich hebe den Hörer ab.
»Charitos.«
Das ist eine dieser Reformen à la FBI, die Gikas angeordnet hat. Wir dürfen nicht mehr ›Hallo!‹ oder ›Ja?‹ oder [38] ›Was denn?‹ sagen, sondern ›Charitos‹, ›Sotiriou‹, ›Papatriandafyllopoulos‹. Egal, ob die Verbindung zusammenbricht, bevor man ›Papatriandafyllopoulos‹ vollständig über die Lippen gebracht hat.
»Was wissen Sie über das Kind?« Immer kurz angebunden und auf das Wesentliche beschränkt.
»Es gibt kein Kind, Chef. Ich habe das Geständnis des Albaners vor mir liegen. Nirgendwo wird ein Kind erwähnt. Das bildet sich die Karajorgi bloß ein. Ihr eitler Ehrgeiz wird sie noch den Kopf kosten.«
Das sage ich absichtlich, um ihn auf die Palme zu bringen. Denn er schätzt die Karajorgi sehr.
»Er hat gestanden?« fragt er ungläubig.
»Er hat gestanden. Ein Verbrechen aus Leidenschaft. Nirgendwo taucht ein Kind auf.«
»Schön. Schicken Sie mir den Bericht. Und eine Zusammenfassung für die Pressemitteilung.« Er legt grußlos auf. Jetzt muß ich ihm auch noch einen Schulaufsatz schreiben, damit er ihn dann auswendig lernen kann.
Normalerweise endet die Angelegenheit an diesem Punkt. Der Albaner hat gestanden und wird dem Untersuchungsrichter überstellt. Die Gerüchte um das Kind erweisen sich als Hirngespinst, der Leiter der Athener Kriminalpolizei stellt sich vor die laufenden Kameras und sagt den Reportern sein Gedicht auf. Und wir sind aus dem Schneider. In solchen Fällen beginnen mich immer Hummeln im Hintern zu quälen. Ich fange an herumzuschnüffeln und zahle am Schluß immer drauf.
»Sag mal, Thanassis, hast du vielleicht irgend etwas über ein angeblich vorhandenes Kind gehört?«
[39] »Ein Kind?« wiederholt er fassungslos. Menschen wie Thanassis verhalten sich so. Plötzlich, aus heiterem Himmel, kommt ihnen eine intelligente Idee, und sie bringen unerwarteterweise etwas zustande. Was für ihre Verhältnisse an ein Wunder grenzt. Sobald man ihnen aber zusätzlich etwas abverlangt, worauf sie nicht vorbereitet sind, werden sie aus der Bahn geworfen. Ihre Selbstsicherheit bricht in sich zusammen, und sie sinken wieder in ihre Umnachtung zurück.
Ich blicke auf meine Uhr. Erst halb zehn. Noch zwei Stunden, bis die Journalisten aufkreuzen. Mir bleibt reichlich Zeit, um den Bericht für Gikas zu schreiben.
»Bring mir den Albaner zum Verhör.«
Er sieht mich an, sein ganzer Stolz ist mit einem Schlag wie weggeblasen. »Aber… Er hat doch schon gestanden«, stammelt er.
»Weiß ich doch. Aber die Karajorgi hat gestern in den Abendnachrichten noch eins draufgelegt, als sie verkündete, daß es ein Kind gibt. Gikas hat das gesehen und fragt jetzt nach. Klar gibt es nichts Derartiges, doch ich überzeuge mich lieber selbst, um ganz sicherzugehen. Ruf im Gefängnistrakt an und laß ihn vorführen.« Ich lasse ihn mit dabeisein, um ihm meine Wertschätzung zu zeigen. Er freut sich wie ein Schneekönig, breit grinsend stürmt er hinaus.
Der Albaner sitzt am selben Platz wie letztes Mal, doch seine Hände sind diesmal ohne Handschellen. Als wir eintreten, blickt er uns eingeschüchtert entgegen. Ich biete ihm eine Zigarette an.
»Ich schon alles sagen«, meint er, während er den ersten [40] Zug einsaugt. »Der da kommen, und ich alles sagen.« Er zeigt auf Thanassis.
»Ich weiß. Keine Angst, du bist jetzt fein raus. Nur eine Frage noch, aus reiner Neugier. Weißt du, ob die beiden, die du umgebracht hast, Kinder hatten?«
»Kinda?«
Er sieht mich an, als ob bei einem jungen albanischen Ehepaar Kinder das Unwahrscheinlichste auf der Welt wären. Er gibt keine Antwort, nur sein Blick wandert langsam zu Thanassis. Der springt mit einem Mal auf, packt ihn am Kragen und reißt ihn in die Höhe, während er ihn anschreit: »Sag schon, du Arschloch! Hatten die Albaner Kinder? Rede endlich, sonst schlag ich dich windelweich!«
»Wenn man im Tiefschlaf liegt, kann einen nicht einmal Kanonendonner wecken«, pflegte meine selige Mutter zu sagen. Kaum hat der Siebenschläfer einem Untersuchungshäftling ein Geständnis herausgelockt, schon spielt er sich als harter Cop auf. Ich befreie den Albaner aus seinen Klauen und setze ihn wieder auf den Stuhl zurück.
»Ruhig, Thanassis. Wenn der Junge etwas weiß, wird er es uns ganz von alleine sagen. Nicht wahr?«
Die letzte Frage ist an den Albaner gerichtet. Er zittert aus mir unverständlichen Gründen am ganzen Leib. Es war doch nur eine ganz simple Frage, daraus kann ihm doch keiner einen Strick drehen. Thanassis hat ihn durch sein übereifriges Eingreifen verschreckt.
»Nein«, sagt er. »Pakise nix Kinda.«
Pakise hieß die junge Frau, die er umgebracht hat. »In Ordnung, das war’s«, sage ich freundlich. »Wir brauchen dich nicht weiter.«
[41] Er sieht mich erleichtert an, als ob eine große Last von ihm gefallen wäre.
Ich kehre in mein Büro zurück und schreibe den Schulaufsatz für Gikas. Kinkerlitzchen. Dafür reicht ein Blatt aus einem Schulheft, das ich mit meiner großen, klobigen Handschrift fülle. Bloß eine Zusammenfassung der Tatsachen. Die sprachlichen Pirouetten fügt er selbst hinzu. Dann gehe ich zum ausführlichen Bericht über. Dafür brauche ich länger, doch nach einer Stunde bin ich damit fertig. Beides lasse ich zu Gikas bringen.
Ich greife nach dem Croissant, um es aufzuessen, und nach dem kalten, verwässerten Kaffee. Die Katze sonnt sich auf dem gegenüberliegenden Balkon. Sie räkelt sich und legt ihren Kopf auf die warmen Fliesen. Sie zählt zu den Lebewesen, die sich an der wohligen Wärme und nicht an der brütenden Hitze freuen. Die Alte betritt mit einem Teller voll Speisereste den Balkon. Sie stellt ihn vor die Katze. Sie wartet, daß sie die Augen aufschlägt und das Futter zur Kenntnis nimmt. Doch die Katze ignoriert sie völlig. Die Alte wartet geduldig, streichelt ihr den Kopf, redet schmeichlerisch auf sie ein, doch die Katze kümmert sich nicht die Bohne um sie. Schließlich läßt die Alte entmutigt den Teller stehen und geht ins Zimmer. Die Überheblichkeit der Katze, der man das Essen förmlich aufdrängt, führt meine Gedanken zurück zu den beiden Albanern. Ich sehe vor mir, wie sie auf ihrer nackten Matratze liegen, daneben der Klapptisch, die beiden Plastikstühle, die Gasflasche mit der Kochstelle. Nicht, daß ich übermäßige Sympathie für Albaner hege, doch dieser Gegensatz zur verwöhnten Katze bringt mich zur Weißglut. Und dann dieses [42] verdammte schwüle Wetter! Man sehnt den erlösenden Regen herbei.
Ruckartig geht die Tür auf, und die Karajorgi tritt ohne anzuklopfen ein. Sie scheint sich hier schon wie zu Hause zu fühlen. Vielleicht sollte ich ihr gleich den Schlüssel zu meinem Büro in die Hand drücken. Sie ist heute anders als das letzte Mal gekleidet: Sie trägt Jeans und eine Sportjacke. Die Jacke hat sie über ihre Handtasche, die ihr von der Schulter baumelt, gelegt. Sie schließt die Tür und lächelt mir zu. Ich sehe sie wortlos an. Wie gerne würde ich sie mit einer Schimpftirade empfangen, doch ein höherer Befehl hält mich zurück. Wir sollen die Reporter mit Glacéhandschuhen anfassen. Früher haben wir die Journalisten ganz anders behandelt.
»Glückwunsch! Ich höre, der Albaner hat gestanden. Somit ist die Angelegenheit wohl erledigt.« Ihr Lächeln ist spöttisch, ihr Gesichtsausdruck arrogant. Sie nimmt mich auf die Schippe.
»Wir haben den Fall aufgeklärt«, verbessere ich sie kühl. »So nennt man das im offiziellen Sprachgebrauch der Polizei. Den müßten Sie mittlerweile eigentlich beherrschen.«
»Ich weiß sehr wohl, was ich sage«, entgegnet sie und blickt mich weiterhin mit diesem ironischen Lächeln an.
Ich gehe zum Gegenangriff über, weil ich keinerlei Lust habe, Katz und Maus zu spielen. »Warum haben Sie gestern in Ihrer Berichterstattung gelogen?« frage ich sie. »Sie wissen genau, daß es kein Kind gibt und wir auch keinen Verdacht in diese Richtung hegen.«
Sie lacht auf. »Macht nichts«, sagt sie leichthin. »Dementieren Sie ruhig.«
[43] »Warum haben Sie das gestern in den Raum gestellt?«
»Was denn?«
»Das mit dem Kind. Wieso bloß? Dachten Sie, irgend jemand wird schon nach dem Köder schnappen?«
»Ich sagte doch schon: aus reiner Sympathie für dich«, duzt sie mich plötzlich. »Ich weiß, daß du mich nicht leiden kannst, aber das ist egal. Ich mag dich trotzdem. Ich stehe eben zu meinen Schwächen.«
Sie hat es geschafft, mich durch ihre direkte Art in Verlegenheit zu bringen. »Weder finde ich Sie sympathisch, noch sind Sie mir unsympathisch«, meine ich in der Hoffnung, daß ich mich durch eine neutrale Haltung aus der Situation hinausmanövrieren kann. »Ihr Reporter fällt mir auf die Nerven, genauso wie ich euch auf den Geist gehe. Das ist Teil unserer Arbeit. Aber ich finde Sie nicht schlimmer als andere Ihrer Kollegen.«
»Ich bin Ihnen sicherlich noch unangenehmer als alle anderen«, sagt sie immer noch lachend. »Mit Ausnahme von Sotiropoulos vielleicht.«
Dem gewitzten Luder entgeht auch gar nichts.
»Und warum finden Sie mich sympathisch?« frage ich, um mich aus der Situation zu retten.
»Weil Sie der einzige hier drin sind, der noch ein bißchen Ahnung hat. Bilden Sie sich nur nichts darauf ein, das heißt nicht viel. Unter den Blinden ist der Einäugige König. Obwohl, diesmal sind selbst Sie mit Blindheit geschlagen.«
Sie öffnet die Tür, entwischt mir schnell und beendet somit die Diskussion vorzeitig.
Wieder läßt sie mich mit meiner Unwissenheit im Regen [44] stehen. Hält sie mich zum Narren, oder weiß sie wirklich etwas, das sie geheimhält? Wenn sie wirklich etwas weiß und die Bombe nachträglich platzen läßt, dann werden alle über mich herfallen. Dann werde ich mich vor lauter Anrufen nicht retten können. Wenn ich wenigstens ein wenig zeitlichen Spielraum hätte! Gikas wird in Kürze seine Presseerklärung verlautbaren, die Akte wird morgen zum Staatsanwalt weitergeleitet, der höchstens zwei Tage braucht, um sie dem Untersuchungsrichter zuzustellen. Von diesem Zeitpunkt an habe ich keinen Einfluß mehr auf die ganze Angelegenheit. Das wäre der geeignete Zeitpunkt für die Karajorgi, um die Bombe platzen zu lassen. Dann gute Nacht!
Ich nehme den Hörer ab und rufe Sotiris, den Kriminalobermeister, in mein Büro. Er war es, der das Verlies der Albaner durchsucht hat. Vielleicht ist ihm irgend etwas aufgefallen.
»Sag mal, Sotiris, als wir die Wohnung der beiden Albaner durchsucht haben, ist dir dabei Kinderspielzeug aufgefallen oder irgend etwas, das an die Anwesenheit von Kindern erinnert?«
»Kinderspielzeug? Was für Kinderspielzeug?« fragt er baff.
»Na, Rasseln und Beißringe zum Beispiel, oder Kinderkleidung wie Strampelhöschen oder Lätzchen.«
Er sieht mich entgeistert an. Er denkt bestimmt, ich hätte völlig den Verstand verloren. Nicht ganz zu Unrecht. »Nein, es wurde nichts Derartiges vorgefunden.« Nach einer kurzen Pause fügt er hinzu: »Außer einem Windelkarton.«
»Windelkarton?« rufe ich und springe auf.
»Ja, ein leerer Karton, den sie als [45] Lebensmittelschränkchen verwendet haben. Darin hatten sie Zucker, Kaffee und eine halbe Packung getrocknete Bohnen aufbewahrt.«
Die Katze ist jetzt aufgewacht und frißt. Wie die Filmsternchen, die erst um elf Uhr morgens frühstücken. Die Alte steht befriedigt neben ihr. Offensichtlich freut sie sich, daß sie gut bei Appetit ist und sie ihr keine Zusatznahrung mit Eisen und Vitaminen besorgen muß. Die Blüten in den Blumentöpfen lassen ihre Köpfchen hängen, sie blicken zu Boden wie verschämte Jungfrauen. Erst gestern hat die gute Alte sie gegossen, und heute bereits sind sie halb verwelkt. Und jetzt ins Auto bei diesem Smog! Ich stelle mir vor, wie ich die Abgase einatme und wie der plastiküberzogene Autositz unter meinem immer tauber werdenden Hintern heißer und heißer wird.
»Laß einen Streifenwagen vorfahren. Du kommst mit mir.«
»Wohin fahren wir denn?« fragt er erstaunt.
»Zur Behausung der Albaner. Wir durchsuchen die Bude nochmals.«
Er starrt mich an. Er setzt zaghaft zu einem Protest an, doch schließlich schluckt er ihn hinunter. Nach fünf Minuten benachrichtigt er mich, daß der Streifenwagen zur Abfahrt bereitstehe.
[46] 5
Obwohl Sotiris mit Blaulicht fährt, brauchen wir nahezu eine Stunde, um in den Stadtteil Ajios Ioannis Rentis zu gelangen. Während der ganzen Fahrt sitze ich wie auf glühenden Kohlen neben ihm und spiele mit dem Fenster herum. Einmal kurble ich es herunter, mit dem Resultat, daß mir der Smog den Atem nimmt. Dann wiederum schließe ich es, nur um vor Hitze fast zu ersticken. Schließlich gebe ich auf und lasse es halb offen. Mag sein, daß mich die vollgestopften Straßen so rastlos machen. Unversehens hat mich eine Ungeduld gepackt, so schnell wie möglich zum Verschlag der Albaner zu gelangen, um ihn aufs neue zu durchsuchen und die Sache endlich ad acta zu legen. Ich nehme es der Karajorgi übel, daß sie mich auf eine neue Fährte setzt, wo ich es doch viel bequemer haben könnte. Es erbost mich, daß ich mich zu ihrem Werkzeug machen lasse. Ich ärgere mich grün und blau über die Albaner, die, wenn sie schon Gören in die Welt setzen, doch zumindest dafür sorgen könnten, daß sie plärrend neben der Matratze hocken und wir sie umgehend dem Kindernotdienst zustellen können. Sotiris neben mir sitzt schweigend am Lenkrad und macht aus seiner schlechten Laune kein Hehl. Er legt es mir zur Last, daß ich ihn grundlos quer durch die Stadt schleife und er nicht in aller Seelenruhe in seinem Büro über irgendeinem Aktenstück sitzt. Oder seinen Kollegen vom Chassis seines [47] kürzlich gekauften Hyundai Excel vorschwärmen kann. Den er angeblich vom Erlös einer geerbten Immobilie in seinem Heimatdorf finanziert hat. Angeblich, wie gesagt.
Als wir die Behausung betreten, gerate ich noch mehr in Harnisch. Ein nacktes Zimmer, in dem offensichtlich nichts als eine Handvoll Armseligkeiten herumliegt. Das sieht man doch auf den ersten Blick. Was um Himmels willen suche ich hier? Geheimfächer etwa oder Geheimgänge, die als Versteck dienten? Der Windelkarton steht auf dem Klapptisch, Sotiris hatte sich richtig daran erinnert. Ich blicke hinein und finde die Dinge vor, die er mir bereits aufgezählt hatte: ein Hundert-Gramm-Päckchen fein gemahlenen Kaffee, ein Päckchen Zucker und eine halbvolle Plastiktüte getrocknete Bohnen. Den Karton haben sie von der Straße aufgelesen, um ihre Nahrungsmittel zu verstauen, damit die Ratten sie nicht auffressen.
»Was suchen wir denn eigentlich?« fragt Sotiris, der mich nicht aus den Augen läßt.
»Kinderspielzeug oder Kinderkleidung! Wie oft soll ich das noch erklären?« belle ich zurück.
Ich nehme die Kleidungsstücke der jungen Frau vom Haken und lasse sie auf den Boden fallen, dann taste ich sie mit meinem Schuh ab. Möglicherweise haben wir irgend etwas zwischen der Wäsche übersehen. Doch es handelt sich bloß um eine Hose, eine Bluse und ein Paar Socken. Ich werfe einen Blick auf die Kleidungsstücke des Mannes, die noch immer neben der Matratze liegen. Er hatte auch nur ein einziges Hemd, eine Hose und ein Paar Socken. Und die Schuhe der beiden natürlich. Pumps für sie und Schnürschuhe für ihn. Hatten sie denn gar keine Unterwäsche zum Wechseln? [48] Gut, sie kommen nur mit dem, was sie am Leibe tragen. Doch ich hatte mir das nicht so wortwörtlich vorgestellt. Ich schaue mir alles an und überlege, was es bedeuten könnte.
»Hilf mir mal, die Matratze hochzuheben«, sage ich zu Sotiris.