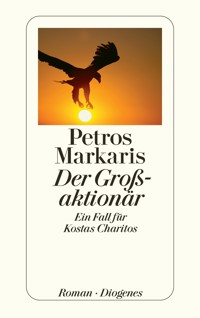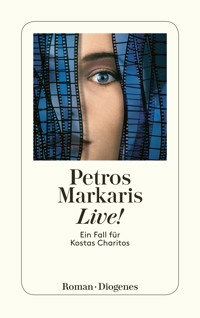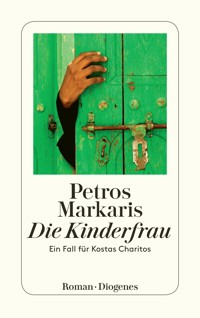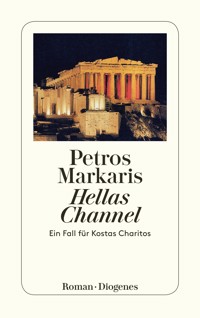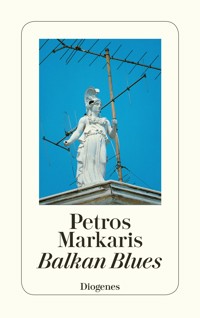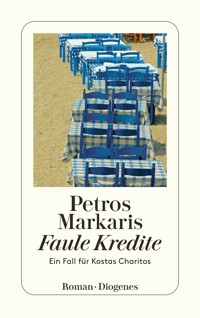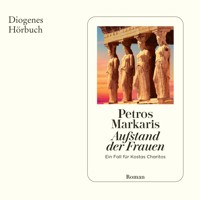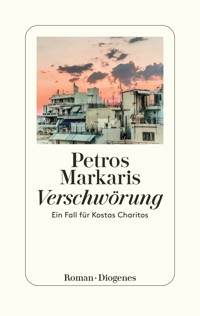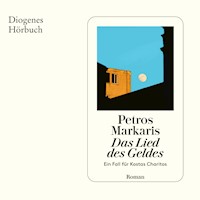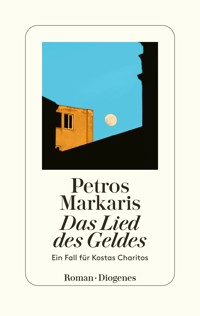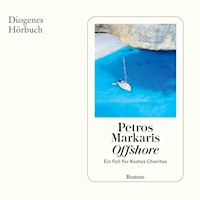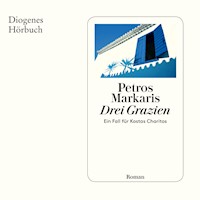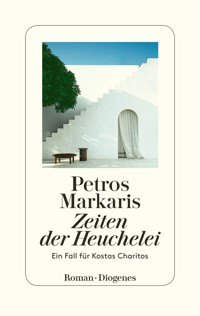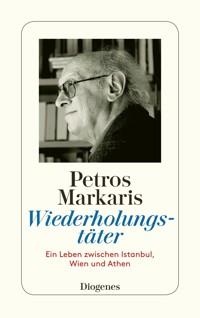
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Was an Ihren Romanen ist selbsterlebt? Petros Markaris beantwortet diese Frage – auf seine Art. Er vergleicht sich mit seinem Kommissar, sieht Ähnlichkeiten, aber auch Unterschiede, und kommt so auf seinen eigenen Hintergrund zu sprechen: die Kindheit in Istanbul, den Alltag in Athen, die Zusammenarbeit mit Theo Angelopoulos, die Verbundenheit mit der deutschen Sprache und Kultur. Autobiographisches, Historisches und Politisches vermischen sich dabei auf brillante und liebenswürdige Weise.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 163
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Petros Markaris
Wiederholungstäter
Ein Leben zwischen Athen, Wien und Istanbul
Aus dem Neugriechischen von Michaela Prinzinger
Diogenes
Alles wandelt sich. Neu beginnen
Kannst du mit dem letzten Atemzug.
Aber was geschehen, ist geschehen. Und das Wasser
Das du in den Wein gossest, kannst du
Nicht mehr herausschütten.
[…]
Alles wandelt sich. Neu beginnen
Kannst du mit dem letzten Atemzug.
Bertolt Brecht
Der spätberufene Romancier
Brechts Gedicht habe ich nicht nur deshalb an den Anfang gestellt, weil ich es mag, sondern auch, weil es mein schriftstellerisches Leben geprägt hat. Mit achtundfünfzig Jahren begann ich, Romane zu schreiben – nicht gerade mit meinem letzten Atemzug, doch auf dem besten Wege dahin. Zwar glaube ich an Marx’ Ausspruch, dass die kürzeste Verbindung zwischen zwei Punkten manchmal eine Kurve sein kann, zum einen weil mir der Ausspruch gefällt, zum anderen weil er mir zupass kommt. Andererseits weiß ich sehr gut, dass ich das Wasser, das ich in meinen Wein gegossen habe, nicht mehr herausschütten kann. Doch mit dieser Wahrheit lebe ich ganz angenehm, ohne mich vom Leben benachteiligt zu fühlen und ohne tränenschwere Seufzer à la »Ach, den Fehler von damals bereue ich bis heute!«.
Ich wäre niemals zum Romaneschreiben gekommen, wäre da nicht Kommissar Kostas Charitos vor mir aufgetaucht. Mein ganzer Erfolg als Romanautor ist in erster Linie sein Verdienst. Es gibt Figuren, die urplötzlich vor dir aus dem Boden wachsen, ohne dass du jemals mit ihrer Existenz gerechnet hättest. Sie ähneln jenen Verwandten, die eines schönen Tages aus dem Nichts auftauchen und sagen: »Ich bin der Cousin deines Vaters, der mit zwanzig nach Kanada ausgewandert war«, oder: »Ich bin deine Schwester väterlicherseits und bei meiner Mutter auf der Krim aufgewachsen.« Normalerweise empfindest du diese bislang unbekannten Verwandten als zusätzliche Last, die dir plötzlich und ohne Vorwarnung auf die Schultern gewuchtet wird. Nicht genug mit deiner eigenen Familie, um die du dich zu kümmern hast oder mit der du dich zankst, nun sollst du auch noch einen unbekannten Verwandten ertragen, der vom Himmel gefallen ist. Ganz so, wie Brecht in Die heilige Johanna der Schlachthöfe sagt:
»Gleich einem Atlas stolpere ich, auf den Schultern
Die Zentnerlast von Blechbüchsen, gradenwegs
Unter die Brückenbögen.«
Der Verwandte aus dem Nirgendwo ist wie eine Zentnerlast von Blechbüchsen. Doch ich will nicht kleinmütig sein. Ausnahmen gibt es immer. Mit einigen dieser ungeladenen Verwandten wirst du vom ersten Augenblick an warm und bedauerst, dass du sie nicht schon früher kennengelernt hast. Es sind nicht so sehr die Verwandtschaft oder die Blutsbande, die den Ausschlag geben, als vielmehr die Chemie, die auf Anhieb stimmt.
Auf Charitos traf keines von beiden zu. Er wuchs im Herbst des Jahres 1993 plötzlich vor mir aus dem Boden. Es war das dritte Jahr, in dem ich eine Folge nach der anderen für die TV-Serie Anatomie eines Verbrechens schrieb, und das unter ständigem Termindruck. Und da stand mit einem Schlag eine dreiköpfige Familie vor meinem Schreibtisch: Vater, Mutter, Kind. Eine typisch griechische Familie, wie in jeder beliebigen kleinbürgerlichen Wohngegend Athens anzutreffen – in Kypseli, Ambelokipi, Tourkovounia oder Vyronas. Mein erster Impuls war, sie zum Teufel zu schicken, um meine Ruhe zu haben. Es war die klassische Reaktion auf den unbekannten und ungeladenen Verwandten: Du willst ihn wegschicken, um unangenehme Überraschungen zu vermeiden. Bei Charitos war das genauso. Ich wollte ihn loswerden, weil ich seine kleinbürgerliche Herkunft fürchtete. Die Literatur, das Theater, das Kino und das Fernsehen sind voll von Kleinbürgern und kleinbürgerlichen Familien. Was sollte ich darüber noch erzählen? Zudem empfinden Schriftsteller und Künstler ihren kleinbürgerlichen Verwandten gegenüber eine gewisse Verlegenheit und ziehen es vor, sie auf Distanz zu halten. Außer an den Feiertagen, doch auch dann kann man auf Telefonanrufe, Blumensendungen und seit neustem auch auf SMS ausweichen.
Der Mann gehörte jedoch zu der hartnäckigen Sorte von Verwandten, die dir tagtäglich Nachrichten auf dem Anrufbeantworter hinterlassen mit der Frage, wann man sich denn endlich wiedersehe. Schließlich berufst du dich auf den Ausspruch, den auch mein seliger Vater ständig im Munde führte: Bringen wir’s hinter uns. So entwickelte sich meine Beziehung zu Charitos. Wenn ich mich an den Schreibtisch setzte, war er schon da und wartete auf mich. Bereit, mir das Leben schwerzumachen. Nach knapp einem Monat war seine Anwesenheit zu einer täglichen Qual geworden. Er hinderte mich daran, mich auf die Drehbücher zu konzentrieren, die mich ohnehin große Anstrengungen kosteten, und jeder Versuch meinerseits, ihn – auf sanfte oder auf grimmige Weise – in die Flucht zu schlagen, misslang. Eines Morgens, als ich wieder einmal den hoffnungslosen Versuch unternahm, ihn zum Teufel zu schicken, schoss es mir durch den Kopf, dass ein solcher Quälgeist nur eins von beiden sein konnte: Zahnarzt oder Polizist.
Bis dahin hatte ich nur einen unspezifischen pater familias vor mir gesehen. Doch nun erkannte ich, dass er ganz offensichtlich ein Polizist war, und so fügten sich die weiteren Aspekte seines Charakters wie von selbst zueinander. Ich wusste sofort, dass er Kostas Charitos hieß und seine Frau Adriani. So, wie ich wusste, dass das Kind ein Mädchen war, Katerina hieß und eine Doktorarbeit in Jura an der Aristoteles-Universität Thessaloniki schrieb.
Das Einzige, wonach ich wirklich suchen musste, war die Gegend, in der er wohnte. Während ich mich zuvor mit keiner kleinbürgerlichen Wohngegend anfreunden konnte, wollte ich nun, da ich die Familie besser kannte, doch darauf zurückkommen. Meine Entscheidung hatte auch mit meiner eigenen Familie zu tun. Und so fiel meine Wahl auf die Aristokleous-Straße an der Grenze zwischen Pangrati und Vyronas. Es ist ein kurzes, enges Sträßchen und genauso unauffällig wie die Familie selbst. Wenn Sie einem ihrer Mitglieder zufällig auf der Straße begegneten, würden Sie achtlos an ihm vorübergehen.
Doch die Erfahrung – die ich zum größten Teil durch das Studium der Werke anderer Autoren erworben habe, die ich übersetzte – hat mich gelehrt, dass eine Figur ohne biographische Brüche nicht überzeugend wirkt. Solch eindimensionale Charaktere sind langweilig und lassen den Leser kalt. Anders gesagt: Selbst der farbloseste Held ohne eigenes Flair braucht irgendeine ›Macke‹, durch die er sich von den anderen abhebt. Und Charitos hat gleich zwei davon. Zunächst einmal sein Auto, der berühmte Fiat 131 Mirafiori.
Viele Fragen, die mir Leser stellen, betreffen diesen Wagen. Einen Hyundai, Nissan oder Opel würde man als absolut passend zu Charitos’ Charakter und sozialer Stellung empfinden. Einen Mirafiori aber? Die Jüngeren wissen nicht einmal, was das für ein Auto ist. Die Alteren kennen es wohl, wundern sich jedoch darüber, dass ich darauf verfallen bin. Eine italienische Freundin sagte einmal zu mir: »Möglich, dass ein Modell davon in Agnellis Museum rumsteht, aber in Italien steigt nicht einmal ein illegaler Einwanderer in einen Mirafiori.«
In Griechenland war der Mirafiori nie besonders beliebt. Folglich scheint mir die Frage völlig gerechtfertigt, wie ich darauf gekommen bin. Es klingt zwar unglaublich, aber der Weg dazu führte über Libyen. Mitte der sechziger bis Mitte der siebziger Jahre arbeitete ich in der Exportabteilung der Zementfabrik Titan. Zu dieser Zeit verkaufte Griechenland große Mengen an Zement nach Libyen, und ich reiste alle naselang nach Bengasi oder Tripolis. In beiden Städten zirkulierten fast ausschließlich Autos der Marke Fiat, und zwar vorwiegend das Modell Mirafiori. Auf Schritt und Tritt begegnete man diesem Wagen, entweder stand er geparkt am Straßenrand oder fuhr durch die Gegend. Als ich nun nachdachte, welches Auto am besten zu Charitos passen würde, erwachte vor meinem geistigen Auge der Mirafiori wieder zum Leben.
Diese Erklärung gab ich jedes Mal, wenn ich gefragt wurde: »Wieso ausgerechnet der Mirafiori?« Tief in meinem Innern war ich mit der Antwort jedoch nicht zufrieden. Ich spürte, dass die Erklärung von mir und nicht von Charitos stammte. In meinem vierten Roman, im Großaktionär, liefert Charitos schließlich seine eigene Begründung. Dort erläutert er Vlassopoulos im Verlauf eines Gesprächs an der olympischen Ruderregattastrecke in Spata, wieso er sich nicht von seinem Mirafiori trennen kann: »Weißt du, warum ich nicht von ihm lassen kann, Vlassopoulos? Weil es mir zu blöd wäre, einen nagelneuen Wagen mit Allradantrieb zu haben, der vom ersten kräftigen Regenguss auf den Athener Straßen weggeschwemmt wird. Der Mirafiori ist authentisch. Aber es kann sein, dass er dich bei schönstem Wetter mitten auf der Straße im Stich lässt. Genau wie Griechenland die Griechen.«
Charitos’ zweite ›Macke‹ sind die Worterbücher. Die meisten Leser wundern sich über einen Polizisten, der sich ausschließlich für die Lektüre von Wörterbüchern interessiert. Ich frage mich jedoch, warum. In der Kriminalliteratur gibt es Helden mit viel ungewöhnlicheren Eigenheiten, die sie oft zu Außenseitern oder Randfiguren der Gesellschaft stempeln. Ich will mich auf zwei Beispiele beschränken: P.D. James’ Hauptfigur Adam Dalgliesh ist neben seiner Tätigkeit als Kommissar auch Dichter. Ich will nicht behaupten, dass Polizisten oder selbst Innenminister keine Gedichte schrieben, aber ein dichtender Kommissar mutet schon seltsam an. In Griechenland gab es zwar einen dichtenden Sandalenschuster, den äußerst sympathischen Melissinos, auf einen dichtenden Polizisten kann ich mich jedoch nicht besinnen. Oder Donna Leons Commissario Brunetti – der ist auch ziemlich außergewöhnlich. Er hat Altgriechisch und Latein studiert und ist mit einer Universitätsprofessorin verheiratet, die noch dazu aus einer sehr alten venezianischen Adelsfamilie stammt. Hätte ich den griechischen Bullen Charitos als verheiratet mit einer Akademikerin und als Absolventen der klassischen Philologie dargestellt, hätte mir das kein griechischer Leser abgenommen. So beschränkte ich seine ›Macke‹ zunächst auf zwei Wörterbücher: auf das neunbändige Große Wörterbuch der Griechischen Sprache von Dimitrakos und auf das gleichnamige vierbändige Lexikon von Liddell-Scott. Später trat das Wörterbuch sämtlicher Begriffe bei Hippokrates von Panos D. Apostolidis hinzu, das ihm seine Tochter Katerina schenkt, als er im Krankenhaus liegt.
Charitos hat seine Neigung zu Wörterbüchern von mir, denn ich bin ein manischer Leser solcher Werke. Andere empfinden Lexika vielleicht als langweilig oder als ein notwendiges Übel, ich kann stundenlang in ihnen schmökern. Wenn ich eine Buchhandlung betrete, besuche ich zuerst die Abteilung für Wörterbücher. Und nun, wo viele alte Lexika auf DVD herausgebracht und dadurch erschwinglicher werden (denn darüber darf man sich nicht hinwegtäuschen, Wörterbücher sind sündteuer), halte ich ständig im Internet Ausschau nach neuen Editionen. Ich weiß nicht, ob diese Neigung für Wörterbücher von meiner übersetzerischen Tätigkeit herrührt, die mich mit ihnen vertraut gemacht hat. Sicher ist jedenfalls, dass ich mir ständig wieder welche besorge.
Andererseits spüre ich eine tief verwurzelte Antipathie gegen Polizisten oder Detektive, die kauzig oder überragend intelligent sind. Üblicherweise haben sie einen naiven Bewunderer an ihrer Seite, den sie zu ihrem Handlanger degradieren, um als besonders schlau dazustehen. Dies ist der Fall in der Beziehung zwischen Sherlock Holmes und Watson oder zwischen Hercule Poirot und Hastings. In Wirklichkeit sind Polizisten und Detektive – wo sie denn auftreten – weder schrullig noch besonders genial. Es sind einfache Menschen, die mühsam und beharrlich versuchen, komplizierte und oftmals schmutzige Fälle aufzuklären.
Miss Marple ist mir dabei hundertmal lieber als Poirot. Die allgemeine Bewunderung für Poirot entspringt dem Trugschluss, aufgrund seiner Exaltiertheit sei er im Stande, rätselhafte Fälle zu lösen. Im Gegensatz dazu fragt man sich bei Miss Marple: Wie ist es möglich, dass diese Glucke so verzwickte Fälle löst? Genau das macht Miss Marple zu einer interessanteren Figur als Poirot.
Doch meine Entscheidung, Kostas Charitos zum Polizeibeamten und Leiter der Mordkommission im Athener Polizeipräsidium zu machen, löste meine Probleme keinesfalls mit einem Schlag. Seit seinem ersten Auftauchen hielt mich dieser mysteriöse Mann, der jeden Morgen vor meinem Schreibtisch Aufstellung nahm, auf Trab.
Es gilt als eines der unantastbaren Prinzipien des Kriminalromans, dass sich der Held – sei es nun ein Polizist oder ein Profi- bzw. Amateurdetektiv – am Schluss stets als Sympathieträger oder zumindest als ›positiver Charakter‹ herausstellen muss. Von dem Augenblick an, da er in Konflikt mit dem ›Bösen‹ gerät, die Vertreter des Bösen entlarvt und der Justiz übergibt oder selbst Gerechtigkeit übt, wird sich der Leser, der auch gegen ›das Böse‹ oder die Vertreter des Bösen Stellung bezieht, früher oder später mit ihm identifizieren. Das betrifft natürlich nicht die persönlichen Schwächen und Widersprüche, die jeder Held haben muss, um interessant zu wirken (romanhafte ›Heiligenfiguren‹ sind selten sympathisch, mit Ausnahme vielleicht von Simon Templar, dem Helden von Leslie Charteris, der zwischenzeitlich dem Vergessen anheimgefallen war). Pepe Carvalho zum Beispiel, Manuel Vázquez Montalbáns Detektiv, ist zutiefst sympathisch und ein hervorragender Koch, dabei könnte man ja meinen, dass er mit seinem ungezügelten Appetit oder, besser gesagt, seiner Gefräßigkeit zumindest auf einen Teil des Lesepublikums abstoßend wirken müsste. Doch selbst Anhänger von Biokost lehnen ihn nicht ab, obwohl er beim Essen und Trinken unersättlich ist und den ungesündesten Speisekombinationen frönt, die man sich nur vorstellen kann.
Ein weiteres Beispiel ist Ian Rankins Detective Inspector Rebus. Sobald er einen Fall übernimmt, wütet er wie ein Elefant im Porzellanladen und nimmt weder auf Vorschriften noch auf Kollegen Rücksicht. Und dennoch wird ihn kaum ein Leser deswegen nicht mögen, ja selbst ein junger Mensch, der eine Familie gründen möchte, oder ein durchschnittlicher Familienvater wird sich mit ihm anfreunden. Und dabei ist Rebus ein miserables Familienoberhaupt und ein hundsmiserabler Vater, der seine Familie zerstört und dem seine Tochter in solchem Maße gleichgültig ist, dass sie sich in den Drogenkonsum flüchtet, einzig und allein weil der Vater wie besessen dem Verbrechen hinterherjagt.
Es gibt viele solcher Beispiele. Am Ende gelingt es dem Autor dennoch, seinen Helden sympathisch erscheinen zu lassen oder wenn schon nicht die Zustimmung, so zumindest das Verständnis des Lesers zu gewinnen. Eigentlich erstaunlich, denn wir leben in einem politisch korrekten Zeitalter, und folglich muss der positive Held auch politisch korrekt handeln. Auf die direkte Entsprechung von politischer Korrektheit und Scheinheiligkeit will ich später noch zu sprechen kommen.
Mein Problem war ganz anders gelagert: Wie soll ich einen sympathischen griechischen Bullen kreieren, der dem Leser ans Herz wächst? Ich kam in der ›Poli‹ – wie Konstantinopel oder Istanbul von den Griechen immer noch genannt wird – zur Welt. Ich wuchs in Istanbul auf und lebe seit 1965 in Griechenland. Seitdem ich ein politisches Selbstverständnis entwickelt habe, fühle ich mich als Linker. Wie sollte jemand, der in zwei Ländern gelebt hat, in denen Gewalt und Willkür in Verbindung mit der erbarmungslosen Verfolgung der Linken jahrzehntelang das tägliche Brot der Polizei bildeten, für Bullen auch nur die geringste Sympathie verspüren?
Nun schön, Kostas Charitos war also Bulle. Aber ein Sympathieträger? Wie sollte ich zunächst einmal mich selbst davon überzeugen, dass jemand sympathisch sein konnte, dessen Beruf ich mit Ablehnung, Vorbehalt und Misstrauen, wenn nicht gar Feindseligkeit gegenüberstand? Das bisschen Verständnis, das wir gelegentlich für Polizeibeamte aufbrachten, äußerte sich in einer herablassenden Haltung. Der zeitweilig von uns gebrauchte Ausdruck vom ›armen Bullenschwein‹ beinhaltete weder Sympathie noch Mitleid, sondern war abwertend gemeint. Wenn meine Generation ihre tiefste Verachtung für den Polizisten zum Ausdruck bringen wollte, griff sie zudem nicht zum Wort ›Bulle‹ (batsos), sondern gebrauchte den Ausdruck ›Amtsorgan‹. Ein Freund von mir hatte sich angewöhnt, sich Polizisten mit der Anrede »Entschuldigung, wertes Amtsorgan« zu nähern. Das andere Wort für Bulle, baskinas, wurde damals selten bis gar nicht verwendet. Etymologisch leitet es sich vom türkischen baskin ab, was Angriff, Überfall, Razzia bedeutet. Somit wäre der Bulle auf den Begriff ›Angreifer‹ festgelegt, was ich nicht nur billig, sondern auch falsch fände.
Wie sollte es mir also gelingen, einen sympathischen Bullen zu kreieren? Diese Frage hat mich etliche Monate lang gequält, ohne dass ich eine Antwort darauf fand. Man könnte das nun Voreingenommenheit, linken Starrsinn oder auch Unflexibilität nennen. Das Problem ist, dass sich der Mensch (und leider mehr noch der Linke) nur schwer von bestimmten chronischen Leiden befreien kann, die auf Wunden der Vergangenheit zurückgehen. Sosehr sich auch die Gegenwart verändert hat, die Vergangenheit drängt sich – zumindest in gewissen Bereichen unseres Denkens – immer wieder in den Vordergrund.
Und dennoch kam die Lösung aus der Vergangenheit. Nach sechs Monaten erinnerte ich mich wieder daran, wie der Bulle zum ersten Mal vor mir aufgetaucht war: als pater familias einer dreiköpfigen kleinbürgerlichen Familie. Nicht der Beruf, sondern die soziale Klasse, also die kleinbürgerliche Familie, war das ausschlaggebende Merkmal. Denn auch ich stamme aus kleinbürgerlichen Verhältnissen. Meine Mutter widmete sich, wie Charitos’ Frau Adriani, voll und ganz dem Haushalt. Mein Vater hatte sich, wie Charitos bei Katerina, das Geld für das Studium seiner Kinder vom Mund abgespart.
Unglaublich, wie sehr die Uniform die Eigenschaften ihres Trägers überdeckt, wie sehr die Uniform uns dazu bringt, nur das ›Amtsorgan‹ und nicht den Menschen in der Uniform wahrzunehmen. Und es ist verwunderlich, aber auch außerordentlich gefährlich, dass nach so vielen Jahren immer noch ideologische Vorurteile unseren Blick trüben.
Vielleicht liegt das am tiefsitzenden Argwohn, den der Durchschnittsgrieche der politischen, der richterlichen und vor allem jeder uniformierten Form von Macht gegenüber empfindet. Wahrscheinlicher ist, dass es an unserer Unfähigkeit (oder auch unserer inneren Verweigerung) liegt, eine gründliche Verarbeitung der düsteren Jahre unserer neueren Geschichte – von der Besatzungszeit bis zum Zusammenbruch der Junta – in Angriff zu nehmen. Die Anerkennung des nationalen Widerstandes bildete fraglos einen mutigen Schritt, mündete jedoch nach so vielen Jahren, in denen Ungerechtigkeit und Unterdrückung eines Teils der griechischen Gesellschaft vorgeherrscht hatten, eher in einem Gefühl der Genugtuung als in dem der Versöhnung. Versöhnung erfordert, wie etwa in Südafrika, eine andere Herangehensweise. Nun, die jüngeren Generationen ignorieren diese brutale und abnorme historische Vergangenheit. Ich bin jedoch sicher, dass Vergessen nicht die geeignete Therapie sein kann. Denn Nelson Mandela, der kluge Kämpfer, sagte sehr richtig: forgive, but not forget – verzeihen, aber nicht vergessen.
Es ist seltsam, dass die Griechen den Ordnungshütern viel feindseliger und angriffslustiger gegenüberstehen als dem Militär, obwohl der letzte Putsch von Militärs ausgeführt wurde. Zwar kenne ich das eingängige Argument, die ›jungen Rekruten‹ gehörten sozusagen zur Familie. Aber wieso dann die Polizeibeamten nicht?
Wie auch immer die Erklärung lauten mag, es ist eine Tatsache, dass ich einen Mann wie meinen Vater vor Augen hatte, sobald ich Charitos die Uniform ausziehen und einen Anzug anziehen ließ. Es war, als hätte ich stundenlang versucht, einen Knoten zu lösen, und plötzlich das richtige Ende des Fadens erwischt. Das Knäuel begann sich zu entwirren, und ich erkannte nicht nur die Gemeinsamkeiten zwischen meinem Helden und meinem Vater wieder, sondern auch die zwischen seiner Frau Adriani und meiner Mutter.
Die einzige Ausnahme bildete Katerina, Adrianis und Charitos’ Tochter, die nicht mir oder meiner Schwester, sondern meiner eigenen Tochter sehr ähnlich ist. Des Öfteren habe ich mich gefragt, warum ich mit der Figur der Tochter das kompakte kleinbürgerliche Dreiecksverhältnis Vater–Mutter–Sohn durchbrochen habe. Möglicherweise ist es der Tatsache geschuldet, dass ich selbst eine Tochter großgezogen habe und folglich die Gedankenwelt und Reaktionen von Mädchen aus eigener Anschauung kenne, während Jungen für mich eine terra incognita sind. Sicherlich hat es auch mit der Tatsache zu tun, dass ich mir immer eine Tochter und nie einen Sohn wünschte. Das habe ich aber erst spät begriffen. Neun Monate lang gab ich mich gelassen und locker. Erst als mich die Krankenschwester hereinrief, um mir das Neugeborene zu zeigen, und mir verkündete, dass ich eine Tochter bekommen hatte, wurde mir bewusst, wie sehr ich gehofft hatte, es sei ein Mädchen, und ich vollführte einen Freudentanz.
Der dänische Philosoph Sören Kierkegaard unterteilte die Schriftsteller in existentielle und nichtexistentielle. Nichtexistentiell sind nach Kierkegaard diejenigen Schriftsteller, deren Werk sich von ihnen unabhängig macht. Im Gegensatz dazu verarbeiteten existentielle Schriftsteller Elemente ihrer Autobiographie und thematisierten ihre eigenen, die menschliche Existenz betreffenden Fragen. Als Beispiel für den ersten Fall führt Kierkegaard Ibsen an, als Beispiel für den zweiten Strindberg. Letzterer bestätigt nicht nur Kierkegaards Einteilung, sondern denkt sie in ihrer extremsten Konsequenz zu Ende. »Ich glaube, dass das Leben einer Person, das vollständig und gänzlich beschrieben wird, viel glaubwürdiger und enthüllender ist als das Leben einer ganzen Familie. Wie können wir wissen, was im Kopf der anderen vorgeht, wie können wir die verkappten Motive ihrer Handlungen kennen? Ja, sicherlich, wir konstruieren. Aber die Erkenntnis hat sich bislang nur geringfügig durch jene Schriftsteller weiterentwickelt, die mit ihren wenigen psychologischen Kenntnissen versuchten, das Seelenleben der Menschen darzustellen, das in Wirklichkeit verborgen ist«, schreibt Strindberg in seiner Autobiographie Der Sohn einer Magd.