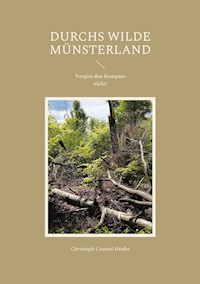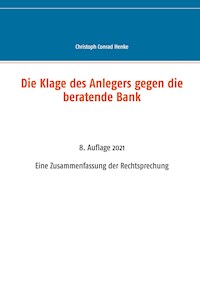
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
8. Auflage (Stand: 30.12.2020). Diese Zusammenstellung versucht, durch Wiedergabe wichtiger Urteilspassagen einen Überblick über die Rechtsprechung der Zivilgerichte zur Klage eines Anlegers gegen die beratende Bank zu geben. Er richtet sich an Praktiker (Richter, Rechtsanwälte), die interessante Urteilspassagen griffbereit zur Hand haben möchten, beispielsweise um sie in Urteilen oder Schriftsätzen zu zitieren, Rechtsreferendare, die in einer Kammer mit Sonderzuständigkeit für Bankrecht ausgebildet werden und sich einen Überblick über die Rechtsmaterie verschaffen wollen, sowie Anleger, die sich über die Erfolgsaussichten einer Klage informieren möchten. In der Neuauflage ist die BGH-Rechtsprechung aus dem Jahr 2020 berücksichtigt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 354
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Kurzübersicht
Wichtige Gesetzesänderungen
Wichtige BGH-Urteile ab 2014
Zulässigkeit der Klage: Zuständiges Gericht
Zulässigkeit der Klage: Entgegenstehende Rechtskraft
Aktivlegitimation/Abtretung
Anspruchsgrundlage
Beratungsvertrag
Substantiierungsobliegenheiten des Anlegers
Substantiierungsobliegenheiten der Bank
Anlegergerechte Beratung
Anlagegerechte Beratung
Rückvergütung und negativer Marktwert
Prospektfehler
Schriftliche Aufklärung durch Prospekt
Kausalität
Verschulden
Vorsatzvermutung
Beweislast
Beweiserhebung
Verjährung
Schaden
Streitwert
Kostenentscheidung
Kapitalanleger-Musterverfahrensgesetz
Inhaltsverzeichnis
Wichtige Gesetzesänderungen
Wichtige BGH-Urteile ab 2014
Zulässigkeit der Klage: Zuständiges Gericht
3.1 Sachliche Zuständigkeit
3.2 Gerichtsinterne Zuständigkeit
3.3 Örtliche Zuständigkeit
3.3.1 Allgemeiner Gerichtstand juristischer Personen
3.3.2 Erfüllungsort (§ 29 ZPO)
3.3.3 Niederlassung, Haustürgeschäft, Delikt
3.3.4 § 32b ZPO
3.4 Funktionelle Zuständigkeit
Zulässigkeit der Klage: Entgegenstehende Rechtskraft
Aktivlegitimation/Abtretung
5.1 Abtretung eines Freistellungsanspruchs
5.2 Abtretung an Schutzvereinigung oder Rechtsanwalt
5.3 Abtretung an vermögenslose Partei
5.4 Zurückbehaltungsrecht der Beklagten
5.5 Kein Erfordernis der Übertragung der Anlage
Anspruchsgrundlage
6.1 Positive Vertragsverletzung (§ 280 Abs. 1 BGB)
6.2 Deliktische Ansprüche
6.2.1 Vermittlungstätigkeit ohne Erlaubnis
6.2.2 „Churning“
Beratungsvertrag
7.1 Aufsichtsrechtlicher Begriff der Anlageberatung
7.2 Zivilrechtlicher Begriff der Anlageberatung
7.3 Abgrenzung zum Finanzierungsberatungsvertrag
7.4 „Robo Advice“
7.5 Kein Dauerberatungsvertrag
7.6 Erweiterung des Schutzzwecks
7.7 Beratungsvertrag nach Erwerb
7.8 Einbeziehung Dritter
7.9 Ehegatte als Wissensvertreter
7.10 Forderungsgemeinschaft (§ 432 BGB)
7.11 Pflichten in Abgrenzung zur Anlagevermittlung
7.12 Aufsichtsrechtlicher Begriff der Anlagevermittlung
7.13 Zivilrechtlicher Begriff der Anlagevermittlung
7.14 Beratungsfreies Geschäft
7.15 Partieller Beratungsverzicht
Substantiierungsobliegenheiten des Anlegers
8.1 Allgemeines
8.2 Mindestvoraussetzungen
8.3 Tod des Anlegers
8.4 Fehlende Erinnerung des Anlegers
8.5 Vorsatz der Bank
Substantiierungsobliegenheiten der Bank
9.1 Sekundäre Darlegungslast
9.2 Prospektübergabe
9.3 Kausalität
9.4 Vorlage interner Dokumente
9.5 Name des Bankberaters
9.6 Bestreiten mit Nichtwissen
Anlegergerechte Beratung
10.1 Allgemeines
10.2 Explorationspflicht / Geeignetheitsprüfung
10.3 Aufklärungsbedürftigkeit
10.3.1 Allgemeines
10.3.2 Aushändigung von Informationsmaterial
10.3.3 Berufliche Qualifikation des Anlegers
10.3.4 Vorerfahrungen des Anlegers
10.4 Risikobereitschaft des Kunden
10.4.1 Wunsch nach einer sicheren Anlage
10.4.2 Sicherheit und geschlossener Immobilienfonds
10.4.3 Sicherheit und offener Immobilienfonds
10.4.4 SWAP-Geschäfte
10.5 Anlageziel der Altersvorsorge
10.6 Klumpenrisiko
10.7 „Heilung“ eines Verstoßes
Anlagegerechte Beratung
11.1 Allgemeines
11.1.1 Abgrenzung zur werbenden Anpreisung
11.1.2 Prüfung mit banküblichem kritischen Sachverstand
11.1.3 Hauseigene Produkte
11.1.4 Prognosen
11.1.5 Negative Berichterstattung
11.1.6 Allgemeines Risiko pflichtwidrigen Verhaltens
11.1.7 Strafrechtliche Ermittlungen
11.2 Offene Immobilienfonds
11.3 SWAP-Geschäfte
11.3.1 Unbegrenztes Verlustrisiko
11.3.2 Funktionsweise
11.3.3 Negativer Marktwert (anlagegerechte Beratung)
11.3.4 Wechselkursrisiko
11.3.5 Exkurs: ultra vires-Grundsatz
11.3.6 Exkurs: kommunalrechtliches Spekulationsverbot
11.3.7 Exkurs: Sittenwidrigkeit (§ 138 BGB)
11.4 Geschlossene Fonds
11.4.1 Eingeschränkte Handelbarkeit
11.4.2 Totalverlustrisiko
11.4.3 Haftung als GbR-Gesellschafter oder Kommanditist
11.4.4 Kapitalmäßige und personelle Verflechtungen
11.4.5 Exkurs: Sittenwidrigkeit eines „Todesfonds“?
11.5 Zertifikate
11.5.1 Emittentenrisiko
11.5.2 Fehlende Einlagensicherung
11.5.3 Konkrete Insolvenzgefahr
11.5.4 Sonderkündigungsrecht des Emittenten
11.5.5 Zukünftige Indexstände
11.5.6 Unterschied zwischen Emittent und Garant
Rückvergütung und negativer Marktwert
12.1 Allgemeines
12.1.1 Entstehung der Rückvergütungsrechtsprechung
12.1.2 Abgrenzung zur Innenprovision
12.1.3 Zweipersonenverhältnis
12.1.4 Negativer Marktwert bei SWAP-Geschäften
12.1.5 Aufklärungspflicht bei Zertifikaten
12.1.6 Zusammenfassende Definition der Rückvergütung
12.1.7 Einverständnis bei anderen Produkten
12.2 Hauseigene Produkte
12.3 Unterschied zum Finanzierungsberatungsvertrag
12.4 Unterschied zum freien Anlageberater
12.5 Innenprovisionen vor dem 1.8.2014 (Bankberatung)
12.6 Innenprovisionen ab dem 1.8.2014 (Bankberatung)
12.7 Zusammenfassung Dreipersonenverhältnis
12.8 Kein Verstoß gegen das Rückwirkungsverbot
Prospektfehler
13.1 Allgemeines
13.1.1 Abgrenzung zur Prospekthaftung
13.1.2 Aufklärungspflicht über Prospektfehler
13.1.3 Prüfungsmaßstab der Bank
13.1.4 Notwendiger Prospektinhalt
13.1.5 Empfängerhorizont
13.2 Häufige Fragestellungen
13.2.1 Haftung des KG-/GbR-Gesellschafters
13.2.2 Eingeschränkte Handelbarkeit
13.2.3 Prognosen
13.2.4 Altersvorsorge
13.2.5 Totalverlustrisiko
13.2.6 Steuerliche Anerkennungsfähigkeit
13.3 Beispiele für die Prüfung von Prospektfehlern
13.3.1 Interessenkonflikt
13.3.2 Weichkosten
13.3.3 Höhe der Vermittlungsprovision und Rückvergütung
13.3.4 SWAP-Geschäfte der Fondsgesellschaft
13.3.5 Risiko aus einer Inhaberschuldverschreibung
13.3.6 Mietausfallrisiko
13.3.7 Stand behördlicher Genehmigungen
13.3.8 Immobilienbewertung
13.3.9 Loan to Value-Klausel
13.3.10 Haftung nach §§ 30, 31 GmbHG
13.3.11 Übertragung von Aktien an eine Konzerntochter
13.3.12 Garantien und Worst-case-Szenarien
13.3.13 Mietgarantie
13.3.14 Strafrechtliche Ermittlungen
13.3.15 Fehlerhafte Widerrufserklärung
13.3.16 Nichterreichen der Zeichnungssumme
Schriftliche Aufklärung durch Prospekt
14.1 Allgemeines
14.2 Verharmlosung von Risiken
Kausalität
15.1 Vermutung aufklärungsrichtigen Verhaltens
15.2 Beweiserhebung
15.2.1 Parteivernehmung auf Antrag der Bank
15.2.2 Parteivernehmung und Ausforschung
15.2.3 Vernehmung des Bankberaters zu Hilfstatsachen
15.2.4 Entfallen der Pflicht zur Parteivernehmung
15.3 Indizien zur Kausalität (Rückvergütung)
15.3.1 Klageerhebung wegen angefallener Verluste
15.3.2 Anlagemotiv Steuerersparnis
15.3.3 Kenntnis von Provisionen dem Grunde nach
15.3.4 Kenntnis bei vergleichbaren Produkten
15.3.5 Kenntnis bei nicht vergleichbaren Produkten
15.3.6 Mangelnde Nachfragen
15.3.7 Selektive Rückabwicklung
15.4 Kausalität der Nichtaufklärung über Prospektfehler
15.5 Kausalität und negativer Marktwert
15.6 Venire contra factum proprium
Verschulden
Vorsatzvermutung
Beweislast
18.1 Beratungsvertrag
18.2 Kommissionsgeschäft
18.3 Beratungsfehler
18.4 Beratungsverzicht
18.5 Verschulden bei Vertragsschluss
18.6 Prospektfehler
18.7 Plausibilitätsdefizit
18.8 Berichtigung eines Prospektfehlers
18.9 Zeitpunkt der Prospektübergabe
18.10 Fehlende Beweiskraft einer Empfangsbestätigung
18.11 „Heilung“ eines Verstoßes
18.12 Kausalität
18.13 Verschulden
18.14 Vorsatz
18.15 Entgangener Gewinn
18.16 Steuervorteile
18.17 Beratungsdokumentation (vor 2010)
18.18 Beratungsprotokoll (ab 1.1.2010)
18.19 Informationsblatt
18.20 Geeignetheitserklärung (ab 3.1.2018)
18.21 Telefonaufzeichnungen (ab 3.1.2018)
18.22 Verjährung
Beweiserhebung
19.1 Grundsatz der Waffengleichheit
19.2 Parteianhörung und Parteivernehmung
Verjährung
20.1 Verjährungsfristen
20.1.1 Verjährung nach § 37a WpHG a.F. (Altfälle)
20.1.2 Verjährung nach BGB a.F. (Altfälle)
20.1.3 Verjährung nach BGB n.F.
20.2 Verjährungsbeginn
20.2.1 Entstehung des Anspruchs
20.2.2 Verjährung eines Freistellungsanspruchs
20.2.3 Gesonderter Lauf der Verjährung
20.2.4 Grob fahrlässige Unkenntnis
20.2.5 Schlüssiger Vortrag zur Kenntnis des Anlegers
20.2.6 Unterlassenes Lesen des Verkaufsprospekts
20.2.7 Unterlassenes Lesen des Zeichnungsscheins
20.2.8 Rechenschafts-/Geschäftsberichte
20.2.9 Kenntnis aus Beratungsprotokoll
20.2.10 Verluste im Depotauszug
20.2.11 Rückvergütung/negativer Marktwert
20.2.12 Zurückbehaltungsrecht und Verjährung
20.2.13 Auskunfts-/Herausgabeanspruch
20.3 Verjährungsende
20.4 Hemmung der Verjährung
20.4.1 Hemmung durch Verhandlungen
20.4.2 Hemmung durch Güteverfahren
20.4.3 Hemmung durch Mahnbescheid
20.4.4 „Nachgeschobene“ Pflichtverletzungen
Schaden
21.1 Unterschied zum Finanzierungsberatungsvertrag
21.2 „Großer“ und „kleiner“ Schadensersatz
21.3 Zug um Zug-Leistung
21.4 Entgangener Gewinn
21.5 Nutzungen auf Ausschüttungen
21.6 Zinsen aus Delikt und Bereicherungsrecht
21.7 Inflationsausgleich
21.8 Annahmeverzug
21.9 Feststellung des Ersatzes weiterer Schäden
21.10 Feststellungsklage statt Leistungsklage
21.11 Freistellung von Ansprüchen
21.12 Vorgerichtliche Anwaltskosten
21.12.1 Toleranzrechtsprechung
21.12.2 Zahlungsanspruch statt Freistellung
21.12.3 Rechtsschutzversicherung
21.12.4 Rechtsanwaltskosten und Güteverfahren
21.13 Steuervorteile
21.13.1 Allgemeines
21.13.2 Allgemeiner oder persönlicher Steuersatz
21.13.3 Freibetrag nach § 16 Abs. 4 EStG
21.13.4 10-jährige Spekulationsfrist nach EStG
21.13.5 Hilfs-Widerklage zu Steuervorteilen
21.14 Herausgabeanspruch hinsichtlich Provisionen
21.15 Anspruch auf Auskunft über die Höhe?
21.16 Mitverschulden des Anlegers
21.17 Vorteilsausgleich
Streitwert
22.1 Anlagebetrag abzüglich Ausschüttungen
22.2 Finanzierte Kapitalanlagegeschäfte
22.3 Entgangener Gewinn
22.4 Herausgabe einer Provision
22.5 Feststellung der Erledigung
22.6 Annahmeverzug
22.7 Auf Freistellung gerichteter Feststellungsantrag
22.8 Freistellung von Kommandistenhaftung
22.9 Freistellung von Darlehensansprüchen
22.10 Freistellung von Ansprüchen aus SWAP-Vertrag
22.11 Feststellung des Ersatzes künftiger Schäden
22.12 Vorgerichtliche Anwaltskosten
Kostenentscheidung
Kapitalanleger-Musterverfahrensgesetz
24.1 Anwendungsbereich
24.2 Streitgegenstand und Teilmusterentscheid
24.3 Abhängigkeit von den Feststellungszielen
24.4 Bestimmtheit der Feststellungsziele
24.5 Bindung an Vorlagebeschluss
24.6 Aussetzung
24.7 Keine Erweiterung vor Landgericht
24.8 Keine Streitverkündung
24.9 Beschwerde
Vorwort
Diese Zusammenstellung versucht, einen Überblick über die Rechtsprechung der Zivilgerichte zur Klage eines Anlegers gegen die beratende Bank zu geben. Sie richtet sich an
Praktiker (Richter, Rechtsanwälte), die einschlägige Urteilspassagen griffbereit zur Hand haben möchten, z.B. um sie in Urteilen oder Schriftsätzen zu zitieren,
Rechtsreferendare, die in einer Kammer mit Sonderzuständigkeit für Bankrecht ausgebildet werden und sich einen Überblick über die Rechtsmaterie verschaffen wollen, sowie
Anleger, die sich über die Erfolgsaussichten einer Klage informieren möchten.
Die Zusammenstellung befasst sich nicht mit anderen Aspekten des Bankrechts wie dem Widerruf von Darlehen wegen fehlerhafter Widerrufsbelehrung oder der Finanzierung sog. „Schrottimmobilien“. Auch behandelt sie aufsichtsrechtliche Pflichten lediglich am Rande, da diese für sich betrachtet „weder eine Begrenzung noch eine Erweiterung der zivilrechtlich zu beurteilenden Haftung des Anlageberaters“ begründen.1 Der Aufbau entspricht der Reihenfolge, in der ein Zivilrichter die einschlägigen Rechtsprobleme prüfen kann. Insoweit knüpft die Zusammenstellung primär an die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs, namentlich des III. und XI. Zivilsenats, an. Soweit höchstrichterliche Rechtsprechung nicht vorhanden ist, wird auf Entscheidungen der Instanzgerichte zurückgegriffen.
Meinen früheren und derzeitigen Kolleginnen und Kollegen verdanke ich zahlreiche Hinweise und Anregungen.
Münster-Hiltrup im Januar 2021 Der Verfasser
1 Zitiert nach BGH, Urteil vom 17.9.2013, XI ZR 332/12, Rn. 20.
1 Wichtige Gesetzesänderungen
Mit dem „Gesetz zur Neuregelung der Rechtsverhältnisse bei Schuldverschreibungen aus Gesamtemissionen und zur verbesserten Durchsetzbarkeit von Ansprüchen von Anlegern aus Falschberatung“ hat der Gesetzgeber mit Wirkung ab dem 1.1.2010 die Pflicht zur Erstellung eines Beratungsprotokolls eingeführt2 (das 2018 durch die Geeignetheitserklärung ersetzt wurde), außerdem ein Mitarbeiter- und Beschwerderegister bei der BaFin.3
Mit dem „Gesetz zur Stärkung des Anlegerschutzes und Verbesserung der Funktionsfähigkeit des Kapitalmarktes (Anlegerschutz- und Funktionsverbesserungsgesetz)“ hat der Gesetzgeber mit Wirkung ab dem 1.7.2011 die Pflicht eingeführt, dem Kunden ein Produktinformationsblatt zu Finanzinstrumenten zur Verfügung zu stellen.4
Mit Wirkung ab dem 1.11.2012 hat der Gesetzgeber das 2005 in Kraft getretene „Gesetz über Musterverfahren in kapitalmarktrechtlichen Streitigkeiten“ (Kapitalanleger-Musterverfahrensgesetz – KapMuG) überarbeitet und den Anwendungsbereich auf Fälle der Anlageberatung erweitert.
Das teilweise am 22.7.2013 in Kraft getretenen Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) enthält neue Regelungen insbesondere zu offenen Immobilienfonds und geschlossenen Fonds.5 So wird die Fremdfinanzierung geschlossener Fonds begrenzt.6 Der Gesetzgeber hat mit § 306 KAGB eine neue Vorschrift zur spezialgesetzlichen Prospekthaftung geschaffen. Das KAGB wurde durch das Gesetz zur Anpassung von Gesetzen auf dem Gebiet des Finanzmarktes vom 15.7.2014 überarbeitet.
Mit dem „Gesetz zur Förderung und Regulierung einer Honorarberatung über Finanzinstrumente (Honoraranlageberatungsgesetz)“ hat der Gesetzgeber mit Wirkung ab dem 1.8.2014 die Honorarberatung neu geregelt. Die beratende Bank ist verpflichtet, den Kunden im Vorfeld darauf hinzuweisen, ob die Anlageberatung unabhängig (unabhängige Honorarberatung) erbracht wird.7
Am 10.7.2015 ist das Kleinanlegerschutzgesetz in Kraft getreten. Es enthält u.a. Vorgaben zur Konkretisierung und Erweiterung der Prospektpflicht, zur Einführung einer Mindestlaufzeit der Vermögensanlage sowie die Verschärfung von Rechnungslegungsvorschriften.8
Mit Wirkung zum 1.1.2018 wurden für Streitigkeiten aus Bank- und Finanzgeschäften obligatorische Spezialkammern beim Landgericht und Senate beim Oberlandesgericht eingeführt.9
Am 3.1.2018 trat das Zweite Finanzmarktnovellierungsgesetz in Kraft. Dieses sieht u.a. vor, dass telefonische Auftragserteilungen aufgezeichnet werden.10 Der Anleger erhält ein Kostenblatt mit einer Zusammenstellung der Produktkosten.11 Das Beratungsprotokoll wurde durch eine Geeignetheitserklärung ersetzt.12
Mit Wirkung zum 1.11.2018 hat der Gesetzgeber eine Musterfeststellungsklage für Ansprüche aus allen Bereichen des bürgerlichen Rechts eingeführt.13
2 § 34 Abs. 2a WpHG a.F.; vgl. § 64 Abs. 4 WpHG n.F.
3 § 34d WpHG a.F.; vgl. § 87 WpHG n.F.
4 § 31 Abs. 3a WpHG a.F.; vgl. § 64 Abs. 2 WpHG n.F.
5 Vgl. Hübner, Jürgen, Immobilienanlagen unter dem KAGB, WM 2014, S. 106 ff.
6 § 263 KAGB.
7 § 31 Abs. 4b WpHG a.F.; vgl. § 64 Abs. 1 Nr. 1 WpHG n.F.
8 BT-Drucks. 18/3994 vom 11.2.2015, S. 1.
9 §§ 72a, 119a GVG.
10 Vgl. § 83 Abs. 3 WpHG n.F.
11 Vgl. § 63 Abs. 7 und 13 WpHG n.F.; vgl. Art. 50 Abs. 2 der Delegierten Verordnung vom 25.4.2016 zur Ergänzung der Richtlinie 2014/65/EU.
12 Vgl. § 64 Abs. 3 und 4 WpHG n.F.
13 § 606 ff ZPO.
2 Wichtige BGH-Urteile ab 2014
Mit drei Urteilen vom 28.1.2014 äußerte sich der BGH (nochmals) zur Frage, unter welchen Voraussetzungen bei der Rückabwicklung geschlossener Fonds Steuervorteile von der Klageforderung abzuziehen sind.14
Mit zwei Urteilen vom 29.4.2014 stellte der BGH klar, dass eine Bank, die den Erwerb von Anteilen an einem offenen Immobilienfonds empfiehlt, den Anleger ungefragt über die Möglichkeit einer zeitweiligen Aussetzung der Anteilsrücknahme durch die Fondsgesellschaft aufzuklären hat.15
Mit Urteil vom 3.6.2014 entschied der BGH, dass eine beratende Bank Kunden ab dem 1.8.2014 über den Empfang verdeckter Innenprovisionen unabhängig von deren Höhe aufzuklären hat. Soweit diese Aufklärung im Rahmen von Anlageberatungsverträgen vor dem 1.8.2014 unterblieben ist, haftet die beratende Bank ggf. nicht.16 Für Anlageberatungen durch eine Bank ab August 2014 entfällt die bislang erforderliche Abgrenzung zwischen Rückvergütungen und Innenprovisionen.
Mit Urteil vom 28.4.2015 hat der BGH seine Rechtsprechung zu SWAP-Geschäften fortentwickelt.17 Er hat bestätigt, dass eine beratende Bank verpflichtet ist, den Kunden über einen anfänglichen negativen Marktwert aufzuklären. Die Komplexität des Swap-Vertrages ist kein Kriterium, das über das Bestehen oder Nichtbestehen der Aufklärungspflicht entscheidet. Die Bank muss jedoch nicht über den anfänglichen negativen Marktwert aufklären, wenn der Swap-Vertrag der Absicherung gegenläufiger Zins- oder Währungsrisiken aus konnexen Grundgeschäften dient.
Mit mehreren Urteilen vom 18.6.2015 hat sich der BGH zu der Frage geäußert, unter welchen Voraussetzungen Güteanträge die Verjährung hemmen. In Anlageberatungsfällen hat der Güteantrag regelmäßig die konkrete Kapitalanlage zu bezeichnen, die Zeichnungssumme sowie den (ungefähren) Beratungszeitraum anzugeben und den Hergang der Beratung mindestens im Groben zu umreißen. Eine genaue Bezifferung der Forderung muss der Güteantrag demgegenüber grundsätzlich nicht enthalten.18
Mit Urteilen vom 23.6.2015 und 16.7.2015 hat der BGH für das Anlageberatungsrecht bestätigt, dass die Geltendmachung des „großen“ Schadensersatzes, der nur Zug um Zug gegen Herausgabe eines erlangten Vorteils zu gewähren ist, im Mahnverfahren nicht zu einer Hemmung der Verjährung führt, wenn der Antragsteller bewusst falsche Angaben zur Gegenleistung macht.19 Da im Falle einer fehlerhaften Anlageberatung die erworbene Anlage ggf. an die beratende Bank zurückzuübertragen ist, kann der Anleger seine Schadensersatzansprüche oft nicht mit verjährungshemmender Wirkung im Mahnverfahren geltend machen.
Mit Urteil vom 22.3.2016 hat sich der BGH zur Aufklärungspflicht bei SWAP-Geschäften geäußert und die Voraussetzungen konkretisiert, unter denen ein SWAP-Geschäft konnex auf einen Darlehensvertrag bezogen ist.20 Dies ist für die Frage der Aufklärungspflicht über einen schwerwiegenden Interessenkonflikt (negativer Marktwert) von Bedeutung. Darüber hinaus hat der BGH die Voraussetzungen des Vorteilsausgleichs konkretisiert.
Mit mehreren Urteilen vom 26.7.2016 hat sich der BGH zur Kausalität des negativen Marktwertes bei SWAP-Geschäften (Anforderungen an den Vortrag der Bank, maßgeblicher Personenkreis) geäußert.21
Ferner hat sich der BGH im Jahr 2017 u.a. mit Fragen zum KapMuG22, zur Substantiiertheit des Vortrags eines Anlageberaters zur Prospektübergabe23 und zur Verjährung – insbesondere im Zusammenhang mit Angaben im Zeichnungsschein24 – befasst.
Mit Urteil vom 19.12.2017 hat der BGH über die Beratungspflichten einer Bank bei Abschluss eines strukturierten Darlehens, insbesondere die Verharmlosung eines Wechselkursrisikos, entschieden. Die festgestellte Aufklärungspflichtverletzung führt bei einem Finanzierungsvertrag zu einem Anspruch auf Ersatz der durch die gewählte Finanzierung entstandenen Mehrkosten, nicht zur Rückabwicklung.25
Mit Beschluss vom 7.6.2018 hat sich der BGH mit der Frage auseinandergesetzt, inwieweit eine Partei, die sich an ein Geschehen nicht erinnern kann, eine ihr günstige Behauptung unter Zeugenbeweis stellen kann,26 mit Beschluss vom 5.6.2018 mit der Frage, zu welchem Vortrag ein Kläger verpflichtet ist, der sich im Rahmen der Verjährungsproblematik des § 31a WpHG a.F. auf Vorsatz der Bank beruft,27 mit Urteil vom 18.10.2018 mit Fragen des Vorteilsausgleichs28 und mit Beschluss vom 23.10.2018 mit Fragen des KapMuG.29
Mit Beschluss vom 26.3.2019 hat der XI. Zivilsenat des BGH klargestellt, dass auch im Falle eines vertraglich eingeräumten Widerrufsrechts die Verjährung mit dem Vertragsschluss beginnt30 und sich mit Beschluss vom 12.3.2019 (nochmals) zu den Voraussetzungen eines konnexen Grundgeschäfts bei einem SWAP-Geschäft geäußert.31 Zu § 7 KapMuG a.F. hatte der BGH entschieden, dass es das Gebot effektiven Rechtsschutzes gebieten kann, zunächst eine Entscheidung über die nicht dem Anwendungsbereich des KapMuG unterliegenden Sachverhalte zu treffen, bevor ein Verfahren ausgesetzt wird.32 Diese Maßstäbe hat der BGH mit Beschluss vom 30.4.2019 auf das KapMuG n.F. übertragen.33 Darüber hinaus hat sich der BGH mit der Frage befasst, unter welchen Voraussetzungen der Schutzweck einer verletzten Beratungspflicht über die konkrete Anlageentscheidung hinausgehen kann.34
Im Jahr 2020 gab es interessante BGH-Entscheidungen insbesondere zu § 32b ZPO35, zur Beweisaufnahme,36 zur Verjährungshemmung beim Güteantrag37 und zum KapMuG.38
14 BGH, Urteile vom 28.1.2014, XI ZR 495/12, XI ZR 42/13 und XI ZR 49/13.
15 BGH, Urteile vom 29.4.2014, XI ZR 477/12 und XI ZR 130/13.
16 BGH, Urteil vom 3.6.2014, XI ZR 147/12.
17 BGH, Urteil vom 28.4.2015, XI ZR 378/13.
18 BGH, Urteile vom 18.6.2015, III ZR 189/14, III ZR 191/14, III ZR 198/14 und III ZR 227/14.
19 BGH, Urteil vom 23.6.2015, XI ZR 536/14; bestätigt durch BGH, Urteil vom 16.7.2015, III ZR 238/14.
20 BGH, Urteil vom 22.3.2016, XI ZR 425/14.
21 BGH, Urteile vom 26.7.2016, XI ZR 351/14, 352/14, 353/14, 354/14, 356/14 und 150/15.
22 BGH, Beschluss vom 9.3.2017, III ZB 135/15; Beschluss vom 19.9.2017, XI ZB 17/15.
23 BGH, Urteil vom 19.10.2017, III ZR 565/16.
24 BGH, Urteil vom 23.3.2017, III ZR 93/16, Rn. 11.
25 BGH, Urteil vom 19.12.2017, XI ZR 152/17.
26 BGH, Beschluss vom 7.6.2018, III ZR 210/17, Rn. 4.
27 BGH, Beschluss vom 5.6.2018, XI ZR 388/16.
28 BGH, Urteil vom 18.10.2018, III ZR 497/16.
29 BGH, Beschluss vom 23.10.2018, XI ZB 3/16.
30 BGH, Beschluss vom 26.3.2019, XI ZR 372/18; vgl. zur Rechtslage beim freien Anlageberater BGH, Urteil vom 8.11.2018, III ZR 628/16.
31 BGH, Beschluss vom 12.3.2019, XI ZR 38/17.
32 BGH, Beschluss vom 30.11. 2010, XI ZB 23/10, Rn. 16.
33 Vgl. BGH, Beschluss vom 30.4.2019, XI ZB 13/18, Rn. 27.
34 BGH, Urteil vom 21.11.2019, III ZR 244/18.
35 BGH, Beschluss vom 21.7.2020, II ZB 19/19.
36 BGH, Beschluss vom 18.2.2020, XI ZR 196/19.
37 BGH, Urteil 1.10.2020, III ZR 60/19.
38 BGH, Beschluss vom 16.6.2020, II ZB 30/19; Beschluss vom 21.7.2020, II ZB 19/19; Beschluss vom 28.7.2020, XI ZB 21/19; Beschluss vom 6.10.2020, XI ZB 28/19.
3 Zulässigkeit der Klage: Zuständiges Gericht
3.1 Sachliche Zuständigkeit
Für Streitigkeiten, die die Summe von 5.000 € nicht übersteigen, ist für gewöhnlich39 das Amtsgericht zuständig, für Streitigkeiten darüber das Landgericht.40
Wird die Klage beim sachlich unzuständigen Gericht eingereicht, ist das Amtsgericht dazu verpflichtet, den Beklagten darauf hinzuweisen.41 Für das Landgericht fehlt eine entsprechende Vorschrift. Der Beklagte kann die Zuständigkeit rügen oder sich rügelos einlassen. Durch die rügelose Einlassung wird die Zuständigkeit des Gerichts begründet.42 Rügt der Beklagte die Zuständigkeit, wird das Verfahren auf Antrag des Klägers an das zuständige Gericht verwiesen.43 Stellt der Kläger trotz Hinweises des Gerichts keinen Verweisungsantrag, wird die Klage ggf. als unzulässig abgewiesen.
3.2 Gerichtsinterne Zuständigkeit
Geht beim Landgericht die Schadensersatzklage eines Anlegers wegen fehlerhafter Anlageberatung ein, wird sie von der Verteilungsstelle des Gerichts nach den Vorgaben des jeweiligen Geschäftsverteilungsplans einer Zivilkammer zugeordnet.
Mit Wirkung ab dem 1.1.2018 hat der Gesetzgeber bei den Landgerichten obligatorische Spezialkammern für Streitigkeiten aus Bank- und Finanzgeschäften eingeführt.44 Damit sind zunächst drei Richter für das Verfahren zuständig. Diese können das Verfahren durch Beschluss auf den Einzelrichter übertragen.45 Diese Befugnis bleibt von der Einführung der obligatorischen Spezialkammern unberührt.46
Innerhalb der Zivilkammer wird das Verfahren nach einem kammerinternen (weiteren) Geschäftsverteilungsplan einem bestimmten Richter als Berichterstatter und ggf. Einzelrichter zugeteilt. Die kammerinterne Zuteilung kann sich insbesondere nach der Endziffer der Akte richten.
3.3 Örtliche Zuständigkeit
Bei der örtlichen Zuständigkeit ist zwischen allgemeinem, besonderem und ausschließlichem Gerichtsstand zu unterscheiden. Ein ausschließlicher Gerichtsstand ist zwingend. Die Klage kann nur dort erhoben werden; eine rügelose Einlassung ist nicht möglich.47 Ist keine Vorschrift zu einem ausschließlichen Gerichtsstand einschlägig, hat der Kläger die Wahl zwischen allgemeinem und einem ggf. einschlägigen besonderen Gerichtsstand.
3.3.1 Allgemeiner Gerichtstand juristischer Personen
Der Anleger kann gegen die beratende Bank an deren Sitz klagen, wenn kein ausschließlicher Gerichtsstand einschlägig ist. § 17 ZPO gilt insbesondere für Aktiengesellschaften, Genossenschaftsbanken sowie Anstalten öffentlichen Rechts (Rechtsform, in der Sparkassen üblicherweise geführt werden).
Wurde die Klage vor dem Gericht, in dessen Bezirk sich der Sitz der Bank befindet (§ 17 ZPO), erhoben, ist die örtliche Zuständigkeit fast immer gegeben (vgl. zu Ausnahmen § 32b ZPO).
3.3.2 Erfüllungsort (§ 29 ZPO)
§ 29 ZPO begründet den besonderen Gerichtsstand des Erfüllungsorts. Dies ist bei der Anlageberatung der Ort der Beratung. Findet die Anlageberatung in den Geschäftsräumen des Beraters statt, ist dessen Geschäftssitz maßgeblich:
„Grundsätzlich ist Erfüllungsort bei einem Beratungsvertrag, der auf Kapitalanlagegeschäfte gerichtet ist, der Geschäftssitz des Beraters (BGH NJW 2002, 2703; BayObLG NJW 2002, 2888).“48
Findet die Beratung in der Wohnung des Kunden statt, ist der Ort der Wohnung maßgeblich; findet die Beratung an einem dritten Ort statt, ist dieser maßgeblich.49
3.3.3 Niederlassung, Haustürgeschäft, Delikt
Gemäß § 21 ZPO kann der besondere Gerichtsstand der Niederlassung eröffnet sein, gemäß § 29c ZPO der besondere Gerichtsstand für Haustürgeschäfte. In seltenen Fällen kann der besondere Gerichtsstand der unerlaubten Handlung (§ 32 ZPO) einschlägig sein.
3.3.4 § 32b ZPO
§ 32b ZPO begründet einen ausschließlichen Gerichtsstand. Absatz 1 der Vorschrift lautet:
„(1) Für Klagen, in denen
1. ein Schadensersatzanspruch wegen falscher, irreführender oder unterlassener öffentlicher Kapitalmarktinformation,
2. ein Schadensersatzanspruch wegen Verwendung einer falschen oder irreführenden öffentlichen Kapitalmarktinformation oder wegen Unterlassung der gebotenen Aufklärung darüber, dass eine öffentliche Kapitalmarktinformation falsch oder irreführend ist, oder
3. ein Erfüllungsanspruch aus Vertrag, der auf einem Angebot nach dem Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz beruht, geltend gemacht wird, ist das Gericht ausschließlich am Sitz des betroffenen Emittenten, des betroffenen Anbieters von sonstigen Vermögensanlagen oder der Zielgesellschaft zuständig, wenn sich dieser Sitz im Inland befindet und die Klage zumindest auch gegen den Emittenten, den Anbieter oder die Zielgesellschaft gerichtet wird.“
Fragen des § 32b ZPO können Gegenstand eines KapMuG-Verfahrens sein.50
3.3.4.1 Definitionen
Öffentliche Kapitalmarktinformationen im Sinne von § 32b ZPO sind Informationen über Tatsachen, Umstände, Kennzahlen und sonstige Unternehmensdaten, die für eine Vielzahl von Kapitalanlegern bestimmt sind und einen Emittenten von Wertpapieren oder einen Anbieter von sonstigen Vermögensanlagen betreffen.51
Der BGH hat den Begriff des Emittenten wie folgt definiert:
„Emittent eines Wertpapiers ist derjenige, der es begibt (Münch-KommZPO/Patzina, 4. Auflage, § 32b Rn. 4; Musielak/Heinrich, ZPO, 10. Auflage, § 32b Rn. 5; Zöller/Vollkommer, ZPO, 29. Auflage, § 32b Rn. 7). Emittent einer sonstigen Vermögensanlage ist derjenige, der sie erstmals auf den Markt bringt und für seine Rechnung unmittelbar oder durch Dritte öffentlich zum Erwerb anbietet).“52
„Für Klagen, in denen ein Schadensersatzanspruch wegen falscher, irreführender oder unterlassener öffentlicher Kapitalmarktinformation geltend gemacht wird, ist, soweit es um die Emittentenpublizität am Sekundärmarkt geht, betroffener Emittent derjenige, dem eine Informationspflichtverletzung in Bezug auf die von ihm begebenen Finanzinstrumente vorgeworfen wird.“53
„Das Oberlandesgericht hat weiterhin zutreffend und innerhalb der Grenzen der Feststellungsziele… angenommen, dass für den Fall einer Beihilfe zur Informationspflichtverletzung eines anderen Emittenten nach § 32b Abs. 1 Nr. 1 ZPO ein ausschließlicher Gerichtsstand am Sitz des Emittenten begründet ist, dem eine falsche, irreführende oder unterlassene Kapitalmarktinformation in Bezug auf die von ihm begebenen Finanzinstrumente vorgeworfen wird… Ausgehend davon, dass betroffener Emittent nach § 32b Abs. 1 ZPO derjenige ist, dem eine Informationspflichtverletzung in Bezug auf die von ihm begebenen Finanzinstrumente vorgeworfen wird, kann die Musterbeklagte zu 2, soweit ihr eine Beihilfe zu einer Informationspflichtverletzung der Musterbeklagten zu 1 hinsichtlich der von ihr begebenen Finanzinstrumente vorgeworfen wird, nicht selbst betroffene Emittentin sein.“54
Anbieter ist in Anlehnung an § 2 Nr. 10 WpPG derjenige, der für das öffentliche Angebot von Vermögensanlagen verantwortlich ist und den Anlegern gegenüber entsprechend auftritt.55 Hieran anknüpfend hat der BGH ausgeführt:
„Anbieter ist derjenige, der für das öffentliche Angebot von Vermögensanlagen verantwortlich ist und so auch den Anlegern gegenüber auftritt… Der Anbieter muss nicht zwingend mit dem Emittenten identisch sein. Insbesondere bei Übernahmekonsortien ist als Anbieter anzusehen, wer den Anlegern gegenüber nach außen erkennbar, beispielsweise in Zeitungsanzeigen, als Anbieter auftritt. Wenn der Vertrieb über Vertriebsorganisationen, ein Netz von angestellten oder freien Vermittlern oder Untervertrieb erfolgt, ist derjenige als Anbieter anzusehen, der die Verantwortung für die Koordination der Vertriebsaktivitäten innehat…“56
Eine Zielgesellschaft im Sinne von § 32b ZPO setzt einen übernahmerechtlichen Sachverhalt im Sinne von § 32b Abs. 1 Nr. 3 ZPO voraus.57
3.3.4.2 Erweiterung des Anwendungsbereichs auf die Anlageberatung
Nach der bis zum 30.10.2012 geltenden Fassung fand § 32b ZPO keine Anwendung, wenn ein Beklagter wegen Verletzung eines Anlageberatungsvertrags auf Schadensersatz in Anspruch genommen wurde. Dies galt auch, wenn der Beklagte sich bei der Beratung auf öffentliche Kapitalmarktinformationen bezogen hatte.58 Gleiches galt für Ansprüche aus einem Anlagevermittlungsvertrag.59 Die Neuregelung von § 32b ZPO dient insbesondere dem Zweck, Klagen gegen Anlageberater und -vermittler in den Anwendungsbereich der Vorschrift einzubeziehen.60
3.3.4.3 Klage allein gegen den Anlageberater
Bei der Anwendung ist zwischen § 32b Abs. 1 Nrn. 1 und 2 ZPO zu unterscheiden. Hierzu hat der BGH ausgeführt:
„Nach der Konzeption des § 32b Abs. 1 ZPO in der Fassung des Gesetzes zur Reform des Kapitalanleger-Musterverfahrensgesetzes und zur Änderung anderer Vorschriften vom 19. Oktober 2012 ist der Anwendungsbereich von Nummer 1 dieses Absatzes von demjenigen gemäß Nummer 2 zu unterscheiden. Nach dieser Neufassung ist eine Zuständigkeit am Sitz des Emittenten, Anbieters oder der Zielgesellschaft im Falle von § 32b Abs. 1 Nr. 2 ZPO nur dann gegeben, wenn einer der (weiteren) Beklagten auch gemäß § 32b Abs. 1 Nr. 1 ZPO in Anspruch genommen wird… Dies setzt gemäß § 32b Abs. 1 Nr. 1 ZPO voraus, dass der Beklagte den Prospekt herausgegeben hat oder zu den Gründern, Initiatoren oder Gestaltern der Gesellschaft gehört, soweit diese das Management bilden oder beherrschen. Daneben kann sich eine Klage gemäß § 32b Abs. 1 Nr. 1 ZPO auch gegen Personen als ‚Hintermänner‘ richten, die hinter der Gesellschaft stehen, auf ihr Geschäftsgebaren oder die Gestaltung des konkreten Anlagemodells besonderen Einfluss ausüben und deshalb Mitverantwortung tragen“.61
Bei einer Klage wegen fehlerhafter Anlageberatung stellt sich die Frage, ob § 32b ZPO auch dann einschlägig ist, wenn sich die Klage allein gegen den Anlageberater richtet. Nach dem Wortlaut der Vorschrift ist § 32b ZPO nur einschlägig, wenn die Klage zugleich „gegen den Emittenten, den Anbieter oder die Zielgesellschaft“ gerichtet wird. Hierzu hat der BGH ausgeführt:
„Entsprechend dieser Zielsetzung ist eine Zuständigkeit nach § 32b Abs. 1 ZPO zwar zu verneinen, wenn mit der Klage ausschließlich Anlageberater, Anlagevermittler oder sonstige Personen wegen der in § 32b Abs. 1 Nr. 2 ZPO aufgeführten Handlungen in Anspruch genommen werden. Eine weitergehende Einschränkung dahin, dass die Zuständigkeit auch bei einer Klage wegen der in § 32b Abs. 1 Nr. 1 ZPO aufgeführten Handlungen nur noch dann zu bejahen ist, wenn der Emittent, der Anbieter oder die Zielgesellschaft zu den Beklagten gehören, stünde hingegen in Widerspruch zum Ziel der Neuregelung.“62
Wird der einzige Beklagte nicht als Prospektverantwortlicher im Sinne des § 32b Abs. 1 Nr. 1 ZPO, sondern wegen Ansprüchen aus Prospekthaftung im weiteren Sinne in Anspruch genommen, ist der ausschließliche Gerichtsstand des § 32b Abs. 1 ZPO nicht eröffnet.63
3.3.4.4 Besonderheiten bei der Anlageberatung
Zu den Voraussetzungen von § 32b Abs. 1 Nr. 2 ZPO hat der BGH weiter ausgeführt:
„Nach § 32b Abs. 1 Nr. 2 ZPO in der seit 1. Dezember 2012 geltenden Fassung gilt der besondere Gerichtsstand zwar auch für Klagen gegen Anlageberater oder -vermittler wegen Verwendung der Kapitalmarktinformation oder wegen Unterlassung der gebotenen Aufklärung darüber, dass die Information falsch oder irreführend ist. Auch nach der Neuregelung ist der Anwendungsbereich der Vorschrift jedoch nur dann eröffnet, wenn ein Bezug zu einer öffentlichen Kapitalmarktinformation besteht (BT-Drucks 17/8799, S. 16). Im Streitfall ist die beabsichtigte Klage gegen die Antragsgegnerin zu 1 nicht auf einen solchen Anspruch gestützt. Aus dem vorgelegten Entwurf der Klageschrift ergibt sich nicht, dass der für die Antragsgegnerin zu 1 tätige Anlageberater bei dem Gespräch mit der Antragstellerin und deren Ehemann die von der Antragstellerin als zumindest irreführend angesehenen Prospektangaben verwendet oder eine diesbezügliche Aufklärungspflicht verletzt hat. Die Antragstellerin macht vielmehr geltend, der Anlageberater habe ihr das im Prospekt beschriebene Risiko eines Totalverlusts verschwiegen und der Prospekt sei ihr erst nach Abgabe der Beitrittserklärung übersandt worden. Darin liegt keine Verwendung von öffentlichen Kapitalmarktinformationen im Sinne von § 32b Abs. 1 Nr. 2 ZPO.“ 64
Voraussetzung für die Anwendbarkeit des § 32b Abs. 1 Nr. 2 ZPO ist danach, dass ein Bezug zwischen dem geltend gemachten Schadensersatzanspruch und einer öffentlichen Kapitalmarktinformation besteht; daran fehlt es, wenn ein Anlageberater oder –vermittler mit der Begründung in Anspruch genommen wird, er habe eine im Prospekt enthaltene zutreffende Information verschwiegen.65
Eine Anwendung von § 32b Abs. 1 Nr. 2 ZPO kommt auch in Betracht, wenn der Kläger vorträgt, ihm sei der Verkaufsprospekt zur Anlage erst nach Erwerb der Anlage übergeben worden:
„Nimmt ein Kläger eine beratende Bank wegen fehlerhafter Anlageberatung auf Schadensersatz in Anspruch, können die Voraussetzungen eines ausschließlichen Gerichtsstands gemäß § 32b Abs. 1 Nr. 2 ZPO erfüllt sein, wenn der Kläger aufgrund eines nach seiner Darstellung fehlerhaften Prospekts beraten wurde, welchen die Bank zur Grundlage ihrer Beratung gemacht hat, auch wenn der Prospekt dem Kläger erst nach dem Vertragsabschluss überlassen wurde.“66
„Nach § 32b Abs. 1 Nr. 2 ZPO reicht es aus, wenn nach dem Klägervortrag eine öffentliche Kapitalmarktinformation verwendet worden ist. In welcher Form dies geschieht, ist sowohl nach dem Wortlaut der Vorschrift als auch nach deren Sinn und Zweck unerheblich. Erforderlich ist lediglich, dass der Berater oder Vermittler eine im Prospekt enthaltene Information an den Interessenten weitergegeben hat. Ob er hierbei ausdrücklich oder konkludent auf den Prospekt Bezug genommen hat, ist hingegen jedenfalls dann unerheblich, wenn diese Information unmittelbar oder mittelbar auf den Prospekt zurückgeht. Letzteres bedarf jedenfalls dann keiner näheren Darlegung durch den Kläger, wenn keine anderen Quellen ersichtlich sind, denen der Berater oder Vermittler diese Information unabhängig vom Prospektinhalt hätte entnehmen können.“67
3.4 Funktionelle Zuständigkeit
Unter den Voraussetzungen des § 95 GVG kann für ein Verfahren wegen fehlerhafter Anlageberatung die Kammer für Handelssachen zuständig sein.68
39 Vgl. aber § 71 Abs. 2 Nr. 3 GVG.
40 § 23 Nr. 1 GVG.
41 § 504 ZPO.
42 § 39 ZPO.
43 § 281 Abs. 1 ZPO.
44 § 72a GVG.
45 § 348a Abs. 1 ZPO.
46 Vgl. BT-Drucks. 18/11437 vom 8.3.2017, S. 46.
47 Zöller/Schultzky, ZPO, 33. Aufl. 2020, § 12, Rn. 8; vgl. Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann, ZPO, 78. Aufl., 2020, Grdz. § 12, Rn. 14 und 25.
48 OLG Köln, Beschluss vom 6.4.2005, 5 W 37/05, Rn. 5, zitiert nach openjur.
49 Zöller/Schultzky, ZPO, 33. Aufl. 2020, § 29, Rn. 25, Stichwort Anlageberatung, Anlagevermittlung; vgl. Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann, ZPO, 78. Aufl., 2020, § 29, Rn. 18.
50 BGH, Beschluss vom 21.7.2020, II ZB 19/19.
51 § 1 Abs. 2 KapMuG mit Regelbeispielen.
52 BGH, Beschluss vom 30.7.2013, X ARZ 320/13, Rn. 10.
53 BGH, Beschluss vom 21.7.2020, II ZB 19/19, Rn. 40.
54 BGH, Beschluss vom 21.7.2020, II ZB 19/19, Rn. 49 und 51.
55 BGH, Beschluss vom 30.10.2008, III ZB 92/07, Rn. 15; OLG Hamm, Beschluss vom 8.4.2013, 32 SA 6/13; OLG München, Beschluss vom 27.6.2013, 34 AR 205/13.
56 BGH, Beschluss vom 30.7.2013, X ARZ 320/13, Rn. 12.
57 OLG Hamm, Beschluss vom 8.4.2013, 32 SA 6/13; OLG München, Beschluss vom 27.6.2013, 34 AR 205/13.
58 BGH, Beschluss vom 30.1.2007, X ARZ 381/06; BGH, Beschluss vom 3.5.2011, X ARZ 101/11, Rn. 15.
59 BGH, Beschluss vom 3.5.2011, X ARZ 101/11, Rn. 15.
60 BGH, Beschluss vom 30.7.2013, X ARZ 320/13, Rn. 26.
61 BGH, Beschluss vom 1.12.2016, X ARZ 180/16, Rn. 11 und 12.
62 BGH, Beschluss vom 30.7.2013, X ARZ 320/13, Rn. 24.
63 BGH, Beschluss vom 1.12.2016, X ARZ 180/16 (Leitsatz).
64 BGH, Beschluss vom 30.7.2013, X ARZ 320/13, Rn. 30 f.
65 BGH, Beschluss vom 8.12.2015, X ARZ 573/15, Rn. 10 f.
66 OLG Hamm, Beschluss vom 16.3.2015, 32 SA 6/15, juris (Leitsatz).
67 BGH, Beschluss vom 8.12.2015, X ARZ 573/15, Rn. 14.
68 Vgl. als Beispiel LG Düsseldorf, 2. Kammer für Handelssachen, Urteil vom 10.4.2014, 32 O 122/12.
4 Zulässigkeit der Klage: Entgegenstehende Rechtskraft
Einige Anleger erhoben nach Abweisung einer ersten Klage wegen derselben Beratungssituation ein zweites Mal Klage, gestützt auf andere Beratungsfehler. Zur Begründung führten sie an, dass nach der BGH-Rechtsprechung69 jede Pflichtverletzung verjährungsrechtlich selbständig zu behandeln sei. Wenn Schadensersatzansprüche wegen bestimmter Pflichtverletzungen verjährt seien, könne der Anleger wegen anderer Pflichtverletzungen gleichwohl mit Erfolg Klage erheben. Nach dem gleichen Prinzip könne der Anleger – sofern er mit einer ersten Klage unterliege – wegen anderer Pflichtverletzungen eine zweite Klage erheben. Diese Argumentation hat der BGH zurückgewiesen:
„Die Rechtskraft einer Entscheidung über einen Schadensersatzanspruch gegen eine Bank wegen eines Fehlers bei der Kapitalanlageberatung steht einer Klage auf Ersatz desselben Schadens wegen eines anderen Beratungsfehlers in demselben Beratungsgespräch entgegen.“70
Zur Begründung führt der BGH aus:
„Der von der Rechtskraft erfasste Streitgegenstand wird durch den Klageantrag, in dem sich die vom Kläger in Anspruch genommene Rechtsfolge konkretisiert, und den Lebenssachverhalt (Anspruchsgrund), aus dem der Kläger die begehrte Rechtsfolge herleitet, bestimmt (§ 253 Abs. 2 Nr. 2 ZPO). Zum Anspruchsgrund sind alle Tatsachen zu rechnen, die bei einer natürlichen, vom Standpunkt der Parteien ausgehenden und den Sachverhalt seinem Wesen nach erfassenden Betrachtung zu dem zur Entscheidung gestellten Tatsachenkomplex gehören, den der Kläger zur Stützung seines Rechtsschutzbegehrens dem Gericht vorträgt… Vom Streitgegenstand werden damit alle materiell-rechtlichen Ansprüche erfasst, die sich im Rahmen des gestellten Antrags aus dem zur Entscheidung unterbreiteten Lebenssachverhalt herleiten lassen. Das gilt unabhängig davon, ob die einzelnen Tatsachen des Lebenssachverhalts von den Parteien vorgetragen worden sind oder nicht, und auch unabhängig davon, ob die Parteien die im Vorprozess nicht vorgetragenen Tatsachen des Lebensvorgangs damals bereits kannten und hätten vortragen können...“71
„Die einer Anlageentscheidung vorausgegangene Beratung stellt, wie auch das Berufungsgericht im Ausgangspunkt zutreffend angenommen hat, bei natürlicher Betrachtungsweise einen einheitlichen Lebensvorgang dar, der nicht in einzelne Aufklärungs- und Beratungspflichtverletzungen, die der Anleger der Bank vorwirft, aufgespalten werden kann…“72
Anders kann es sich verhalten, wenn mehrere Beratungen stattgefunden haben.73
69 Vgl. BGH, Urteil vom 24.3.2011, III ZR 81/10.
70 BGH, Urteil vom 22.10.2013, XI ZR 42/12 (Leitsatz).
71 BGH, Urteil vom 22.10.2013, XI ZR 42/12, Rn. 15.
72 BGH, Urteil vom 22.10.2013, XI ZR 42/12, Rn. 16 und 17.
73 BGH, Urteil vom 24.3.2015, XI ZR 278/14, Rn. 26. Vgl. zum Streitgegenstand, wenn der Kläger Schadensersatzansprüche aus Prospekthaftung im weiteren Sinne, Kapitalanlagebetrug und vorsätzlicher sittenwidriger Schädigung geltend macht, BGH, Urteil vom 21.11.2017, II ZR 180/15.
5 Aktivlegitimation/Abtretung
Der Anleger kann seine Schadensersatzansprüche an einen Dritten abtreten. Hiervon wird nicht selten Gebrauch gemacht, wenn der Anleger vor Gericht als Zeuge aussagen möchte.
5.1 Abtretung eines Freistellungsanspruchs
Wird ein Freistellungsanspruch geltend gemacht, ist eine Abtretung eingeschränkt möglich:
„Zwar ist ein Anspruch auf Befreiung von einer Verbindlichkeit grundsätzlich nicht abtretbar, weil die Leistung an einen anderen als den Freistellungsgläubiger nicht ohne Veränderung des Leistungsinhalts erfolgen könnte. In der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist jedoch anerkannt, dass eine Abtretung an den Gläubiger der Forderung, von der freizustellen ist, möglich ist...“74
5.2 Abtretung an Schutzvereinigung oder Rechtsanwalt
Die Abtretung einer Forderung an eine Vereinigung, die zum Zwecke der Unterstützung geschädigter Kapitalanleger tätig wird, kann wegen fehlender Erlaubnis zur Inkassotätigkeit unzulässig sein75 (vgl. § 2 Abs. 2 Satz 1 RDG). Auch die Abtretung an einen Rechtsanwalt kann problematisch sein.76
5.3 Abtretung an vermögenslose Partei
Wird die Forderung an eine vermögenslose Partei abgetreten, stellt sich ggf. die Frage, ob die Abtretung sittenwidrig ist:
„Hinsichtlich Forderungsabtretungen sowie Prozessführungsermächtigungen und hiervon ausgehenden Verlagerungen von Prozesskostenerstattungsrisiken hat der Bundesgerichtshof Maßstäbe aufgestellt, um eine den genannten Handlungen womöglich anhaftende Sittenwidrigkeit zu beurteilen. Im Ausgangspunkt ist zu berücksichtigen, dass grundsätzlich kein Beklagter Anspruch darauf hat, von einem zahlungskräftigen Kläger verklagt zu werden… Indes dürfen Forderungsabtretungen wie auch Prozessführungsermächtigungen nicht dazu missbraucht werden, den Prozessgegner wie auch den Staat der Möglichkeit zu berauben, ihren Rechtsanspruch auf Erstattung oder Zahlung der Prozesskosten zu verwirklichen… Ein solcher Missbrauch ist grundsätzlich anzunehmen, wenn eine unvermögende Partei zur gerichtlichen Durchsetzung von Ansprüchen vorgeschoben wird und dies bezweckt, das Kostenrisiko zu Lasten der beklagten Partei zu vermindern oder auszuschließen; dies kommt namentlich dann in Betracht, wenn der Zedent bzw. der Rechtsträger einen wesentlich besseren finanziellen Rückhalt als der Zessionar bzw. der zur Prozessführung Ermächtigte hat…“77
5.4 Zurückbehaltungsrecht der Beklagten
Gemäß § 404 BGB kann der Schuldner dem neuen Gläubiger die jeweiligen Einwendungen entgegensetzen, die zur Zeit der Abtretung der Forderung gegen den bisherigen Gläubiger begründet waren. Insbesondere bleibt ein etwaiges Zurückbehaltungsrecht des Schuldners bestehen.78 Dies kann in Anlageberatungsfällen von Bedeutung sein, weil der beratenden Bank regelmäßig ein Zurückbehaltungsrecht zusteht mit der Folge, dass die Zahlung von Schadensersatz an den Anleger Zug um Zug gegen Rückübertragung der Anlage oder der Rechte aus der Beteiligung bzw. einem etwaigen Treuhandvertrag79 zu erfolgen hat. Ein solches Zurückbehaltungsrecht bleibt der Bank nach § 404 BGB auch bei einer Abtretung erhalten.
5.5 Kein Erfordernis der Übertragung der Anlage
Die Wirksamkeit der Abtretung setzt nicht die Übertragung der Beteiligung vom Anleger auf den Kläger voraus, auch wenn die Beteiligung regelmäßig Zug um Zug an die Beklagte zu übertragen ist. Für die Wirksamkeit der Abtretung genügt es, wenn die Schadensersatzansprüche abgetreten werden. Nach der BGH-Rechtsprechung bedarf selbst die Übertragung der in einer Inhaberschuldverschreibung verbrieften Forderung durch Abtretung nach § 398 BGB zu ihrer Wirksamkeit nicht der Übergabe der Wertpapierurkunde:80
„Nach § 398 BGB kann eine Forderung von dem Gläubiger durch Vertrag mit einem anderen auf diesen übertragen werden. Die Abtretung ist grundsätzlich formfrei. Ist über die Schuld eine Urkunde ausgestellt, hat der bisherige Gläubiger diese zwar dem neuen Gläubiger gemäß § 402 BGB auszuliefern; für die Wirksamkeit der Abtretung ist dies aber nicht Voraussetzung.“81
Anders kann es sich verhalten, wenn feststeht, dass der Anleger zu einer Übertragung der Anlage nicht in der Lage ist. Solange aber die Möglichkeit besteht, dass der Verfügungsberechtigte der Übertragung zustimmt, steht das Unvermögen nicht fest.82
74 BGH, Urteil vom 18.10.2012, III ZR 279/11, Rn. 18.
75 Siehe hierzu BGH, Urteil vom 30.10.2012, XI ZR 324/11, und BGH, Urteil vom 11.6.2013, II ZR 245/11.
76 Vgl. LG Frankfurt a.M., Urteil vom 13.3.2019, 2-10 O 81/18.
77 OLG Düsseldorf, Urteil vom 18.2.2015, VI-U (Kart) 3/14, Rn. 63 ff.
78 Palandt/Grüneberg, BGB, 79. Aufl. 2020, § 404 BGB, Rn. 6.
79 Vgl. hierzu BGH, Urteil vom 5.7.2016, XI ZR 254/15, Rn. 22.
80 BGH, Urteil vom 14.5.2013, XI ZR 160/12 (Leitsatz).
81 BGH, Urteil vom 14.5.2013, XI ZR 160/12, Rn. 18.
82 Vgl. BGH, Urteil vom 17.10.2014, V ZR 289/13, Rn. 10.
6 Anspruchsgrundlage
6.1 Positive Vertragsverletzung (§ 280 Abs. 1 BGB)
Wichtigste Anspruchsgrundlage für einen Schadensersatzanspruch wegen fehlerhafter Anlageberatung gegen eine Bank ist § 280 Abs. 1 BGB (PVV nach altem Recht, ggf. c.i.c., §§ 311 Abs. 2, 241 Abs. 2, 280 Abs. 1 BGB). Ansprüche auf Schadensersatz können ggf. neben Ansprüchen auf Rückabwicklung nach einem Widerruf geltend gemacht werden.83
6.2 Deliktische Ansprüche
Neben vertraglichen Ansprüchen kommen andere, namentlich deliktische Ansprüche in Betracht. Doch sind die Anforderungen an eine Haftung nach § 280 Abs. 1 BGB regelmäßig geringer als diejenigen an eine deliktische Haftung. So wird das Verschulden der Bank im Falle einer vertraglichen Pflichtverletzung gemäß § 280 Abs. 1 Satz 2 BGB vermutet. Ist ein Anspruch nach § 280 Abs. 1 BGB festgestellt, bedarf es normalerweise keiner Prüfung deliktischer Ansprüche. Ist ein Anspruch nach § 280 Abs. 1 BGB nicht bewiesen, gilt dies normalerweise erst recht für deliktische Ansprüche. Darüber hinaus sind nach der Rechtsprechung des BGH die aufsichtsrechtlichen Vorschriften vom Grundsatz her keine Schutzgesetze im Sinne von § 823 Abs. 2 BGB.84 Auch dies führt dazu, dass der Schwerpunkt der zivilrechtlichen Prüfung auf § 280 Abs. 1 BGB liegt, nicht auf §§ 823 ff. BGB.
Nur in Ausnahmefällen sind deliktische Ansprüche näher zu prüfen, beispielsweise, wenn eine Klage wegen vorsätzlicher sittenwidriger Schädigung (§ 826 BGB) auch gegen den Mitarbeiter der Bank erhoben wird,85 mit dem kein Anlageberatungsvertrag zustande gekommen ist. Sofern der Anleger Deliktszinsen (§§ 823 ff., 849 BGB) geltend macht, sind ebenfalls deliktische Ansprüche zu prüfen (vgl. das Kapitel Schaden). Bereicherungsrechtliche Ansprüche können z.B. im seltenen Falle einer Sittenwidrigkeit eines Anlagegeschäfts in Betracht kommen.
6.2.1 Vermittlungstätigkeit ohne Erlaubnis
Ein deliktischer Schadensersatzanspruch kann u.U. leichter nachzuweisen sein als ein vertraglicher Anspruch, wenn ein Anlageberater ohne behördliche Erlaubnis tätig sein sollte:
„Nach § 32 Abs. 1 KWG benötigt die Erlaubnis der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht unter anderem, wer im Inland in einem Umfang, der einen in kaufmännischer Weise eingerichteten Geschäftsbetrieb erfordert, Finanzdienstleistungen erbringt. Bei dieser Vorschrift handelt es sich, wie das Berufungsgericht insoweit zutreffend ausgeführt hat, um ein Schutzgesetz im Sinne des § 823 Abs. 2 BGB zu Gunsten des einzelnen Kapitalanlegers…“86
6.2.2 „Churning“
Zu erwähnen ist im Zusammenhang mit deliktischen Ansprüchen der Begriff „Churning“87 („Provisionsschinderei“). Insoweit kommt eine deliktische Haftung nach § 826 BGB (vorsätzliche sittenwidrige Schädigung) in Betracht:
„Unter churning im engeren, hier in Betracht kommenden Sinne mit der möglichen Folge einer Haftung aus § 826 BGB versteht man den durch das Interesse des Kunden nicht gerechtfertigten häufigen Umschlag eines Anlagekontos, durch den der Broker oder der Vermittler oder beide sich zu Lasten der Gewinnchancen des Kunden Provisionseinnahmen verschaffen...“88
Auch in einem solchen Fall ist neben deliktischen Ansprüchen ggf. ein Anspruch nach § 280 Abs. 1 BGB gegeben.
83 BGH, Urteil vom 5.7.2016, XI ZR 254/15, Rn. 20.
84 Vgl. BGH, Urteil vom 17.9.2013, XI ZR 332/12, Rn. 16 und 21.
85 Vgl. zu deliktischen Ansprüchen Bracht in: Schwintowski, Bankrecht, 5. Aufl., Köln 2018, Kap. 19.
86 BGH, Urteil vom 5.12.2013, III ZR 73/12, Rn. 13.
87 Vgl. zur Umschichtung Art. 54 Abs. 11 der Delegierten Verordnung vom 25.4.2016 zur Ergänzung der Richtlinie 2014/65/EU.
88 BGH, Urteil vom 13.7.2004, VI ZR 136/03, Ziff. II.1.a der Entscheidungsgründe.
7 Beratungsvertrag
7.1 Aufsichtsrechtlicher Begriff der Anlageberatung
Der Begriff Anlageberatung ist aufsichtsrechtlich in § 1 Abs. 1a Satz 2 Ziff. 1a KWG und § 2 Abs. 8 Nr. 10 WpHG n.F.89 definiert als
„Abgabe von persönlichen Empfehlungen… an Kunden oder deren Vertreter…, sofern die Empfehlung auf eine Prüfung der persönlichen Umstände des Anlegers gestützt oder als für ihn geeignet dargestellt wird und nicht ausschließlich über Informationsverbreitungskanäle oder für die Öffentlichkeit bekannt gegeben wird…“
Das Gemeinsame Informationsblatt der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht und der Deutschen Bundesbank zum Tatbestand der Anlageberatung (Stand: Februar 2019) führt hierzu aus:
„Um eine Anlageberatung handelt es sich demnach, wenn
eine persönliche Empfehlung abgegeben wird, die sich auf Geschäfte mit bestimmten Finanzinstrumenten bezieht,
die Empfehlung gegenüber Kunden oder deren Vertretern erfolgt,