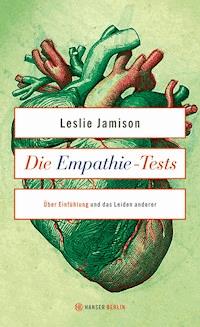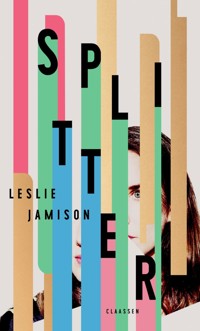17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Hanser Berlin
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
Alle Geschichten von Sucht gleichen einander, doch jeder Süchtige glaubt, auf ganz eigene Weise unglücklich zu sein. Das begriff Leslie Jamison, als sie begann, Treffen der Anonymen Alkoholiker zu besuchen: Sie trank, weil sie ihre Mängel verbergen und um jeden Preis besonders sein wollte. Sie würde erst genesen, wenn sie nicht mehr auf ihrer Originalität beharrte. Mitreißend erzählt sie von ihrer Abhängigkeit und hält sie gegen die populären Mythen trunkener Genialität – über Raymond Carver, Billie Holiday, David Foster Wallace und viele andere. „Die Klarheit“ ist eine persönliche und kollektive Geschichte des Trinkens und des nüchternen Lebens – klug, bewegend aufrichtig und von unverhoffter Schönheit.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1000
Ähnliche
Alle Geschichten von Sucht gleichen einander, doch jeder Süchtige glaubt, auf ganz eigene Weise unglücklich zu sein. Das ist es, was Leslie Jamison begriff, als sie begann, Treffen der Anonymen Alkoholiker zu besuchen: Sie trank, weil sie ihre Mängel verbergen, ihre Bedürfnisse abschütteln und um jeden Preis besonders sein wollte. Und sie würde erst genesen, wenn sie nicht mehr auf ihrer Originalität beharrte. Mitreißend erzählt sie von ihrer Abhängigkeit und hält sie gegen die populären Mythen trunkener Genialität – Geschichten von Raymond Carver, Billie Holiday, David Foster Wallace, Amy Winehouse und vielen anderen.
Hanser Berlin E-Book
Leslie Jamison
DIE KLARHEIT
Alkohol, Rausch und die Geschichten der Genesung
Aus dem Englischen von Kirsten Riesselmann
Hanser Berlin
Für alle, die je mit Abhängigkeit in Berührung gekommen sind
INHALT
I
Faszination
II
Selbstaufgabe
III
Schuld
IV
Mangel
V
Scham
VI
Kapitulation
VII
Durst
VIII
Rückkehr
IX
Geständnis
X
Demut
XI
Refrain
XII
Rettung
XIII
Abrechnung
XIV
Heimkehr
Nachbemerkung der Autorin
Danksagung
Anmerkungen
Quellenverzeichnis
I
FASZINATION
Bei meinem allerersten Schwips war ich knapp dreizehn. Ich musste mich weder übergeben noch hatte ich einen Filmriss. Blamiert habe ich mich auch nicht. Ich fand’s einfach nur toll: wie der Champagner prickelte, wie er mir mit heißen Tannennadeln in den Hals stach. Wir feierten den College-Abschluss meines Bruders, und ich trug ein langes Musselinkleid, in dem ich mich wie ein Kind fühlte, bis ich etwas anderes an mir wahrnahm: etwas Eingeweihtes, Strahlendes. Der ganzen Welt wollte ich zurufen: Warum hat mir denn nie jemand gesagt, dass sich das so gut anfühlt!
Als ich zum ersten Mal im Geheimen trank, war ich fünfzehn. Meine Mutter war auf Reisen. Meine Freundinnen und ich breiteten eine Decke auf dem Wohnzimmerparkett aus und tranken dann, was wir fanden: den Chardonnay, der zwischen Orangensaft und Mayonnaise im Kühlschrank stand. Wir waren ganz aufgekratzt von der gefühlten Grenzüberschreitung.
Zum allerersten Mal high war ich, als ich auf dem Sofa eines mir unbekannten Menschen Gras rauchte, das Poolwasser mir von den Fingern tropfte und der Joint, den ich hielt, ganz feucht wurde in meinem Griff. Der Freund eines Freundes hatte mich zu einer Poolparty eingeladen. Meine Haare rochen nach Chlor und mein Körper zitterte in dem nassen Bikini. Seltsame kleine Tiere erblühten in meinen Ellbogen und unter meinen Achseln, da, wo meine Körperteile aneinander befestigt waren. Ich dachte: Was ist das? Und wie schaffe ich es, dass es genauso bleibt? Wenn ich mich gut fühlte, hieß es für mich immer: Mehr. Noch mal. Für immer.
Als ich zum allerersten Mal zusammen mit einem Jungen trank, auf dem hölzernen Umlauf eines Strandwächterhäuschens, erlaubte ich ihm, die Hände unter mein T-Shirt zu schieben. Flüsternd schwappten dunkle Wellen unter unseren baumelnden Füßen über den Sand. Mein erster richtiger Freund schoss sich gerne ab. Er machte auch gerne seine Katze high. Wir knutschten im Kombi seiner Mutter herum. Einmal kam er zum Essen zu uns nach Hause und war voll auf Speed. »Wie gesprächig er ist!«, meinte meine Oma, überaus angetan. In Disneyland riss er ein Tütchen mit verschrumpelten Pilzhüten auf. Als wir vor dem Big Thunder Moutain Railroad in der Schlange standen, wurde seine Atmung schnell und flach. Er schwitzte sein T-Shirt durch und musste ständig die orangen Kunstfelsen der Kulisse anfassen.
Wenn ich mich festlegen müsste, an welchem Punkt ich wirklich anfing zu trinken, mit welchem allerersten Mal es seinen Anfang nahm, könnte ich sagen: Begonnen hat es mit meinem ersten Filmriss beziehungsweise mit dem ersten Mal, als ich es richtig auf einen Filmriss anlegte, dieses erste Mal, als ich nur das eine wollte: in meinem eigenen Leben nicht anwesend sein. Vielleicht begann es aber auch, als ich mich zum ersten Mal vom Trinken übergeben musste, als ich zum ersten Mal vom Trinken träumte, als ich zum ersten Mal wegen des Trinkens log, als ich zum ersten Mal davon träumte, wie ich wegen des Trinkens log, als das Verlangen so überwältigend war, dass nicht mehr viel von mir nicht damit beschäftigt war, dieses Verlangen entweder zu befriedigen oder dagegen anzugehen.
Vielleicht hat der Beginn meines Trinkens auch weniger mit konkreten Momenten zu tun als mit dem Einschleifen von Verhaltensmustern – das tägliche Trinken. Das begann in Iowa City, wo ich weder dramatisch noch ausgeprägt viel trank, sondern wo der Alkohol eine unausweichliche Begleiterscheinung meines Alltags war. Man konnte sich hier auf so viele verschiedene Arten und an so vielen verschiedenen Orten betrinken: in der in einem großen, verrauchten Wohnmobil untergebrachten Literatenkneipe mit dem ausgestopften Fuchskopf und den kaputten Uhren überall an der Wand; oder in der Dichterkneipe die Straße runter, mit ihren blutarmen Cheeseburgern und der leuchtenden Schlitz-Bier-Reklametafel, einer elektrisch bewegten Landschaft mit gurgelndem Fluss, neongrün grasiger Uferböschung und flackerndem Wasserfall. Ich zerstampfte die Limette in meinem Wodka Tonic, und an dem perfekten Punkt zwischen den ersten beiden und dem dritten, dem dritten und dem vierten und dann zwischen dem vierten und dem fünften Drink meinte ich, mein Leben würde von innen heraus leuchten.
Es fanden Partys statt an einem Ort namens The Farm House, draußen in den Maisfeldern, noch hinter dem Freitagsfischimbiss im Haus der Veteranenlegion. Bei diesen Partys veranstalteten Lyriker Wrestling-Wettkämpfe in einem Planschbecken voller Jell-O, und die Gesichter sahen schön aus im flackernden Schein des Matratzenlagerfeuers. Im Winter war es so kalt, dass man fast daran zugrunde ging. Es gab endlos viele Mitbringpartys, bei denen ältere Schriftsteller mariniertes Grillfleisch und jüngere Schriftsteller Plastikeimerchen voller Hummus dabeihatten. Whisky brachten alle mit, Wein auch. Der Winter zog sich hin; wir tranken weiter. Dann kam der Frühling. Wir tranken weiter.
*
Im Untergeschoss einer Kirchengemeinde auf einem schäbigen Klappstuhl sitzend, fragt man sich immer, wie man anfangen soll. »Bei einem AA-Meeting zu sprechen, das war für mich immer ein Wagnis«, sagte ein gewisser Charlie bei einem Meeting der Anonymen Alkoholiker in Cleveland im Jahr 1959. »Ich wusste, ich konnte es besser als die anderen. Schließlich hatte ich wirklich eine Geschichte zu erzählen. Ich war eloquenter als die anderen. Ich konnte packend erzählen. Ich würde es allen zeigen.« Das Wagnis beschrieb er folgendermaßen: Er wurde gelobt. Er empfand Stolz. Er betrank sich. Und jetzt sprach er vor einer großen Gruppe darüber, was für ein Wagnis es für ihn war, vor einer großen Gruppe zu sprechen. Bei einem Meeting der Anonymen Alkoholiker sprach er über das, was an einem Meeting der Anonymen Alkoholiker riskant war für ihn. Eloquent sprach er über Eloquenz. Er verpackte in eine packende Erzählung, was die Kunst des packenden Erzählens mit ihm gemacht hatte. Er sagte: »Ich glaube, ich habe es satt, mein eigener Held zu sein.« Fünfzehn Jahre zuvor hatte er in einer Phase der Nüchternheit einen Roman über Alkoholismus veröffentlicht, der zum Bestseller wurde. Ein paar Jahre später war er rückfällig geworden. »Ich habe ein Buch geschrieben, das als ›das maßgebliche Porträt eines Alkoholikers‹ bezeichnet wurde«, sagte er vor der Gruppe, »und das hat mir nicht gutgetan.«
Nachdem er fünf Minuten geredet hatte, kam Charlie auf die Idee, vielleicht doch lieber so anzufangen wie die anderen auch. »Ich heiße Charles Jackson«, sagte er also, »und ich bin Alkoholiker.« Er besann sich auf den gängigen Refrain und stellte fest, dass das Gemeinsame, das von allen Geteilte, seine ganz eigene heilsame Qualität haben kann. »Meine Geschichte unterscheidet sich nicht groß von der von anderen«, sagte er. »Es ist die Geschichte eines Menschen, den der Alkohol zum Idioten gemacht hat, immer wieder, jahrein, jahraus, bis schließlich der Tag kam, an dem er begriff, dass er alleine nicht mehr klarkommt.«
Als ich zum allerersten Mal die Geschichte meines Trinkens erzählte, saß ich in einer Runde mit anderen Trinkern, die nicht mehr tranken. Das Bild dieser Szene war ein durchaus bekanntes: Klappstühle aus Plastik, Styroporbecher mit inzwischen lauwarmem Kaffee, ausgetauschte Telefonnummern. Vor dem Meeting hatte ich mir vorgestellt, was wohl im Anschluss passieren würde: Man würde meine Geschichte loben oder die Art und Weise, wie ich sie erzählt hatte, und ich würde das Lob herunterspielen, mit den Schultern zucken und abwiegeln: Na ja, ich bin ja auch Schriftstellerin. Ich hätte das Charlie-Jackson-Problem: Meine Erzählkunst brächte meine Bescheidenheit in Bedrängnis. Im Vorfeld hatte ich mit Karteikarten geübt. Die Karten benutzte ich aber nicht, als ich dann sprach – es sollte ja nicht so aussehen, als hätte ich geübt.
Als ich die Sache mit der Abtreibung hinter mich gebracht hatte, als ich erzählt hatte, wie viel ich getrunken hatte, während ich schwanger war, als ich von der Nacht berichtet hatte, die ich sehr bewusst nicht als Date Rape bezeichne, als ich zu den eingespielten Ritualen der Rekonstruktion eines Filmrisses alles gesagt und die Eckpunkte meines Kummers und meiner Probleme benannt hatte – die mir im Vergleich mit den Problemen der anderen im Raum lange nicht so schlimm erschienen –, als ich also irgendwo in dem unwegsamen Territorium meiner neuen Nüchternheit angekommen war und davon sprach, wie ich mich jetzt ständig entschuldigte und wie ich mit mechanischem Körpereinsatz betete, rief ein alter Mann im Rollstuhl aus der ersten Reihe: »Langweilig!«
Wir kannten ihn alle, diesen alten Mann. Er hatte in den 1970er Jahren bei der Gründung einer schwulen Selbsthilfegruppe in unserer Stadt eine wichtige Rolle gespielt und wurde jetzt von seinem deutlich jüngeren Partner gepflegt, einem Büchernarren mit leiser Stimme, der dem Alten die Windeln wechselte und ihn treuherzig zu den Meetings schob, wo jener dann Obszönitäten von sich gab. »Du dumme Fotze!«, hatte er einmal gerufen. Ein andermal hatte er mich beim Schlussgebet an die Hand genommen und gesagt: »Küss mich, Hure!«
Er war krank, und der Teil seines Bewusstseins, der seine Ausdrucksweise filterte und im Zaum hielt, kam ihm Stück für Stück abhanden. Oft aber klang der Mann auch wie unser kollektives Es, das all das artikulierte, was in den Meetings eigentlich nicht laut gesagt wurde: Das ist mir total egal. Es ist öde. Das habe ich doch alles schon mal gehört. Er war gemein und verbittert, aber er hatte auch einer Menge Menschen das Leben gerettet. Und in diesem Moment war ihm eben langweilig.
Andere rutschten betreten auf ihren Stühlen herum. Die Frau neben mir legte mir die Hand auf den Arm, wie um zu sagen: Mach weiter. Also machte ich weiter, stotternd zwar, mit brennenden Augen und zugeschnürter Kehle. Aber es war dem Mann gelungen, an eine sehr tief liegende Unsicherheit zu rühren: Dass meine Geschichte nicht gut genug sein oder dass ich sie nicht gut genug erzählen könnte, dass ich sogar in meiner Dysfunktion versagte und es mir nicht gelungen war, meine Probleme verrucht, krass oder interessant genug darzustellen, dass die Genesung meine Geschichte flach und blutleer, schlicht unerzählbar werden ließ.
Als ich den Entschluss fasste, ein Buch über meine Genesung zu schreiben, hatte ich Angst, genau deswegen zu scheitern. Ich versuchte, nicht auf den ausgelutschten Klischees der Suchtspirale herumzureiten und die ermüdende formale Struktur sowie die geschmacklose Selbstbeweihräucherung einer Erlösungsgeschichte zu vermeiden: Erst gab es ein Problem, dann verschärfte sich das Problem, dann wurde es wieder besser. Wen sollte das bitte interessieren? Langweilig! Wenn ich Leuten erzählte, dass ich ein Buch über Sucht und Genesung schrieb, sah ich oft, wie sich ein Schleier über ihre Augen legte. Ach so, schienen die Blicke zu sagen, dieses Buch habe ich doch längst gelesen.
Ich wollte ihnen sagen, dass ich auch ein Buch über den glasigen Ausdruck in ihren Augen schrieb, darüber, dass man bei einer Suchtgeschichte manchmal denkt: Diese Geschichte kenne ich doch schon, bevor man sie überhaupt ganz angehört hat. Ich wollte ihnen sagen, dass ich den Versuch unternahm, ein Buch darüber zu schreiben, wie schwer es ist, eine Suchtgeschichte zu erzählen, weil die Geschichte jeder Sucht immer schon erzählt worden ist, eben weil Suchtgeschichten sich unumgänglich wiederholen, weil sie sich allesamt herunterbrechen lassen auf ein und denselben kaputten, auf sich zusammengeschnurrten und immer wieder neu aufbereiteten Kern: Verlangen. Konsum. Wiederholung.
Im Prozess der Genesung stieß ich auf eine Gemeinschaft, die sich genau gegen das wehrte, was mir immer über Geschichten erzählt worden war: dass sie einzigartig sein müssen. In den Selbsthilfegruppen war eine Geschichte sogar dann am hilfreichsten, wenn sie überhaupt nicht einzigartig war, sondern sich als Geschichte begriff, die genauso schon vielfach erlebt worden war und auch immer wieder so erlebt werden würde. Unsere Geschichten waren nicht trotz, sondern eben wegen ihrer Redundanz wertvoll. Originalität war nicht das Ziel, und auch um ästhetische Schönheit ging es nicht.
Als ich mich entschied, ein Buch über Genesung zu schreiben, wollte ich nichts Einzigartiges schreiben. Nichts an der Genesung war schließlich außergewöhnlich oder einzigartig gewesen. Ich musste mich des Plurals in der ersten Person bedienen, denn Genesung hat mit dem Eintauchen ins Leben anderer zu tun. Zur ersten Person Plural zu kommen bedeutete, Zeit in Archiven und mit Interviews zu verbringen. So würde ich ein Buch schreiben können, das in gewisser Weise wie ein Meeting funktionierte – das also meine Geschichte in eine Reihe stellte mit den Geschichten anderer. Ich komme alleine nicht mehr klar. Was schon vor mir gesagt worden war. Aber ich wollte es erneut sagen. Ich wollte ein Buch schreiben, das ehrlich ist, das sagt, wie hart, anstrengend und glücklich machend es ist, wenn man lernt, das Leben so zu führen – in der Gruppe, als Chor und ohne die betäubende Zurückgezogenheit im Rausch. Ich wollte über Freiheit schreiben, und zwar ohne ironische Anführungszeichen und Schönfärberei. Ich wollte sagen, dass eine Geschichte nicht deshalb erzählenswert ist, weil sie sich von allen anderen abhebt, und herausfinden, warum wir diesen Anspruch ans Erzählen für so unhintergehbar halten beziehungsweise warum zumindest ich das immer getan habe.
Wenn Suchtgeschichten sich von der Dunkelheit nähren, von der hypnotisierenden Spirale einer fortgesetzten, sich ausweitenden Krise, dann erscheint die Genesung oft als narrative Flaute, als glanzloses Territorium des Wohlergehens, als fader Nachklapp einer fesselnden Feuersbrunst. Dagegen war auch ich nicht immun: Geschichten über ein Leben, das in Trümmern liegt, hatten mich schon immer fasziniert. Aber ich wollte wissen, ob Geschichten über Genesung und Heilung nicht ebenso spannend sein konnten wie Geschichten über Zusammenbruch und Zerrüttung. Der Glaube an diese Möglichkeit war mir wichtig.
*
Kurz nach meinem einundzwanzigsten Geburtstag zog ich nach Iowa City. Den Umzug machte ich mit einem kleinen schwarzen Toyota, der Fernseher stand auf dem Beifahrersitz, und ich trug einen Wintermantel, der noch nicht mal dick genug war, um mich den Herbst über warm zu halten. Ich wohnte in einem weißen, mit Holzschindeln verkleideten Haus in der Dodge Street, Ecke Burlington Street und geriet sofort in den Kreislauf: Gartenfeste unter mit weißen Lichterketten umwickelten Ästen, Einmachgläser voller Rotwein, ortstypische Bratwurst vom Grill. In den Wiesen flirrten die Stechmücken, und Glühwürmchen blinkten wie die Augen eines scheuen Gottes. Das klingt jetzt möglicherweise albern. Aber es war magisch.
Zehn – zwanzig, dreißig – Jahre ältere Schriftsteller erzählten von ihren beeindruckenden Karrieren, ihren früheren Nebenjobs und ihren beendeten Ehen. Ich dagegen stellte fest, dass ich noch nicht allzu viel zu erzählen hatte. Ich war ja hierhergekommen, um zu leben. Hier würde ich auf Partys Sachen machen, über die ich später, woanders, auf Partys erzählen könnte. Ich bebte vor Aufregung über diese vielversprechende Aussicht, und ich war nervös. Ich trank ohne viel Aufhebens, ich trank schnell. Meine Zähne wurden rotfleckig vom Shiraz.
Ich war hier, um am Iowa Writers’ Workshop meinen Master in Kreativem Schreiben zu machen, einem Studiengang, der vor Geschichtsträchtigkeit nur so strotzte. Ich hatte den Eindruck, als verlangte der Studiengang in einem fort Beweise, dass man es verdient hatte, hier zu sein, und ich war mir nicht sicher, ob das in meinem Fall zutraf. Alle anderen Unis, an denen ich mich beworben hatte, hatten mich abgelehnt.
Eines Abends ging ich zu einer Mitbringparty in eine mit Teppichboden ausgelegte Souterrainwohnung in einem Backsteinhaus, und als ich ankam, saßen alle schon im Kreis und spielten ein Spiel: Jeder sollte seine beste Geschichte erzählen, seine definitivallerbeste. An die Geschichten der anderen kann ich mich nicht erinnern. Möglicherweise habe ich auch gar nicht zugehört, weil ich viel zu viel Angst davor hatte, dass das, was ich sagen würde, nicht gut ankäme. Als die Reihe schließlich an mir war, gab ich die einzige Anekdote von mir zum Besten, die bisher immer alle zum Lachen gebracht hatte. Sie handelte von meiner Reise in ein Dorf in Costa Rica, die ich mit fünfzehn Jahren unternommen hatte, weil ich dort einen freiwilligen Hilfsdienst leisten wollte. Eines Tages war mir auf einer Schotterpiste ein Wildpferd über den Weg gelaufen, und als ich meiner Gastfamilie von der Begegnung erzählen wollte, verwechselte ich die Wörter für caballo und caballero. Als ich die Besorgnis auf ihren Gesichtern sah, versuchte ich ihnen unbeholfen zu versichern, dass ich Pferde sehr mochte – erzählte ihnen aber eigentlich, dass ich große Stücke auf das Reiten von Herren hielt. An diesem Punkt der Geschichte stand ich in dem teppichbelegten Keller auf und stellte pantomimisch das Reiten nach, so wie ich es vor Jahren für meine Gastfamilie getan hatte. Ich bekam Lacher. Ein paar. Ich fühlte mich wie eine überambitionierte Scharadespielerin. Schweigend setzte ich mich wieder in den Schneidersitz.
Der Ablauf dieses Kellerspiels glich der Struktur des Studiengangs bis aufs Haar: Jeden Dienstagnachmittag kamen wir in Seminargröße zu einem Arbeitstreffen zusammen, um uns gegenseitig für unsere Geschichten zu kritisieren. Die Diskussionen fanden in einem alten, beigefarbenen, mit dunkelgrünen Zierleisten besetzten Holzgebäude am Fluss statt. Wenn wir uns vor dem Seminar unter den rotblättrigen Oktoberbäumen auf der Veranda versammelten, rauchte ich Nelkenzigaretten und lauschte ihrem süßen Knistern. Jemand hatte mir mal erzählt, in Nelkenzigaretten befänden sich kleine Glasstückchen, und ich stellte mir immer vor, wie in meinen verrußten Lungenflügeln Scherben glitzerten.
Kopien des Textes, der in der jeweiligen Woche besprochen wurde, lagen in Stapeln auf einem Holzregal – und es gab immer mehr als genug Kopien für alle Leute im Seminar. Interessierten sich die Kommilitonen für deine Arbeit, waren irgendwann alle Kopien deiner Geschichte weg. Dann warst du vergriffen. Andernfalls warst du das eben nicht. So oder so: Du saßt dann eine Stunde lang an einem runden Tisch und hörtest zwölf anderen dabei zu, wie sie die Vorzüge und Schwächen des von dir Geschriebenen beleuchteten. Im Anschluss wurde von dir erwartet, mit ebenjenen Leuten einen trinken zu gehen.
Die meisten Tage in Iowa ähnelten also einer Prüfung, einer irgendwie gearteten Version dieser Geschichtenwettbewerbsparty. Manchmal bestand ich diese Prüfung – manchmal fiel ich durch. Manchmal ging ich high hin und hatte dann Angst, dumm zu klingen, obwohl es natürlich Sinn und Zweck des Drogennehmens ist, keine Angst mehr davor zu haben, dumm zu klingen. Manchmal ging ich am Ende eines Abends auch nach Hause und ritzte mich.
Das Ritzen hatte ich mir während der Highschool-Zeit zur Gewohnheit gemacht. Mein erster Freund hatte sich geritzt, der, der in Disneyland genug Pilze intus hatte, um sich vor dem Wilden Westen zu fürchten. Er hatte seine Gründe gehabt, seine zurückliegenden Traumata. Anfangs machte ich mir vor, dass ich es ihm gleichtat, um ihm näher zu sein. Aber irgendwann musste ich mir eingestehen, dass ich mich aus meinen ganz eigenen Beweggründen zum Ritzen hingezogen fühlte. Ich konnte mir damit die Unzulänglichkeit in die Haut schneiden, dieses Gefühl, für das ich nie die richtigen Worte fand; das Gefühl einer inneren Verletztheit, das so vage war und immer überschattet vom Glauben an seine Unbegründetheit, dass die konkrete Klarheit einer Blut zutage fördernden Klinge ihren ganz eigenen Reiz entfalten konnte. Auf diesen Schmerz durfte ich Anspruch erheben, denn er war körperlich und unbestreitbar, auch wenn ich mich immer dafür geschämt habe, dass ich ihn vorsätzlich herbeiführte.
Ich bin ein schüchternes Kind gewesen und hatte immer Angst, das Falsche zu sagen: Ich hatte Angst vor der beliebten Felicity, die mich in der achten Klasse bei den Schließfächern massiv bedrängte und wissen wollte, warum ich mir nicht die Beine rasierte; Angst vor den Mädchen, die in der Umkleide die Köpfe zusammensteckten und mich dann fragten, warum ich eigentlich kein Deo benutzte; Angst sogar vor den netteren Mädchen in meiner Cross-Country-Mannschaft, die wissen wollten, warum ich nie ein Wort sagte; Angst vor den vielleicht einmal im Monat stattfindenden Abendessen, bei denen auch mein Vater anwesend war und ich nie so recht wusste, was ich sagen sollte, weswegen ich dann oft etwas Miesepetriges oder Zickiges von mir gab, weil ich damit am ehesten seine Aufmerksamkeit bekam. Das Ritzen war eine Möglichkeit, etwas zu tun. Als mir mein Highschool-Freund mitteilte, er sei der Meinung, dass wir uns trennen sollten, fühlte ich mich so machtlos und verraten, dass ich einen Stapel Plastiktassen mit solcher Wucht gegen meine Zimmerwand warf, dass sie in tausend Stücke zersplitterten. Diese Bruchstücke zog ich mir dann so lange über den linken Fußknöchel, bis eine schraffierte Leiter aus blutigen Schnitten entstanden war.
Ich erschaudere, wenn ich auf die theatralische Inszenierung meiner existenziellen Ängste zurückblicke, aber ich empfinde auch eine gewisse Zärtlichkeit gegenüber diesem Mädchen, das einen Ausdruck finden wollte für die Größe seiner Gefühle und sich dafür nahm, was gerade zur Hand war: Plastiktassen und jene Form der Selbstverletzung, die sie sich abgeguckt hatte bei demjenigen, der sie gerade verließ. Im südkalifornischen Sommer langärmelige Shirts zu tragen, damit unsere Eltern die Schnitte auf unseren Armen nicht sahen, und die Pflaster an den Knöcheln mit Rasurverletzungen zu erklären war eine Form der Verschworenheit gewesen zwischen mir und ihm.
Meine Art, mit dieser chronischen Schüchternheit umzugehen, die sich wie ein ständiges Versagen anfühlte, bestand also im Ritzen und im Schreiben. In Iowa wurden meine Kurzgeschichten immer als »figurenzentriert« bezeichnet, denn sie hatten nie eine Handlung. Ich aber traute meinen Figuren nicht über den Weg. Sie waren so passiv. Sie waren krank; sie mussten körperliche Attacken erdulden; ihre Hunde hatten Herzwürmer. Sie waren entweder vollkommen künstlich – oder sie waren wie ich. Sie waren grausam und wurden grausam behandelt. Ich schickte sie ins Leiden, weil ich mir sicher war, dass nur Leiden gleichzusetzen war mit Tiefe, und Tiefe war es, die ich vor allen Dingen anstrebte. Wie eine wärmegesteuerte Rakete folgte ich in meiner Arbeit immer nur dem Schmerzhaften. Schon als ich noch ein kleines Mädchen war, waren meine Prinzessinnen häufiger dem Feueratem eines Drachen zum Opfer gefallen, als dass sie geheiratet hatten. In der zehnten Klasse sollte ich mal einen Text schreiben über das Bild eines Mitschülers, einen abstrakten rotvioletten Wirbel, und ich schrieb eine Geschichte über ein Mädchen im Rollstuhl, das bei einem Wohnungsbrand ums Leben kam.
In jenem ersten Jahr in Iowa wohnte ich bei einer Journalistin, die in ihren Dreißigern war und seit Jahren Artikel über die New Yorker Kunstszene schrieb. Sie machte Brathühnchen gefüllt mit ganzen – heißen, matschigen, sauren – Zitronen. Zitronen im Essen wollten mir unabweisbar erwachsen erscheinen, sie waren ein Zeichen dafür, eine gewisse Schwelle übertreten zu haben. Mittwochabends fuhren wir immer raus zu einer großen Scheune westlich der Stadt, wo die Landwirtschaftsauktion stattfand – Traktoren, Vieh und Haushaltsauflösungen, alte LPs, alte Schwerter und alte Cola-Dosen, Ramsch und Schätze. Man konnte Schmalzgebäck kaufen und den Auktionären dabei zusehen, wie sie auf ihren riesigen Hochstühlen durch die Gänge fuhren und ihre unverständliche Stakkato-Sprache sprachen: wirsindbeivierfünfzig-werbietetfünf-fünfvondahinten. Wieder zurück, schwitzten wir in unserer Küche, während wir zerlassenen Ziegenkäse und gezupftes Basilikum mit Couscous vermengten und die Mischung dann löffelweise in gebratene Kürbisblüten füllten. Der Geruch von bratölblasiger Gemüsehaut zog in alle Ecken. So waren die Tage in dieser Zeit: feuchtschwül und intensiv. Ich dachte, ich würde erwachsen, wenn ich Lebensmittel sautierte.
In manchen Nächten ließ mich eine enorme innere Unruhe nicht einschlafen, dann fuhr ich raus aus der Stadt, vierzig Meilen auf der Interstate 80 nach Osten, zur größten Lkw-Raststätte der Welt. Dort gab es ein fünfzehn Meter langes Buffet und Duschen für die Trucker, sogar einen Zahnarzt und eine Kapelle hatten sie. Ich schrieb meine Notizbücher mit figurenzentrierten Dialogen voll und trank becherweise schwarzen Kaffee. Auf dem Kaffee schwamm ein Film aus lilablassblauen Fettaugen. Um drei Uhr morgens bestellte ich Apfelkrapfen mit Vanilleeis und leckte die Schüssel mit der Zunge aus, um mich herum meilenweit nur in Dunkelheit liegende Maisfelder.
Es machte den Eindruck, als tränken in Iowa City einfach alle. Auch wenn vielleicht niemand immer trank, so trank doch zu jedem denkbaren Zeitpunkt gerade irgendwer. Wenn ich nicht pantomimisch den Ritt auf einem Cowboy nachstellte, um mir den Sitzplatz auf einem Teppich zu verdienen, verbrachte ich meine Abende balancierend auf den lederbezogenen Barhockern der Schriftstellerkneipen der Market Street, im George’s und im Foxhead. »Schriftstellerkneipe« war hier kein exklusiver Begriff. Tatsächlich konnte jede Kneipe, in der Schriftsteller tranken, eine Schriftstellerkneipe sein: The Deadwood, The Dublin Underground, The Mill, The Hilltop, The Vine, Mickey’s, The Airliner, diese eine Bar mit der Außenterrasse in der Fußgängerzone, diese andere Bar mit der Außenterrasse in der Fußgängerzone und diese Bar mit der Außenterrasse in der Parallelstraße zur Fußgängerzone.
Das Foxhead war die schriftstellermäßigste Kneipe von allen, und auch die verrauchteste. Die Frischluftzufuhr bestand lediglich aus einem Loch, in das irgendjemand einen Ventilator gesteckt hatte. Das Frauenklo war komplett zugeschmiert mit Eddingsprüchen über die Männer am Institut: Dieser und jener vögelte mit jeder, von diesem und jenem wurde frau definitiv verarscht. Manche der Jungs bezeichneten mich als gerade nicht mehr strafbar, weil ich noch so jung war, und ich frage mich, ob diese Formulierung wohl über einem der Pissoirs im Männerklo zu finden war. Ich hoffte es. Jemand zu sein, der schwarzen Eddingtratsch hervorrief, wollte mir scheinen wie das wahre Leben. Auch als es in Iowa kälter wurde, zog ich fürs Foxhead immer meine billigste Jacke an, weil ich nicht wollte, dass meine anderen Jacken nach Rauch stanken. Meine billigste Jacke war aus dünnem, knielangem schwarzem Veloursleder und hatte einen derart großen Kunstpelzkragen, dass ich mich darin, wenn auch zitternd und mit vor der Brust verschränkten Armen, wohlig versenkt fühlte. Jahre später las ich von einem Studenten, der in Ames betrunken im Schnee gestorben war. Man fand seine Leiche in einem alten Getreidespeicher am Fuß einer Treppe. Ich dachte damals nicht an den Tod im Schnee. Ich trank, bis ich die Kälte nicht mehr spürte. Wenn die Kneipen zumachten, trank ich in den frostig kalten Buden irgendwelcher Jungs weiter, die versuchten, Heizkosten zu sparen.
Eines Abends landete ich in der frostig kalten Bude von einem, den ich mochte. Beziehungsweise von dem ich annahm, dass er mich vielleicht mochte – so leicht ließ sich das für mich nicht unterscheiden. Möglicherweise spielte Ersteres auch keine große Rolle. Wir waren zu mehreren in seiner Wohnung, und irgendjemand hatte ein kleines Tütchen Koks dabei. Es war das erste Mal, dass ich Koks zu Gesicht bekam, und mir war, als träte ich in einen Kinofilm. Auf der Highschool hatte ich immer geglaubt, alle anderen Mädchen koksten, seit sie Kleinkinder waren. Die beliebte Felicity mit ihren glattrasierten Beinen: Ich war mir sicher, dass sie schon seit ewigen Zeiten kokste, während ich im Kino in ab 13 Jahren freigegebenen Filmen Diet Coke trank und Wochen dafür brauchte, mir mal ein knöchellanges blaues Spitzenkleid anzuziehen.
In Wahrheit wusste ich noch nicht mal, wie man es genau machte, dieses Koksen. Ich wusste, dass man das Zeug schniefte, aber ich wusste nicht, wie das aussah. Ich versuchte, mich an jede einzelne Filmszene zu erinnern, die ich je gesehen hatte. Entsprachen sie der Realität? War das, was dieses Mädchen in Eiskalte Engel tat, als sie aus ihrem geheimen Versteck im silbernen Kruzifix eine Prise nahm, die Wirklichkeit? Ich wollte diesem Jungen nicht sagen, dass ich zum ersten Mal kokste. Ich wollte schon so oft gekokst haben, dass ich es nicht mal mehr zählen konnte. Stattdessen aber musste ich freundlich daran erinnert werden, doch den Strohhalm zum Ziehen zu benutzen.
»Ich komme mir vor, als ob ich dich zu was Schlechtem verleite«, sagte der Typ. Er war 24, tat aber so, als ob die 3 Jahre Altersunterschied zwischen uns eine tiefe Schlucht wären. Was sie auch waren. Ich wollte sagen: Dann verleite mich doch! Ich trug eine strahlend weiße Hose mit einer großen silbernen Gürtelschnalle. Vor dem Sofatisch dieses Jungen kniend, zog ich mir laut schniefend eine mit einer Kreditkarte (die ziemlich wahrscheinlich stark im Minus war) abgeteilte Line in die Nase.
Dass ich dieses eisige Aufwallen grandios fand, musste ich ganz sicher nicht heucheln. Ich liebte das Gefühl, richtig viel zu sagen zu haben. Die Frau, die das Koks dabeigehabt hatte, war weg. Alle waren weg. Wir konnten bis zur Morgendämmerung reden. Ich bildete mir ein, dass er sagte: Ich habe mich schon immer gefragt, was du so denkst. Eigentlich waren es ja immer die anderen, die wahrgenommen wurden, die Felicitys dieser Welt, aber jetzt legte dieser Typ hier Blood on the Tracks auf den Plattenspieler, und Bob Dylans kratzige Stimme erfüllte das kalte Zimmer, das Koks lud mein schnell schlagendes Herzlein auf, und endlich war auch ich mal dran. Die eisig kalte Woge glaubte an mich und daran, was aus dieser Nacht noch werden konnte. Ich hatte in meinem Leben erst drei Jungs geküsst. Jedes Mal hatte ich mir gleich eine gemeinsame Zukunft zusammenfantasiert. Die stellte ich mir jetzt auch mit diesem Typen vor. Ihm hatte ich davon noch nichts gesagt, aber das würde ich vielleicht noch. Vielleicht würde ich es ihm sagen, wenn vor seinem Erkerfenster die Morgendämmerung über dem Park anbrach.
»Wer trägt schon weiße Hosen?«, fragte er mich. »Klar, ich sehe die auch manchmal, aber ich konnte mir echt nicht vorstellen, dass die jemand anzieht.«
Ich blieb auf seinem Sofa sitzen, Stunde um Stunde, und wartete darauf, dass er mich küsste. Irgendwann fragte ich ihn: »Willst du mich nicht küssen?«, und meinte damit: Willst du nicht versuchen, mit mir zu schlafen?, denn ich hatte genug Koks und Wodka intus, um diese Frage laut auszusprechen und das dünne Häutchen abzuschälen, das sich noch zwischen der Welt und meinem Bedürfnis befand, von dieser Welt Bestätigung zu bekommen.
Die Antwort lautete nein. Er würde in dieser Nacht nicht versuchen, mit mir zu schlafen. Am nächsten kam er diesem Versuch, als er bei meinem Aufbruch zu mir sagte: »Hey, nicht jede kann es bringen eine weiße Hose zu tragen.« Es klang wie ein Trostpreis.
Als ich ging, küsste er mich in der Tür. »Wolltest du das?«, fragte er, und in meiner Kehle stieg ein salziges, anschwellendes Schluchzen auf. Ich war zwar betrunken, aber nicht betrunken genug. Die größte Demütigung wäre gewesen, zu begehren, aber nicht begehrt zu werden, und dabei noch gesehenzu werden. Und so verbot ich mir, vor ihm zu heulen. Das tat ich dann auf dem Nachhauseweg, als ich um vier Uhr morgens durch die Kälte lief und meine weißen Hosenbeine wie zwei längliche Scheinwerfer in der Dunkelheit leuchteten.
Als ich schließlich zu Hause war, stolperte ich auf der Treppe nach oben und fiel mit dem Gesicht voran so unglücklich hin, dass am nächsten Tag ein großer blauer Fleck auf meinem Schienbein prangte. In jener Nacht wollte ich als frisch Verschmähte wissen, was er in mir gesehen hatte, als er mich abwies. Im Spiegel sah ich eine rotäugige Frau, die vielleicht geweint, vielleicht aber auch Allergien hatte. Der ein bisschen weißes Pulver unter der Nase klebte. Die das Pulver mit der Fingerspitze aufnahm und es sich in den Gaumen rieb. Die im Kino gesehen hatte, dass man das so macht. Da war sie sich sicher.
*
Wir waren nicht die ersten Menschen, die sich in Iowa betrunken hatten. Das war uns bewusst. Die Legenden vom Trinken in Iowa City verliefen wie unterirdische Wasseradern unter dem Alkoholkonsum, den wir uns leisteten. In traumähnlichen Mythen über alkoholbedingtes Fehlverhalten traten diese Wasser hier und da an die Oberfläche: Raymond Carver und John Cheever, wie sie in den frühesten Morgenstunden mit quietschenden Reifen auf Supermarktparkplätze fuhren, um ihre Alkoholvorräte aufzufüllen; John Berryman, der in der Dubuque Street anschreiben ließ und bis zum Einbruch der Dämmerung über Walt Whitman herzog, während er Schach spielte und seine Läufer nicht schützte; Denis Johnson, der sich im The Vine betrank und währenddessen Short Storys über das Sichbetrinken im The Vine schrieb. Auch wir betranken uns im The Vine, obwohl sich die Kneipe jetzt in einem anderen Haus in einer anderen Straße befand. Aber auch das war uns bewusst: wie unpräzise wir die alten Geschichten besetzten, wie ausschnitthaft oder immer nur unvollständig wir sie nachstellten.
Mein Nachdenken über Iowa verlief oft in dieser Wir-Form: Wir gingen da was trinken. Wir gingen dort was trinken. In gewisser Weise tranken wir mit denjenigen, die hier nach uns trinken würden, genauso wie mit denjenigen, die schon vor uns hier getrunken hatten. In einem von Denis Johnsons Gedichten geht es um einen »armen Sterblichen«, der »in jene Schlucht gestolpert« war, »in der die gescheiterten Götter sich betrinken«.
Als Cheever nach Iowa kam, um hier zu lehren, war er dankbar für diese Schlucht. Jetzt hatte er einen Ort, an dem er trinken konnte, ohne dass seine Familie sich darum scherte, warum er sich zugrunde richtete. Zu Hause hatte er seine Flaschen unter dem Autositz versteckt und seinen Eistee mit Gin versetzt. In Iowa musste er keine Fassade mehr wahren. Carver fuhr ihn jeden Morgen zum Getränkemarkt – der öffnete um neun, also fuhren sie um Viertel vor neun los –, und Cheever machte die Autotür schon auf, bevor der Wagen gänzlich zum Stehen gekommen war. Carver sagte über diese Freundschaft: »Wir zwei haben zusammen nichts anderes getan, als zu trinken.«
Das waren so die Mythen, die man in Iowa vererbt bekam. Sie hingen dicht in der Luft. Richard Yates verbrachte seine verkaterten Vormittage in einer Sitznische im Airliner, wo er hartgekochte Eier aß und Barbra Streisand aus der Jukebox hörte. Als Yates mal wieder eine schwere Zeit durchmachte, bot ihm sein Student Andre Dubus an, ihm seine Frau auszuborgen. Yates ging dafür mit Dubus einen trinken, als sich dessen erster Roman nicht verkaufte. Ich ging mit meiner besten Freundin einen trinken, als sich deren erster Roman nicht verkaufte – und zwar im Deadwood, zur Angry Hour, die noch vor der Happy Hour kam und noch manifestere Preisnachlässe bot. Sosehr ich mich bemühte, ich wusste nicht, was ich sagen sollte, und fragte mich, ob ich jemals einen Roman zu Ende schreiben und für wie viel Geld ich ihn dann verkaufen würde.
In seinem 1913 veröffentlichten Roman König Alkohol beschrieb Jack London zwei unterschiedliche Gruppen von Trinkern: Da sind zum einen diejenigen, die durch die Gosse wanken und von »blauen Mäusen und rosa Elefanten« halluzinieren. Und dann gibt es diejenigen, denen das »weiße Licht des Alkohols« Zugang zu ernüchternden Wahrheiten verschafft hat, nämlich den »gnadenlosen, gespenstischen Syllogismen der Weißen Logik«.
Die erste Sorte Trinker hat einen vom Alkohol verheerten Geist, ein Gehirn, das »von dumpfen Maden leer gefressen ist«. Die Wahrnehmung des zweiten Trinkertypus dagegen ist geschärft: Er sieht klarer als ein gewöhnlicher Mensch. »Er durchschaut alle Illusionen … Gut ist schlecht, Wahrheit ist ein Betrug, und das Leben ein Witz … Ehefrau, Kinder und Freunde werden im klaren, weißen Licht seiner Logik als Hochstapler und Betrüger entlarvt. Er durchschaut sie, und alles, was er sieht, ist ihre Schwäche, ihre Dürftigkeit, ihre Schäbigkeit, ihre Jämmerlichkeit.« Dieser »fantasiebegabte« Trinkertyp trägt seine Hellsichtigkeit gleichermaßen als Gabe wie als Fluch. Der Alkohol gewährt ihm zwar Erkenntnis, verlangt aber auch seinen Preis dafür, nämlich »ein plötzliches Verschütten oder ein allmähliches Versickern«. Die Traurigkeit des Trinkens bezeichnete Jack London als »kosmische Traurigkeit«, sie war für ihn keine kleine Kümmernis, sondern überwältigend groß. In dem alten britischen Volkslied, in dem John Barleycorn alias König Alkohol erstmalig in Erscheinung trat, ist er die Personifizierung des Branntweins selbst – ein Geist, der von Trinkern angegangen wird, von vom Alkohol zerrütteten Männern, die Rache üben wollen für das, was er ihnen angetan hat. In Jack Londons Roman ist der Alkohol eher eine sadistische Mafiafee, die das herbe Geschenk ernüchternder Weisheit verteilt. Den Schriftstellerlegenden von Iowa City, die ihre langen torkelnden Schatten über unsere mit Schnitzereien verzierten Sitzecken in diversen Kneipen warfen, hatte König Alkohol ganz sicher einen Besuch abgestattet.
Carvers Schatten war der betrunkenste von allen. Seine Storys waren so schmerzhaft und präzise wie sorgsam abgekaute Fingernägel, sie steckten voller Schweigen und Whisky, voller Nur-noch-einen- und Die-Nächste-geht-auf-mich-Runden. Seine Figuren betrogen und wurden betrogen. Sie machten sich gegenseitig betrunken und schleiften dann den bewusstlosen Körper des jeweils anderen hinaus auf die Veranda. Leute wurden verprügelt, und das war keine große Sache. Eine Vitamin-Verkäuferin brach sich betrunken den Finger und wachte dann mit einem so schlimmen Kater auf, dass es sich anfühlte, »als ob ihr jemand Drähte ins Gehirn bohrte«.
Die Geschichten, die ich über Carvers Leben gehört hatte, ließen das Bild eines Wüterichs entstehen, der ausschließlich von Alkohol und Rauchwaren lebte: Mahlzeiten ließ er unbeendet stehen, denn den ganzen Zucker, den er brauchte, bezog er aus seinem Schnaps. Aus Restaurants marschierte er hinaus, ohne bezahlt zu haben, und mit seinen Seminargruppen am Institut für Englische Literatur zog er ins Hinterzimmer von The Mill um, einer seiner Lieblingskneipen. »Man kann einer Horde Schriftsteller doch nicht das Rauchen verbieten«, meinte er mit Nachdruck, als die Institutsleitung genau das tun wollte. Einmal ließ er nach einem heftigen nächtlichen Besäufnis einen Unbekannten in sein Hotelzimmer. Der junge Mann zog sich bis auf die Leopardenmusterunterhose aus und holte eine Dose Vaseline heraus. Ein andermal tauchte Carver, ohne eingeladen zu sein, mit einer Flasche Bourbon im Haus eines Kollegen auf und verkündete: »Und jetzt erzählen wir uns unsere Lebensgeschichten.«
Ich stellte mir Carver als Meister des überdrehten Quatschs und der flotten Dreier, der Gelegenheitsdiebstähle und der Verführungskünste vor. Ich sah vor mir, wie die Asche unbemerkt von seiner Zigarette fiel, während er tief versunken an seiner Schreibmaschine saß und auf dem Kometenschweif eines Rausches bis zu dessen unbarmherziger Wahrheit ritt. Ganz gleich, an welche psychischen Abgründe er in seinen langen Phasen der Trunkenheit gekommen war, welche Leere er von diesen Steilkanten aus erblickt haben mochte: Ich hatte ein klares Bild vor Augen, wie er die damit verbundene Verzweiflung gewandt in die leisen Seitensprünge und bedeutungsschwangeren Pausen seiner Prosa schmuggelte. Einer von Carvers Freunden drückte es so aus: »Ray war unser Dylan Thomas, denke ich, denn er stand für den – Mut, der dazugehört, in jede nur denkbare Dunkelheit einzutreten und zu überleben.«
Bei der Formulierung jede nur denkbare Dunkelheit dachte ich damals automatisch an Raymond Carver, Dylan Thomas, Jack London und John Cheever, diese weißen Schreiberlinge und ihre episch dimensionierten Probleme. Wenn ich an Sucht dachte, dachte ich bestimmt nicht an Billie Holiday, die ein ganzes Jahr in West Virginia im Gefängnis saß und später in einem New Yorker Krankenhaus in Midtown Manhattan mit Handschellen an ihr Totenbett gefesselt starb. Auch die älteren weißen Trinker, die Armeeveteranen und Farmer, die jeden Morgen in den Nicht-Schriftstellerkneipen am Rande unserer Maisfelder zusammenkamen, hatte ich nicht auf dem Schirm. Für sie war der Rausch sicherlich kein mythischer Brennstoff, sondern eine tägliche, betäubende Entlastung, und sie verarbeiteten ihre Saufgelage auch nicht erzählerisch als Zusammenstöße mit existenziellen Erkenntnissen. Ich war damals viel zu beschäftigt damit, mir vorzustellen, wie Carver im frühen Morgengrauen mit kreisrunden kleinen Verbrennungen auf den Händen und einem Stapel Blätter auf dem Schoß einschlief, Carver, dieser Diplomat der trostlosesten Gegenden eines zerrütteten Lebens. Ich rechnete damit, Notizen für eine seiner Geschichten zu entdecken, geritzt in eine der Holzbänke im Foxhead. Mit Sicherheit dienten sie als Vorlage für einige der mit Edding hingeschmierten Toilettensprüche.
»Es war schwer genug, ihn überhaupt zu erkennen«, sagte mal eine Bekannte. »Der Alkoholdunst und der Zigarettenrauch waren derart dicht, dass man den Eindruck bekommen konnte, es befände sich noch eine weitere Person im Raum.« In der schlimmsten Phase seiner Trunksucht gab Carver an, zwölfhundert Dollar im Monat für Alkohol ausgegeben zu haben, ein hübsches monatliches Gehalt, das er dieser anderen Person im Raum ausbezahlte. »Natürlich existiert da ein Mythos, der mit dem Trinken einhergeht«, sagte Carver einmal, »aber das hat mich nie beschäftigt. Das Trinken selbst hat mich beschäftigt.«
Auch mich beschäftigte das Trinken. Genauso beschäftigte mich aber der Mythos dieses Mannes, der sich um den Mythos des Trinkens nicht scherte. Ich glaube, das ging uns allen so.
Carver liebte Londons König Alkohol. Bei mittäglichen Drinks empfahl er das Buch einem Lektor, erzählte ihm voller Begeisterung, es handele von »unsichtbaren Mächten«, stand dann vom Tisch auf und verließ das Restaurant. Früh am nächsten Morgen bekam ebenjener Lektor einen Anruf aus dem Bezirksgefängnis, wo Carver hinter Gittern auf dem Zementboden schlief.
*
Daniel war ein Lyriker, der über einem Falafel-Imbiss wohnte und einen Müllwagen fuhr. Ich lernte ihn im Deadwood kennen, einer Kneipe im Stadtzentrum, die voller Flipperautomaten stand. Natürlich waren wir betrunken und mussten blinzeln, als kurz vor Kneipenschluss plötzlich das Licht anging. Daniel hatte dunkle Haare und blaue Augen. Als jemand sagte, er sehe aus wie Morrissey, musste ich nachschauen, wer Morrissey ist. Ich ließ zu, dass er mich mit zu sich nach Hause nahm und mich quer auf seiner klumpigen Futon-Matratze ablegte. Unter seiner kratzigen Wolldecke aßen wir Schokoladeneis direkt aus der Packung und sahen Pornos. Ich hatte noch nie Pornos gesehen. Ich wollte wissen, ob sich der Typ vom Bringdienst noch in die Krankenschwester verlieben würde. »Eine Handlung gibt’s eigentlich nicht«, sagte Daniel. Er dagegen hatte eine Handlung: eine Geschichte voller Missgeschicke und Unglücksfälle, über die ich mehr und mehr erfahren wollte, als wäre ich eine Taschendiebin, die nach Anekdoten tastete und wühlte. Einmal hatte er sich als Pirat verkleidet und war, von oben bis unten mit Kotze beschmiert, in seinem Treppenhaus aufgewacht, ein andermal war seine Ex mittels eines Ouija-Bretts auf einer Picknickbank vor einem Donut-Laden in Wyoming mit der Geisterwelt in Kontakt getreten.
Das Leben mit Daniel war schräg, flatterhaft und unberechenbar. Es prickelte. Wenn er etwas aß, artete es in eine Sauerei aus. Er hatte Kohl im Bart, Eisklumpen schmolzen auf seinen Laken, in seinem Spülbecken standen verkrustete Töpfe und Pfannen, und seine Ablage im Bad war voller winziger Bartstoppeln. Auf den Titelblättern der alten New Yorker-Magazine, die sich in meinem Zimmer stapelten, hinterließ er eilig aufgeschriebene Versatzstücke potenzieller Gedichte: »Wirklichkeit ist Überleben … ausgestattet mit Schubladen für Unterwäsche, ein paar Kerzen im Bad und vielleicht einem irgendwo auf dem Dachboden versteckten Zepter.« Auf einer Party, bei der alle Single-Malt-Whisky tranken und die Verkostungsrunden schriftlich bewerteten, schrieb jemand: moosig, rauchig, erdig. Daniel dagegen schrieb: Schmeckt wie von Wagenrädern im alten Rom aufgewirbelter Staub. Als wir zusammen koksten, war es für mich nicht das erste Mal. Einmal hatten wir nachts Sex auf einem Friedhof am Stadtrand. Weil wir ein Auto hatten, fuhren wir nach New Orleans. Ich sagte die Seminare ab, die ich unterrichten sollte – oder fand Freunde, die mich vertraten –, damit wir unter kratzigen senfgelben Motel-Decken mitten im Nirgendwo von Mississippi den History Channel glotzen konnten. Am frühen Nachmittag tranken wir Whisky und rannten durch die kleinen Gässchen des French Quarters.
Daniel und seine Freunde, eine Truppe schon etwas älterer Dichter, verbrachten ihre Abende damit, mit Luftgewehren auf leere Bierdosen zu schießen. Ich sah sein Gesicht im Flackern der Lagerfeuer aufleuchten. Ich war mir bewusst, dass ich mit meinen 21 Jahren noch ziemlich jung war, weswegen ich log und ihm sagte, ich sei 22. So ging die Rechnung damals für mich auf. Daniels Freunde machten mir Angst. Er erzählte mir, sein Freund Jack habe mit 125 Frauen geschlafen. Ich fragte mich, ob Jack auch mit mir schlafen wollte. Eines Abends erzählte ich Jack, dass ich hin und wieder mitten in der Nacht rausfuhr zur Lkw-Raststätte, wo ich dann in einer vinylbezogenen Sitznische neben dem Ersatzteilladen arbeitete, mit Blick auf die ganzen verchromten Radkappen in den Gängen. »Das macht dich gerade hundert Mal interessanter«, sagte er, und ich versuchte, mich direkt an Ort und Stelle durch hundert zu teilen, um zu wissen, wie interessant ich davor gewesen war.
*
Wenn es ein Buch gab, das alle in Iowa zutiefst verehrten, Lyrikorakel und Prosaschmiede gleichermaßen, dann war das Denis Johnsons Erzählungsband Jesus’ Sohn. Diese Story-Sammlung war unsere Bibel in Sachen Schönheit und Versehrtheit, eine Halluzination über das Wie und Wo unseres Lebens – voll von Scheunenpartys, verkaterten Vormittagen und einem Himmel von derart intensivem Blau, dass einem davon die Augäpfel schmerzten. Das halbe Buch spielte in den Kneipen von Iowa City. Verrückte Dinge passierten an der Kreuzung von Burlington und Gilbert Street, da, wo jetzt eine Kum & Go-Tankstelle stand. Die Geschichte »Notaufnahme« borgte sich ihren Titel von den großen, rot leuchtenden Buchstaben vor der Backsteinmauer des Mercy Hospital, die bei mir die Assoziation an die vielen Winternächte weckten, in denen ich zu Fuß nach Hause gegangen und so betrunken gewesen war, dass ich die Kälte gar nicht spürte. In der Welt von Johnsons Storys beugte man sich tief über sein Glas, um Alkohol zu trinken, »wie ein Kolibri zu einer Blüte«. Dort gab es Farmen, auf denen die Menschen synthetisches Opium rauchten und Sachen sagten wie: »McInnes fühlt sich heute nicht besonders. Ich habe grade auf ihn geschossen.«
In Jesus’ Sohn waren sogar die Maisfelder wichtig. Sie umgaben unsere Stadt wie ein Ozean, grün und raschelnd im Sommer, hoch genug für Labyrinthe im September, dann abgeerntet und für den Rest des Herbstes nur noch trockene Hüllen, trostlose Reihen skelettierter brauner Halme. Es war, als riefe Johnson uns an, betrunken und vom Ende aller Zeiten, und verklickerte uns, wofür sie standen, diese wogenden Felder, die kein Ende fanden, so weit unsere Blicke auch reichten. Eine seiner Figuren betrachtet die riesige Leinwand eines Autokinos und verwechselt sie mit einer heiligen Vision: »Der Himmel [war] weggezogen, und die Engel stiegen aus einem leuchtenden blauen Sommer, ihre großen Gesichter waren vom Licht gestreift und voll Mitgefühl.« Johnson verwechselte das stinknormale Iowa um uns herum mit etwas Heiligem, und Drogen und Alkohol halfen ihm bei dieser Verwechslung.
Als Johnson im Herbst 1967 als Erstsemester-Student in Iowa City eintraf, schrieb er seinen Eltern, er habe versehentlich Babydecken gekauft, weil er sie im Supermarkt für Handtücher gehalten habe, freue sich aber gleichzeitig, einen ganzen Schwung »vor Individualität nur so strotzender Krawatten« gefunden zu haben. Er beschwerte sich über einen Mann, der vor seiner Wohnheimzimmertür laut Banjo spielte. Schon im November musste er zum ersten Mal für ein paar Tage ins Gefängnis. Während er einsaß, schickten ihm seine Freunde eine Supermarktgrußkarte mit Cartoon-Männchen drauf, die abgrundtief traurig dreinblickten: »BITTEKOMMZURÜCK!!! Wir vermissen dich alle sehr! Und außerdem …«, so ging es im Inneren der Karte weiter, »… ist die Luft auch wieder rein!« Seine Freundin Peg schrieb ihm: »Junge, ich habe den ganzen Tag lang versucht, dich aus dem Knast zu kriegen, aber sie wollen dich nicht laufen lassen. Deine Gerichtskosten sind aber bezahlt, du kommst also Donnerstagabend raus.« Ihr selbst gehe es so weit ganz gut – »Im Moment bin ich an einer Raststätte auf der I-80 und trinke Cola« –, und er solle wissen: »Wir alle erwarten voll Sorge deine triumphale Rückkehr.«
Mit neunzehn Jahren veröffentlichte Johnson seinen ersten Gedichtband. Als er einundzwanzig wurde, hatte man ihn wegen einer alkoholbedingten Psychose bereits in eine psychiatrische Anstalt eingewiesen. Ich hatte gehört, dass Jesus’ Sohn eigentlich nur aus einer Handvoll Erinnerungen bestand, die Johnson erst in die Schublade gestopft und dann, Jahre später, an einen Verlag verkauft hatte, damit er seine Steuern bezahlen konnte.
In meinem Zimmer in Iowa las ich mir einen seiner letzten Absätze immer wieder laut vor: »…und dann küßte ich sie voll, mein Mund auf ihrem offenen Mund, und wir trafen uns innen. Es war da. Wirklich. Der lange Weg den Korridor hinunter. Die Tür, wie sie sich öffnet. Die schöne Fremde. Der zerrissene Mond war ausgebessert. Unsere Finger tupften die Tränen weg. Es war da.« Wie nachdrücklich Johnson darauf beharrte, dass ein einziger dämlicher Kuss ins Gewicht fallen, ein einzelner schwärmerisch betrunkener Augenblick wichtig sein könnte. Wie er darauf bestand, dass auch die gewöhnlichsten Dinge wichtig sein könnten – der Weg den Flur hinab, die sich öffnende Tür, sogar die namenlose Fremde. Alles zusammengenommen ergab etwas. Wer aber sollte schon wisen, was dieses Etwas war? Wir spürten nur seine schartigen Ränder.
Der Schmerz spielte in Johnsons Storys die Rolle des Schönen und Unabdingbaren. Hinter der Fassade aus Zerstörung und Leid lauerte die Wahrheit. Etwas kam zustande, wenn Menschen litten, es war wie bei einem Juwel oder einem bebrüteten Vogelei. Wenn einer Frau gesagt wird, dass ihr Ehemann gestorben sei, hinter einer geschlossenen Krankenhaustür, unter der eine »strahlende Helligkeit« hervorströmt – als würden »dort, in irgendeinem wahnsinnigen Verfahren Diamanten eingeäschert« –, stößt sie einen schrillen Schrei aus, der so klingt, wie sich der Erzähler »den schrillen Schrei eines Adlers« vorstellt. Was ihn allerdings nicht entsetzt, sondern vielmehr in Bann schlägt – »Es war ein tolles Gefühl, am Leben zu sein und das zu hören!«, sagt er. »Seitdem suche ich nach diesem Gefühl überall.« Meine Studienanfänger fanden die Versessenheit des Erzählers auf das Schmerz- und Leidvolle grausam, ich aber dachte: Ich kann’s nachvollziehen. Auch ich hätte auf der Suche nach diesen Diamanten, nach der großen Hitze und dem schrillen Schrei der Zerstörung meine Finger begierig unter der Krankenhaustür hindurchgesteckt.
Am Ende der Geschichte spricht uns der Erzähler direkt an: »Und ihr, ihr lächerliches Volk, ihr erwartet von mir, daß ich euch helfe.« Aber mich verlangte es gar nicht so sehr nach seiner Hilfe als nach seiner glorreichen Vision dessen, was es bedeutete, innerlich kaputt zu sein. Seine Figuren spielten die Rolle der prophetischen Trinker, sie waren für uns die Vergils ihrer eigenen Hölle. »Weil wir alle uns für tragisch hielten«, unterrichtet uns der Erzähler, »und weil wir tranken. Wir hatten dieses Gefühl von Hilflosigkeit und Schicksal.« Johnsons Storys beharrten darauf, dass alles, was uns umgab, auch wichtig war: das Verträumte, Nelkenverrauchte sowie die durchdringende Kälte dieser Stadt. Es war da, schrieb er. Wirklich.
*
Ich wollte meine ersten Monate mit Daniel als zauberhaft begreifen, in Wahrheit aber waren sie durchsetzt von Ängsten. Für mich waren sehr viele unserer sorglosen Abenteuer – der Spontantrip nach New Orleans, der Friedhofssex – durchfurcht von Zweifeln und hatten mit dem Gefühl von Freiheit so gut wie gar nichts zu tun. Viel eher waren sie der Versuch, mir und ihm zu beweisen, dass das, was da zwischen uns ablief, etwas Großformatiges war. Unser stolpernd betrunkenes Rennen durchs French Quarter lief in meinem Kopf ab wie ein Arthouse-Film vor der Kulisse schmiedeeiserner Balkone und handtuchschmaler pastellfarbener Wohnhäuser.
Ich brauchte es nicht nur, dass Daniel mich wollte; ich brauchte, dass er alles mit mir teilen wollte. Alles, was eine Nummer kleiner war, kam mir wie eine Zurückweisung vor – für ihn dürfte das relativ anstrengend gewesen sein. Ich hatte keine Lust auf die Phase, die normalerweise zwischen dem Sich-fremd-Sein und dem Für-den-Rest-des-Lebens-leidenschaftlich-verbunden-Sein kommt – mir war nicht nach Kennenlernen, Flirten, Ausgehen. Ich brauchte alles, und zwar sofort: Mehr. Noch mal. Für immer. Ich erinnere mich, wie Daniel zu mir sagte: »Ich mag dich, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich dich heiraten will.« Was ich zu ihm gesagt und womit ich diese Aussage provoziert hatte, habe ich praktischerweise verdrängt. Wahrscheinlich war es etwas wie: »Willst du mich etwa nicht heiraten?!« Dass er das nach einem Monat noch nicht wollte, interpretierte ich bereitwillig als mein persönliches Versagen. Mit Daniel zu trinken bedeutete für mich nicht nur, mich in die fahrigen Hände seiner Sorglosigkeit zu begeben, sondern auch seine Unbestimmtheit auszuhalten. Ich deutete diese Unbestimmtheit als metaphysisches Vexierbild, einen vagen Verweis auf eine potenzielle Intimität. Eigentlich aber war es einfach nur Ehrlichkeit. Die Ehrlichkeit eines 26-jährigen Lyrikers, der über einem Falafel-Imbiss wohnt.
Als wir einmal von einem Grillabend nach Hause wankten und in der Dunkelheit herumalberten, blieb er plötzlich mitten auf dem Gehweg stehen und sagte zu mir: »Ich war da eben verliebt in jedes einzelne Scheißwort, das aus deinem Mund kam.« Was meine Ahnungen nur bestätigte, hatte ich doch schon immer den Verdacht gehabt, dass Liebe sich einstellt als Belohnung dafür, das Richtige gesagt zu haben.
Daniels Exfreundin hatte Gebärmutterhalskrebs gehabt. Er hatte sie mit HPV infiziert und fühlte sich für ihre Krankheit verantwortlich. Obwohl sie längst wieder gesund und die beiden nicht mehr liiert waren, beschäftigte ihn das Phantom dieser Beziehung und seine Schuld an ihrer Erkrankung immer noch sehr. Ich war unbesorgt darüber, dass der Krebs bei ihr zurückkehren oder ich mir selbst HPV holen könnte; ich fürchtete lediglich, dass ich ihm nie so viel bedeuten würde wie sie.
An einem Wochenende fuhren wir zum Campen raus an den Lake Macbride, ich, Daniel und sein Trupp etwas älterer Dichterfreunde. Es war Frühlingsanfang. Die Luft roch nach feuchter Erde. Alles war durch den gerade erst geschmolzenen Schnee noch ganz roh und offen. Ich hatte Angst, das Falsche zu sagen, gleichzeitig aber auch Angst, gar nichts zu sagen. Was hatte ich in Sachen Lkw-Raststätte noch auf Lager? Was hatte ich sonst noch? Ich kippte mir ein Bier nach dem anderen hinter die Binde und rührte meinen Hamburger kaum an. Ich erinnere mich an meine Nervosität, und dann erinnere ich mich an gar nichts mehr. Am nächsten Morgen wachte ich in einem Zelt auf, und Daniel erzählte mir, sie hätten sich Sorgen gemacht. Am Abend zuvor war ich wohl in den Wald gelaufen und dann nicht zurückgekommen. Erst hatte er noch gedacht, ich sei pinkeln gegangen, aber dann sei ich einfachnicht wiedergekommen. Er war mich suchen gegangen und hatte mich irgendwann zusammengekauert am Stamm eines Baumes gefunden. Was ich denn da gemacht habe, wollte er wissen. Das hätte ich auch gern gewusst.
Ich begann, die sozialen Rituale der Unterhaltung nach einem Filmriss zu erlernen: Man lässt sich von jemandem erzählen, was man am Vorabend getan hat, und spekuliert dann mit demjenigen über die Gründe für dieses Tun. WAS habe ich gemacht?, fragte ich mit schöner Regelmäßigkeit. Warum hätte ich DAS tun sollen? Ich stellte mir vor, wie ich zwischen den Bäumen entlangstolperte, vorangetrieben von einem seltsamen Überlebensinstinkt, der meinen Körper dem eigenen tyrannischen Wunsch entfliehen ließ, ständig Eindruck zu schinden. Mein betrunkenes Ich war wie eine peinliche Cousine, für die ich die Verantwortung trug, ein Gast im Wald, der zweifelsfrei mein Fehler war, den eingeladen zu haben ich mich allerdings nicht erinnerte.
*
1967 brachte das Magazin Life ein achtseitiges Porträt von John Berryman unter dem Titel »Whisky and Ink, Whisky and Ink«. Auch abgedruckt waren Fotos von einem bärtigen Dichtergenie, das mit ganzen Dubliner Pubs Freundschaft schließt, über Ansammlungen leerer Pint-Gläser mit getrocknetem Schaum am Rand Reden schwingt und dabei die Bürde seiner Weisheit und damit das Gegengift zu seinem Whisky trägt. »Whisky und Tinte«, so fing der Text an. »Das sind die Flüssigkeiten, die John Berryman braucht. Er braucht sie zum Überleben und um das beschreiben zu können, was ihn von anderen Männern, ja sogar von anderen Dichtern unterscheidet: sein ungewöhnliches, fast wahnsinnig machend durchdringendes Bewusstsein von der Sterblichkeit des Menschen.«
Es war nicht ganz die Weiße Logik, aber schon nah dran. Nicht der Whisky schenkte Berryman seine Hellsichtigkeit, aber er half ihm, sie auszuhalten. Dieses Porträt zeichnete die schimmernde Verbindungslinie zwischen dem Trinken und der Dunkelheit nach, zwischen dem Trinken und dem Wissen. Mitten im Text stand außerdem eine ganzseitige Heineken-Werbeanzeige.
Berrymans berühmteste Anthologie, The Dream Songs, beschwört eine Landschaft voller Alkohol und qualvollem Wissen. »Ich bin, draußen«, verkündet das lyrische Ich. »Unglaubliche Panik herrscht … Die Drinks kochen. Die Drinks / auf Eis kochen.« Sogar die Drinks auf Eis kochen also. So weit ist es schon gekommen. Henry, Berrymans Alter Ego, spricht oft mit trunkener Stimme, schwitzt heftig auf die Buchseiten und stellt sich die eine oder andere Frage: »Bist du radioaktiv, Kumpel? – Ja, Kumpel, radioaktiv. / – Hast du auch dieses nächtliche Schwitzen & und dieses Schwitzen tagsüber, Kumpel? – Ja, Kumpel, hab ich.« The Dream Songs atmen eine seltsame neue Art von Sauerstoff. »Hey, da draußen! --- Ihr Lehrbeauftragten, ordentlichen Professoren, / Privatdozenten, -- Referenten – ihr anderen – alle«, verkündet Henry, »ich muss euch fas schagen.« Ich muss euch fas schagen. Seine trunkene Stimme stellt ihre Trunkenheit bis an die Grenze der Absurdität aus und suggeriert, dass sich das Schöpferische erst hinter der Grenze des Wohlbefindens ereignet. Eine von Berrymans Freundinnen sagte ihm mal, er lebe, als »hätte er sein ganzes verdammtes Leben ohne jeden Regenschutz draußen verbracht … Die Augen in Fetzen von dem, was sie gesehen haben und wovon sie sich abwenden wollen.«
Im Alter von vierzig Jahren kam Berryman für eine Zeit als Lehrbeauftragter nach Iowa und ließ eine Menge in New York zurück: die gerade erst vollzogene Trennung von seiner ersten Frau, eine Freundin kurz vor der Abtreibung, die offene Rechnung bei seinem Psychoanalytiker. »Mittlerweile hat sich die Summe gewaltig aufgetürmt, was Sie wohl entmutigt, überhaupt anzufangen«, schrieb ihm jener Analytiker. »Aber bitte: Fangen Sie an!«
Schon am Tag seiner Ankunft in Iowa fiel Berryman eine Treppe hinunter und brach sich das Handgelenk. Bald hatte er einen Ruf weg dafür, in den Kneipen den Lobpreis zu singen auf Walt Whitmans lange Zeilen und seine Studierenden mitten in der Nacht betrunken anzurufen. »Mr. Berryman hat häufig bei mir angerufen«, erinnert sich Bette Schissel. »Meistens war er dann zutiefst aufgewühlt … Oft faselte er zusammenhangloses Zeug und bettelte geradezu um die Bestätigung, seine Vorlesung am Vormittag sei ›herausragend‹ oder gar ›brillant‹ gewesen.« Er war ein labiles Orakel. Über sein Alter Ego Henry schrieb er:
Der Hunger war ihm angeboren,
Frauen, Zigaretten, Alkohol, Verlangen Verlangen Verlangen
Bis er entzweiging.
Die Bruchstücke setzten sich auf & schrieben.
Dieser Hunger lag in der Familie. In einem Brief an den Sohn beschrieb Berrymans Mutter ihre Sehnsucht nach der Zuneigung ihrer eigenen Mutter: »Ich, die sich nach ihrer Liebe sehnte und sich aus diesem Bedürfnis heraus ihren Weg durchs Leben suchte, immer nach Liebe tastend, stochernd, grapschend.« Sein eigenes Verlangen wiederum ließ Berryman entzweigehen, obwohl die Bruchstücke das mit dem Schreiben noch auf die Reihe bekamen. »Ich habe die Souveränität des Leidens; eines außergewöhnlichen Leidens, wie ich denke«, behauptete er beharrlich und identifizierte sich mit den gequälten Trinkergenies vor seiner Zeit: Hart Crane, Edgar Allan Poe, Dylan Thomas. Er verglich sich mit Baudelaire, beschrieb dessen ähnlich »stürmisches Gemüt & die rasiermesserscharfe Empfindlichkeit gegenüber der Blamage« sowie dessen »heftige Selbstverachtung, die der meinen verbrüdert ist«. Die Toten saßen ihm allzeit im Nacken. Sein Vater beging Selbstmord, als er elf war.
In Teilen blieb Berryman seinen Traumata und deren Folgen verhaftet. Seinem unbezahlten Analytiker gegenüber gestand er in einem Brief die Angst, seine Kreativität einzubüßen, sollte er seine emotionalen Probleme in den Griff bekommen. Er sah seinen Fall ähnlich gelagert wie den von Rilke. Sein Analytiker schrieb zurück: »Über die Ähnlichkeit mit Rilke würde ich mir genauso wenig Gedanken machen wie über die mögliche Beschädigung Ihres kreativen Potenzials. Beide sind bei Ihnen nicht derart mit Ihren emotionalen Problemen verquickt, dass die Lösung Letzterer notwendigerweise zur Zerstörung Ersterer führen würde.«
Über viele Jahre hinweg sah Berrymans operative Logik trotzdem folgendermaßen aus: Leid versprach Inspiration, und Alkohol versprach Erlösung vom Leid. Alkohol war eine Möglichkeit, die Macht des Leidens auszuhalten. Bei seinem Freund Saul Bellow klingt die Annahme nach, dass nur das Trinken Berryman in die Lage versetzte, seiner eigenen dunklen Weisheit die Stirn zu bieten: »Die Inspiration war immer auch eine Todesdrohung, [und] das Trinken wirkte da stabilisierend. Irgendwie verringerte es die tödliche Intensität.« Sollte Berryman das tatsächlich geglaubt haben – dass das Trinken ihm dabei half, die fatale Intensität seiner eigenen poetisch visionären Kraft auszuhalten –, so ließ sich nicht von der Hand weisen, dass damit anderweitige intensive Erfahrungen einhergingen: Nach einem Gefängnisaufenthalt wegen Trinkens in der Öffentlichkeit und öffentlicher Ruhestörung war er seinen Job als Dozent an der Universität von Iowa schnell wieder los.
Als ich auf die Legende von Berryman stieß, wehte mich der reizvolle Hauch des Komplizierten an, diese süßlich alkoholische Duftwolke aus Verworrenheit und harschen Brüchen. Eine Freundin schrieb ihm einmal: »Was deine Arbeit anbelangt, so habe ich das Gefühl, deine Gedichte sind wie das Licht, das wir von einem Stern sehen, der längst Asche ist.«
Was für eine Rolle hätte die Nüchternheit in diesem glorreichen erzählerischen Bogen aus Feuersbrunst und Fäulnis schon spielen sollen?
In den Dream Songs erkannte ich den Beweis für einen gepeinigten Geist – und den Beweis, dass man aus dieser Pein heraus schreiben konnte. Ich sah, wie Berrymans Bruchstücke sich aufsetzten und schrieben:
»Über die Nüchternheit wird etwas oder kann etwas gesagt werden / aber viel ist es nicht.«
*