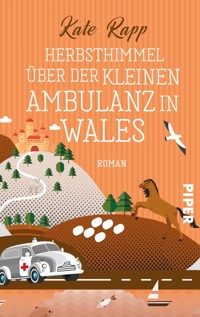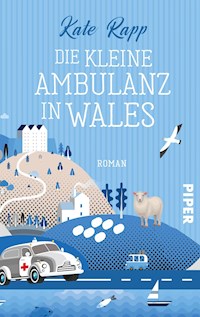
2,49 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,49 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper Gefühlvoll
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
Ein unterhaltsamer Feel-Good-Roman um einen Neuanfang in Wales für alle Fans von Jenny Colgan und Julie Chaplin »Zuviel Schönheit bekam ihr nicht. Machte sie trunken, taumelig und romantisch. Hiraeth, das war an allem schuld. Klang wie eine gefährliche Krankheit und schien hoch ansteckend zu sein, diese Melancholie.« Holly ist Krankenschwester am King´s College Hospital in London. Als ein Patient unter ihren Händen stirbt und sich kurz darauf auch noch ihr Freund von ihr trennt, nimmt sie eine Auszeit in Wales. Doch dort geht der Ärger weiter: ein Schaf läuft ihr ins Auto und sie legt sich mit dem Hofbesitzer Fagin an. Unterstützung erhält sie von der lesbischen Tierärztin Jane und der jungen Polizistin Anne Hô. Als sie dann den charmanten Barmann Chris kennenlernt und sie die erkrankte Gemeindeschwester Claire zeitweise vertritt, scheint sich das Blatt endlich zu wenden ... »Ein Buch, bei dem man traurig ist, wenn es zu Ende ist ... Eine schöne Liebesgeschichte aus Wales.« ((Leserstimme auf Netgalley))»Eine wunderschöne Selbstfindungsstory, die mich absolut begeistern konnte.« ((Leserstimme auf Netgalley)) »Es gibt Bücher, da merkt man von Seite 1 an, dass man sie ins Herz schließen wird und was soll ich sagen? Ich liebe dieses Buch! Mein Fazit: Definitiv einer meiner Lesehighlights.« ((Leserstimme auf Netgalley) »Eine richtige Wohlfühllektüre, die trotzdem auch ernste Themen nicht ausklammert. Eine wunderbare Leseauszeit!« ((Leserstimme auf Netgalley)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Mehr über unsere Autorinnen, Autoren und Bücher: www.piper.de
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, schreiben Sie uns unter Nennung des Titels »Die kleine Ambulanz in Wales« an [email protected], und wir empfehlen Ihnen gerne vergleichbare Bücher.
Warnung: Dieses Buch enthält potenziell triggernde Inhalte. Mehr dazu am Ende des Buches.
© Piper Verlag GmbH, München 2022
© Katharina Rappmund 2022
Redaktion: Cornelia Franke
Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)
Umschlaggestaltung und Motiv: www.bookcoverstore.com
Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen, wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich der Piper Verlag die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Inhaltsübersicht
Cover & Impressum
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
Danksagung
Triggerwarnung
Buchnavigation
Inhaltsübersicht
Cover
Textanfang
Impressum
1
Die Blumen, entschied Holly, würde sie auf dem Heimweg kaufen. In zarten Rosé-Tönen, Weiß und Eidottergelb zwinkerten ihr die Ranunkeln aus dem Plastikeimer zu, der vor Mr Panwars Laden am Bahnhof Brixton stand. Daneben machten sich Sträuße Papageien-Tulpen in Primärfarben breit sowie dicke Büschel Hyazinthen. Sie hatten ihre winzigen wächsernen Knospen bereits geöffnet und verströmten einen geradezu märchenhaften Duft. Wenn sie die Augen schloss, meinte Holly, im Gewächshaus von Kew Gardens zu stehen. Doch kaum war sie in die Tiefen der Bahnhofsgänge eingetaucht, zirpten statt Vögeln um sie herum Telefone, hysterische Stimmen, kreischende Bremsen. Holly wirbelte durch den Menschenfluss wie durch Stromschnellen, bevor sie in den Zug sprang wie auf ein rettendes Floß.
»Morgen, Malcolm!«
Die vertraute Gestalt saß zusammengefaltet auf seinem Stammplatz vor dem Seiteneingang des King’s College Hospitals. Er war ein Mann unbestimmtem Alters, mit grauen Schuppen an beiden Unterarmen, wohnte offensichtlich in einer zugigen Ecke unter den Gleisbögen und war Stammgast in ihrer Notaufnahme. Holly erinnerte sich nicht mehr, wie oft sie seine gangränösen Füße schon behandelt hatte. Seine zerplatzte Lippe. Zertretene Rippen. Einmal einen Messerstich.
»Wunderschöner Tag heute, Lady«, knarzte er und spannte das Gesicht zu seinem unvergleichlichen Lächeln auf. Ein einziger Zahn funkelte fröhlich zwischen den Lippen. Seine gelben Augen glänzten, als Holly ihm ihren üblichen morgendlichen Obolus in seinen zerdrückten Hut warf.
»Spendierhosen an, was?«, fragte er und deutete grinsend auf Hollys gemusterten Rock.
»Ich würde Ihnen sogar mein letztes Hemd geben.«
»Warum sollte ich Ihr letztes Hemd wollen?«, sagte Malcolm und musterte ihre fliederfarbene Bluse abschätzig. »Ich kann auch nicht alles tragen, wissen Sie.« Er nahm seine Schultern unter dem zerlumpten Parka zurück, als werfe er sich in Pose.
Lachend trat Holly durch die sich öffnende Schiebetür.
Während sie sich den blauen Kasak überzog und ihre Sachen im Spind verstaute, überlegte Holly, ob sie nach ihrer Schicht William anrufen sollte. Sie hatten am Vortag eine winzige Meinungsverschiedenheit, wie er es nannte, gehabt, weil Holly nicht mit zur Geburtstagsfeier seiner Mutter kommen wollte.
»Ich kenne sie doch gar nicht.«
»Holly, sie war auf der Einweihungsfeier meiner neuen Wohnung. Ich glaube, sie mag dich.«
Die neue Wohnung, das war auch so ein Thema. Er hatte sie nicht gefragt, ob sie zusammenziehen wollten, worauf sie auch nicht erpicht gewesen war, sie kannten sich keine zehn Monate. Aber gefragt worden wäre sie gerne. Immerhin stand ihre Zahnbürste schon in seinem Bad.
»Sie mag mich nicht, glaub mir. Ich weiß einen vernichtenden Blick zu deuten und in ihren Augen stand: Was will diese pummelige Frau mit der grässlichen Frisur von meinem Sohn?«
»Unsinn, das bildest du dir ein. Und ich liebe dein Haar.«
Ihre widerspenstigen dunklen Locken hatten Holly ihr Leben lang in den Wahnsinn getrieben. Dass William ihre Haare mochte, war einer seiner Pluspunkte, neben seinem Talent für intensive, lange Küsse und dem geradezu rührenden Bedürfnis, immer das Richtige zu tun.
Er war Assistent der Personaldirektion des King’s College Hospital, eine Position, auf die er wegen seines mittelmäßigen Abschlusses auf einem mittelmäßigen privaten College zurecht stolz war. Seine Eltern waren wohlhabend genug, um standesbewusst auf ihrem hohen Ross der gehobenen Mittelschicht zu sitzen und auf eine kleine Krankenschwester herabzusehen, die ihre Haare und ihren Appetit nicht im Griff hatte. All das war stets in den Blicken seiner Mutter zu lesen, und Holly hatte nicht vorgehabt, sich bei ihr anzubiedern.
»Kann es sein, dass es umgekehrt ist, und du meine Mutter nicht magst?«, hatte William überraschend hellsichtig gefragt und Holly fühlte sich in die Defensive gedrängt.
»Das ist es nicht. Sie ist bestimmt eine ganz wunderbare Frau«, log sie. Vor dieser Feier grauste es ihr. All diese perlenbehängten Hausfrauen. Gesträhnte Föhnfrisuren, Tweedröcke, Seidenstrümpfe. Sie kriegte schon Beklemmungen, wenn sie nur daran dachte.
»Wenn du das kleine Schwarze anziehst, das ich dir zu Weihachten geschenkt habe, und die Perlenohrstecker trägst, dann musst du dich weiß Gott nicht verstecken, Schatz!«, sagte William, als habe er ihre Gedanken erraten.
»Ich bin doch kein Zirkuspferdchen! Ich komme nicht mit! Ich habe meinen Dienst tauschen müssen.«
Wieder eine Lüge und er wusste das. Deshalb war er sauer, war ohne ein weiteres Wort gegangen und seitdem herrschte Funkstille. Keine Textnachricht, nicht mal ein fragendes Emoji war auf ihrem Handy eingetrudelt, aber Holly hatte ebenfalls eisiges Schweigen gewahrt.
Ein Herzalarm an Bett zwölf beendete ihre Gedanken. Holly rannte los. Durch die Gänge der Notaufnahme in das Behandlungszimmer, über dem die Alarmleuchte pulsierte.
»Verdammte Paddels!«, schimpfte die junge Assistenzärztin mit einem Bubikopf so rot wie ein Fliegenpilz. Hektisch versuchte sie, die Stromkabel zu entwirren. Holly verteilte schnell Kontakt-Gel auf der Brust der Patientin.
»Weg vom Bett!«, kommandierte der Fliegenpilz. Holly wich zurück und der Körper vor ihr zuckte auf der Matratze.
»Wo bleibt das Adrenalin?«
Holly konzentrierte sich.
»Adrenalin, hier!«, verkündete sie und hielt eine Spritze hoch. Der Fliegenpilz wirbelte herum, schnappte sich die Injektion und rammte sie der Patientin in die Kanüle.
»Jetzt reißen Sie sich zusammen und schocken ihn gleich noch mal«, tönte plötzlich eine Kommandostimme hinter ihnen. Oberarzt Charles Lawson hatte offenbar Dienst und war zu der Reanimation geeilt. Er war ein kleiner Mann mit großem Kopf und einem silbrigen Haarkranz, der ihm ein mönchisches Aussehen verlieh. Seine missbilligende Miene war gefürchtet, ebenso seine Chirurgenhände, die sich gerne auf die Hintern der weiblichen Angestellten verirrten.
Der Fliegenpilz jagte die Patientin mit einem weiteren Stromstoß zurück in den Sinusrhythmus.
»Gutes Kind«, bemerkte Lawson und tätschelte im Hinausgehen den weißen Kittel über ihrem unteren Rücken. Holly wandte sich ab. Die rothaarige Ärztin atmete hörbar aus.
»Das war knapp«, sagte sie und zwinkerte Holly zu, die nicht sicher war, ob sie wirklich die geglückte Reanimation meinte.
Zurück von der Intensivstation, wohin sie ihre Patientin verlegt hatte, rannte Holly auf dem Flur geradewegs in Doyita Bhatti hinein, genannt Dolly. Ihre beste Freundin seit ihrer Zeit als Schwesternschülerin. Holly und Dolly, einfach unzertrennlich. Damals waren sie naiv und idealistisch gewesen. Etwas vorlaut, das auch. Zusammen hatten sie gelernt, Hautlappen zusammenzuflicken und Bandagen anzulegen. Den Faden, an dem das Leben des Einzelnen hing, weiter zu spinnen. Die guten Feen der Notaufnahme, Holly und Dolly gehörten schon seit Jahren dazu.
»Hoppla!« Dolly schaute verdutzt und ließ scheppernd einen Satz Nierenschalen aus Edelstahl fallen. »Wo bist du nur mit deinen Gedanken, Holly!«
»Sorry!«
Doyita klaubte die Schalen zusammen und brachte sie zurück in die Spülküche. Dann schlenderten beide mit quietschenden Clogs nebeneinanderher in den Aufenthaltsraum.
»Dich beschäftigt doch etwas. Geht es wieder um William?«
Holly hob abwehrend die Schultern. Sie hatte eigentlich keine Lust, darüber zu reden, denn sie kam sich irgendwie kleinlich vor. Bockig. Aber dafür war eine Freundin da, oder? Um sich ihre unausgegorenen, lächerlich paranoiden Gedanken anzuhören und trotzdem auf ihrer Seite zu sein.
»Er ist, na ja, so bieder. Seine Mum vor allem.«
»Geht es hier um ihn oder um sie?«, forschte Dolly nach und kniff ihre schwarzen Augen zu einem Visier zusammen, durch das sie Holly scharf musterte.
»Beide. Ich meine, sie wird fünfundfünfzig, Schnapszahl! Und ich muss mit auf die Geburtstagsfeier, wo nur Damen in Twin-Sets herumstehen und sich mit Champagner betrinken.«
»Das wolltest du doch immer, Holly. Dass er sich zu dir bekennt, meine ich.«
»Schon«, gab sie zu und ärgerte sich, denn Dolly hatte recht.
Seit sie im vergangenen Sommer an der Themse bis zum Sonnenaufgang geknutscht hatten, waren sie und William ein Paar, aber niemand wusste davon. Abgesehen von Dolly. Holly war sich sicher, Will hatte selbst seinen besten Freunden nichts von ihr erzählt. Er hatte sie nicht mit zur Weihnachtsfeier seiner Abteilung und auch nicht zu anderen Afterwork-Events mitgenommen.
»Scheint fast so, als schämte er sich, eine Beziehung mit einer einfachen Krankenschwester zu haben«, hatte Dolly damals gelästert.
Aber Holly hatte es ihm nicht übel genommen, irgendwie verstand sie ihn sogar.
Sie machte das absurde Spielchen der Nichtbeachtung mit, dessen Regeln für den Fall, dass sie sich im Krankenhaus über den Weg laufen würden, nicht mal eine Begrüßung erlaubten. »Die Heimlichkeit macht unsere Beziehung erst zu etwas Besonderem«, hatte William gemeint und Holly fand das am Anfang liebenswert lausbubenhaft. Als würden sie gemeinsam den anderen einen harmlosen Streich spielen. Nach über einem halben Jahr erschien es ihr nur noch ermüdend und unreif.
»Er scheint zumindest die richtige Rangfolge einzuhalten«, sagte Dolly und schaltete den elektrischen Wasserkessel ein, während Holly zwei Tassen mit Teebeuteln bestückte. »Die Mutter, musst du wissen, ist immer die wichtigste Person im Leben eines Mannes. Wichtiger als sein Chef oder seine Kollegen. Wenn sie dich dabeihaben will–«
»Sie kann mich nicht ausstehen.«
»Wenn er dich trotzdem dabeihaben will, ist das ein ebenso gutes Zeichen! Vielleicht solltest du von deiner Position der beleidigten Leberwurst abrücken und als strahlendes Aschenputtel zu ihrem Ball erscheinen.«
Dolly feixte und Holly gab ihr einen Klaps auf den Oberarm. »Ich werd’s mir überlegen.«
»Sicher wirst du das. Ruf ihn an.«
Holly goss das Wasser aus dem röchelnden Teekessel über den Beuteltee und reichte Dolly eine Tasse.
»Und bei dir zuhause? Was machen deine Wonneproppen? Rafi dürfte doch mittlerweile schon Haare auf den Beinen haben?«, fragte sie, um von sich selbst abzulenken.
»Mit elf doch noch nicht. Glücklicherweise. Mein kleiner Schlaumeier. In seinem Gehirn scheint es ununterbrochen zu rumoren. Manchmal kommt es mir so vor, als könnte ich seine Gedanken hören. Klick und klack und klick. Und immerzu diese Fragen.«
»Der hält dich ganz sicher auf Trab. Und die kleine Indira?«
»Ganz der Vater. Sitzt stoisch über ihren Bauklötzen und tüftelt an gefährlichen Konstruktionen.«
Sie plauderten noch etwas, bevor Dolly ihre Sachen packte und nach Hause ging. Ihr Zwischendienst war vorüber.
»Mach’s gut, Doyita Bhatti!«
»Bye, bye, alte Stechpalme!«
Nach ihrer Teepause fand Holly sich allein im Flur der Notaufnahme wieder. Eine gespenstische Stille, die nur vom Rauschen der Klimaanlage und den Monitoren untermalt wurde, waberte durch das Gebäude.
»Wo sind denn alle?«, fragte sie Lydia, die wie immer hinter dem Empfangstresen saß.
Lydia hob den Kopf von ihrem Telefon, ein seliges Lächeln auf dem rosigen Lipglossmund, und sah sich erstaunt um.
»Eine Multiorgan-Transplantation, glaube ich.«
Sie versenkte sich wieder in ihre digitale Fotowelt, während der Anrufbeantworter auf Schleife geschaltet war.
Holly zückte ebenfalls ihr Handy und schrieb William eine kurze Nachricht. Der Klügere gibt nach, dachte sie. Und außerdem hasste sie es, zu streiten.
Im nächsten Moment ertönte das typische Klappern einer Rolltrage und zwei Sanitäter schoben einen jungen Mann durch die Schiebetür. Er saß aufrecht, hatte den oberen Gurt gelöst und sah sie von oben herab an. Er trug ein kurzärmliges Funktionsshirt und eine hautenge Radlerhose über dem dramatischen Muskelrelief seiner Oberschenkel. Sie war an der rechten Hüfte aufgerissen und auf seinem rechten Ellbogen glühte ein Bluterguss.
»Ich will runter, lassen Sie mich runter!«, zeterte er. »Nicht nötig, das öffentliche Gesundheitswesen mit meiner Wenigkeit zu belasten. Das sind ein paar Schürfwunden. Schürfwunden, sagte ich! Haben Sie gehört? Das ist doch wirklich übertrieben.«
»Fahrradkurier. Angefahren auf der Milkwood Road«, berichtete der größere der beiden Sanitäter ungerührt und drückte den Patienten wieder auf die Trage. Sie standen in ihren limonengelben Outfits mit den breiten Reflektorstreifen wie große Ostereier neben der Trage. »Der Helm ist hinüber. Ansprechbar, aber zahlreiche Prellungen und Schürfwunden.«
Mit ausgestrecktem Finger drehte er kleine Runden an seiner Schläfe, um anzudeuten, was er von dem Fahrradfahrer hielt.
Da kam Oberarzt Lawson wieder um die Ecke, stutzte und baute sich vor der Trage auf. »Lassen Sie den Mann aufstehen!«, kommandierte er. »Hopp, hopp, auf die Beine, mein Junge.«
Der Fahrradkurier rutschte auf die Füße, nachdem die Sanitäter ihn abgeschnallt hatten, und machte ein paar wackelige Schritte. Seine Radschuhe klackerten über das Linoleum wie bei einem Stepptänzer. Er humpelte eindeutig.
»Ab ins Röntgen! Schädel und untere Extremität. Die Bilder sehe ich mir gleich beim Durchleuchten an.« Dr. Lawson machte eine herrschaftliche Winkbewegung in Richtung der Sanitäter und schritt davon. Holly holte einen Rollstuhl, um den Radkurier in die Radiologie zu fahren.
Natürlich hatte er eine Malleolusfraktur. Nicht aus den Klickpedalen gekommen, Knöchel aufgeschlagen, gebrochen.
Mit einem Ächzen schob er sich auf den Stuhl im Gipsraum.
»Der Gips ist so kalt! Warum bekomme ich keinen bunten Plastikgips, der ist viel leichter. Was, das schwillt noch an? Ach was, das glaube ich nun wirklich nicht! Sind Sie immer noch nicht fertig? Ich muss dringend mal telefonieren, was soll ich nur mit all den Lieferungen machen? Oh Gott, wo ist überhaupt meine Tasche!«, so ging es in einem fort.
Holly verlor allmählich die Geduld mit diesem Radfreak. Alles wusste er besser, immer hatte er zu meckern.
»Jetzt halten Sie doch endlich still, damit ich den Gips nicht noch ein zweites Mal machen muss!«
»Ich habe Schmerzen!«
»Sie haben einen gebrochenen Knöchel. Natürlich tut das weh. Das Schmerzmittel, das der Oberarzt ihnen verordnet hat, wirkt bestimmt gleich.«
Sie versuchte, ihre Stimme freundlich klingen zu lassen und ein wenig autoritär. Sie wollte, dass diese Mischung aus Quengelei und Anklage endlich aufhörte, aber es wurde immer schlimmer.
»Mein Bauch tut weh.«
»Sie sind doch auf die Seite gestürzt, oder?«
»Ja.«
»Haben Sie öfters Bauchschmerzen, Verdauungsstörungen, solche Sachen?«
»Ich hatte gestern Chicken Masala von einem neuen indischen Take-away.«
»Kann es sein, dass Sie das nicht vertragen haben?«
»Vielleicht. Mir ist übel. Und schwindelig.«
Da hatte er ausgesehen wie das blühende Leben, als er ankam, jung, sportlich, muskulös und nun, eine Stunde später, saß ihr ein eingebildeter Kranker gegenüber, dem immer wieder etwas Neues einfiel. Gleich würde er auch von seinen Hühneraugen anfangen, die er durch diese engen Radschuhe immer bekam. Trotzdem, sicher ist sicher. Der Oberarzt sollte Bescheid wissen. »Bauchschmerzen?«, fragte Dr. Lawson ungehalten, als sie ihn anrief, im Hintergrund hörte sie ein Kichern. »Geben Sie ihm einfach ein paar Schmerzmittel. Ich komme später noch mal vorbei.«
»Wirken die Schmerztabletten noch immer nicht?«, fragte Holly ihren Radler. Die Antwort kannte sie schon. Sie fühlte sich hilflos, vom Oberarzt im Stich gelassen, der offenbar Wichtigeres zu tun hatte. Dabei wollte sie dem Patienten doch helfen.
»Na, kommen Sie.« Sie tätschelte aufmunternd den frischen Gips. »Ich hole Ihnen ein paar Krücken und dann machen wir ein kleines Lauftraining. Das wird Sie ablenken und Ihren Kreislauf anregen.«
Aber das schien keine gute Idee zu sein. Entweder war er ein begnadeter Schauspieler, oder es ging ihm wirklich schlecht. Er schwankte beim Aufstehen und zog die Luft scharf zwischen die Zähne, ein eindeutiges Zeichen für Schmerzen.
»Nein, so wird das nichts.«
Sie hatte nun wirklich Erbarmen.
»Legen Sie sich hier auf die Liege. Ich rufe noch mal den Oberarzt an.«
Doch Lawson ging nicht dran. Sie ließ es lange klingeln, überlegte, mit welcher der Schwestern er sich wohl vergnügte, oder ob er eine lebensrettende OP durchführte – an einem Geister-Patienten? Es war nach dem Radfahrer kein weiterer gekommen. In ihrer Verzweiflung rief Holly noch den Fliegenpilz an. Lieber eine hektische Anfängerin als gar keinen Arzt. Doch an ihrer Stelle meldete sich der OP-Pfleger. Sie war dem zweiten Transplantationsteam zugeteilt und tatsächlich unabkömmlich.
»Rufen Sie Dr. Lawson an. Der ist zuständig«, sagte der OP-Pfleger mitleidlos und legte auf. Sie probierte erneut Lawsons Nummer, vergeblich, bevor sie ins Gipszimmer zurückging.
Der Radfahrer war eingeschlafen. Beinahe war Holly gerührt. Mit geschlossenen Augen und dem stillstehenden Mundwerk wirkte er wie ein freundlicher, gut aussehender Faun. Es tat ihr wirklich leid, ihn zu wecken.
»Hey, wie geht es Ihnen? Sind die Schmerzen besser?«
Sie rüttelte ihn sanft an der Schulter. Rüttelte fester. Er reagierte nicht.
Verdammter Mist, er wird doch nicht ohnmächtig geworden sein? Die Blässe seiner Haut war nicht mehr zu übersehen. Kaum ein Kontrast gegen das weiße Laken auf der Liege. Flink klebte sie ihm die Elektroden auf die Brust, denn sein Herzschlag musste überwacht werden, bis dieser überhebliche Oberarzt endlich eintraf. Danach rannte sie kurz zu Lydia vor.
»Lass den Lawson ausrufen. Notfall im Gipsraum. Er muss sofort kommen. Sofort, verstanden?«
Damit würde sie sich bei den Kolleginnen lächerlich machen und einen riesigen Anschiss kriegen. Die Ärzte der Notaufnahme wurden nicht ausgerufen, sie waren immer anwesend. Das war ein ungeschriebenes Gesetz. Selbst wenn sie draußen waren, um zu rauchen, bei einem heimlichen Schäferstündchen oder nach einer Nachtschicht in der Umkleidekabine eingepennt. Man führte sie nicht vor, indem man sie ausrufen ließ. Man fand sie einfach und bis dahin tat man, was getan werden musste.
Als Holly zurück bei ihrem Radler war, entschied sie, dass er eine Infusion brauchte. Was immer in ihm vor sich ging, ein Zugang musste gelegt werden. Doch seine zuvor so dicken Venen waren eingesunken, verschwunden. Ach du Scheiße, dachte sie, er verblutet innerlich! Und da setzte auch schon das Herz aus, ein lang gezogener schriller Ton bohrte sich in ihr Hirn und sie sprang auf die Liege, hockte sich wie ein Golem auf seinen Körper und drückte aus Leibeskräften den Torso zusammen. Zwischen zwei Herzmassagen – Highway to Hell sang es in ihrem Kopf, um den Rhythmus zu halten – gelang es ihr noch, den Notfallknopf zu drücken und weiter ging es, das existenzielle Auf und Ab. Die Muskeln ihrer Arme brannten bereits nach einer Minute und sie schaltete mental um auf das Alternativprogramm: Stay, stay, stay, stay, staying alive!
Man musste optimistisch bleiben.
Lawson würde bestimmt gleich erscheinen.
Dennoch kamen ihr die Sekunden wie Stunden vor. Sie spürte einen Schweißfilm auf der Stirn, ihr Atem wurde schwerer, die Hände taub.
Dann plötzlich standen sie alle um Holly herum, füllten den Gipsraum aus und sprachen durcheinander, wie der Chor einer griechischen Tragödie. Einer zerrte sie von dem leblosen Körper, ein anderer intubierte, der dritte schnappte sich den Ambubeutel und beatmete mit der Hand, während sie den Radfahrer umlagerten und auf einer Rolltrage in den OP schoben. Die ganze Zeit vom fliegenden Wechsel der Herzmassage begleitet. Stay, stay, stay, stay, staying alive!, dachte Holly ihrem Radfahrer hinterher und fing an zu weinen.
Holly hatte völlig das Zeitgefühl verloren, als sie später im Aufenthaltsraum saß und starken schwarzen Tee schlürfte. Ein erschöpftes Vibrieren erfüllte ihren Körper und sie hatte das Gefühl, als würde sie jeden Moment in Milliarden Atome zerspringen. In einem Elektronenregen zerstäuben, herabrieseln und in kleinen Pfützen auf dem Linoleum liegen bleiben, bis jemand sie aufwischte und in den Müll warf.
Sie hatte sich so allein gefühlt. So hilflos. Als wäre sie der letzte Mensch auf Erden. Warum hatte es nur so lange gedauert, bis jemand kam?
Sie musste sich beruhigen. Sie hatte getan, was sie konnte. Würde das genug sein? Sie war doch nie irgendjemandem genug. William jedenfalls nicht. Verdammt, sie musste sich zusammenreißen, schalt sie sich und zog die Nase hoch.
Sie hatte schon häufiger erste Hilfe geleistet, die geglückte Reanimation vom Morgen gab ihr Hoffnung. Ihr Radfahrer würde es schaffen. Er war jung und er war stark. Sie schloss kurz die Augen und atmete tief durch.
Als Lydia anrief und einen nächsten Patienten ankündigte, stand sie auf und strich ihren Kasak glatt. Das Leben ging weiter. Sie musste jetzt die Platzwunde bei einem Kleinkind verbinden.
»Könnten Sie sie bitte ein wenig festhalten?«, bat sie die Mutter, die in einem eleganten pinkfarbenen Etuikleid einen Meter Abstand hielt, während das sechsjährige Mädchen sich auf dem Behandlungsstuhl wand, den Kopf nach rechts und links drehte, als wollte sie ihrer Ablehnung so Nachdruck verleihen.
»Ich kann die Steristrips nicht sicher platzieren, wenn sie sich so stark bewegt.«
»Haben Sie Kinder?«, erwiderte die Mutter in einem Ton, als sei das ein entscheidendes Kriterium, um ihre Tochter versorgen zu dürfen.
»Nehmen Sie sie doch auf den Schoß«, schlug Holly ihr vor.
»Also nicht, das dachte ich mir.« Die Frau guckte genervt, nahm das Mädchen hoch und setzte sich. Das Blut, das aus der Stirnwunde rann, schmierte über ihren gesmokten Ausschnitt. »Herrgott noch mal, halt still, Beverly!«, schnauzte sie, packte wie ein Schraubstock zu und verdrehte ihrer Tochter gefährlich den Hals.
Jetzt bekam Holly beinahe Angst um die Kleine, desinfizierte den Hautriss und klebte die Steristrips darüber. Schnell noch ein Pflaster drauf.
»Das war’s, Sie können loslassen«, sagte sie und stand auf. Während sie aufräumte, zerrte die Mutter das Kind hinter sich her. »Wie du aussiehst! Das reinste Gossenkind! Was sollen deine Freundinnen denken?« Sie schüttelte erbost ihre Stufenfrisur.
Das Mädchen heulte wie ein junger Wolf und Holly konnte es ihr nicht verdenken. Sie ging nach vorne zu Lydia, da schlurfte Dr. Lawson vorbei.
Er hatte wirklich nicht lange gebraucht, den Radfahrer zu stabilisieren, dachte sie anerkennend, und blieb stehen, um zu erfahren, wie es ihrem Patienten ging.
»Was denken Sie denn, wie es ihm geht?«, bellte der Oberarzt. »Tot ist er, mausetot. Und das war er bereits unter Ihren Händen. Sie sind doch diese unfähige Person, die mich nicht rechtzeitig benachrichtigt hat, oder? So geht das nicht, nein, wirklich nicht. Ich meine, was denken Sie sich eigentlich? Einen Schwerverletzten allein zu reanimieren, keinen Arzt hinzuzuziehen. Sind Sie größenwahnsinnig? Wohl eher gemeingefährlich! Das wird ein Nachspiel haben, verlassen Sie sich drauf!«
Er drehte ihr zackig den Rücken zu und watschelte dahin, wo er hergekommen war. Holly fühlte sich schlagartig wie das Platzwunden-Mädchen. Sie griff sich an die Stirn und spürte ihre Beine taub werden, doch sie war geistesgegenwärtig genug, sich mit der Hand abzustützen. Da saß sie plötzlich auf dem Fußboden vor dem Empfangstresen und dachte: Der Radler ist tot!
Sie sah sein schlafendes Faun-Gesicht vor sich und die wütende Fratze von Dr. Charles Lawson und ihr Herz begann zu rasen und hörte gar nicht wieder auf. Lydia kam zögernd hinter dem Tresen hervor.
»Geht es dir nicht gut, Holly? Was ist los, was hat er gesagt?«
»Er ist gestorben. Mein Patient ist tot und Lawson gibt mir die Schuld. Ich habe ihn sogar von dir ausrufen lassen, Lydia. Das musst du ihm sagen! Ich habe alles richtig gemacht, getan, was ich konnte. Alles.«
Sie konnte nicht weinen. Zitterte nur. Lydia half ihr, sich aufzurappeln und klopfte ihr imaginären Staub von der Seite. Es war ein unbeholfenes Tätscheln, aber es rührte Holly.
»Es geht schon«, sagte sie. »Meine Schicht ist ohnehin gleich vorbei.«
Langsam trottete sie zum Umkleideraum, öffnete ihren Spind, zog sich um und warf den zerknautschten Kasak in den Abwurf. Sie wusch sich dreimal die Hände, desinfizierte sie und trotzdem fühlte sie sich beschmutzt, als sie durch die Schiebetüren auf die Straße trat. Das Krankenhaus schien wie ein großes, schwer atmendes Tier hinter ihr zu liegen, aus dessen Poren, Schächten und Schornsteinen verbrauchte Luft, Chemikalien und Gase drangen.
Hier draußen kochte die Sonne unerbittlich die Menschen gar. Malcolm saß dösend auf seinem Platz, einen sonnengelben Strohhut mit Stoffblumen auf dem Gesicht. Ein roter Bus rauschte vorbei. Holly nahm ihre Umgebung nur gedämpft wahr. In Gedanken spielte sie immer und immer wieder den Nachmittag durch und verspürte eine wühlende Scham. Sie hatte den Radfahrer für einen Querulanten gehalten, einen Simulanten! Doch nichts hatte auf innere Verletzungen hingedeutet, er hatte noch vor ihr gesteppt, mit seinen Radlerschuhen. Sie war doch nur die Krankenschwester. Sie hatte Lawson angepiept, immer wieder. Und wieder. Und wieder. Das dachte sie im Takt ihrer Schritte, wieder und wieder.
Und sie lief durch die staubigen Straßen, fuhr schwitzend Circle Line, stieg wieder aus und wanderte mechanisch in ihre Wohnung.
Als sie auf ihrem alten Samtsofa saß, fiel ihr Blick auf die drei vertrockneten Stängel in der Vase auf dem Tisch.
Die Blumen, dachte Holly. Sie hatte die Blumen vergessen.
2
»Ich habe deine Nachricht bekommen, Babe. Lass uns reden.«
Williams Stimme klang so zuvorkommend wie immer, als er sie am selben Abend anrief. Er hatte also noch nichts vom Radfahrer gehört. Er wollte sich einfach nur versöhnen. Vor Dankbarkeit kamen Holly beinahe die Tränen.
»Es tut mir leid, natürlich komme ich morgen mit auf den Geburtstag deiner Mutter. Ich weiß doch, dass dir das wichtig ist. Keine Ahnung, warum ich manchmal so widerborstig bin.«
Sie klang in ihren eigenen Ohren unglaubwürdig. Als läse sie den Text aus dem Drehbuch einer amerikanischen Rom-Com ab. Aber sie wünschte sich so sehr Glück und Versöhnung und inneren Seelenfrieden, dass sie einfach drauflos plapperte.
»Und ich werde mich in Schale werfen und sie alle umhauen. Deal?«
»Deal!«, rief William begeistert.
Er hatte nichts gemerkt und sie wollte die Seifenblase nicht platzen lassen, indem sie ihm von ihrer grauenvollen Schicht erzählte. Er würde es früh genug erfahren, auf den Krankenhausklatsch war Verlass. Sie durfte bloß nicht den richtigen Zeitpunkt verpassen, es ihm persönlich zu erzählen.
»Wenn du gleich herkommst, könntest du dann noch bei diesem leckeren neuen Laden vorbeigehen und zwei Sushi-Platten mitbringen?«
Holly hatte weder Lust auf Gesellschaft noch auf kalten, rohen Fisch.
»Ich denke, ich bleibe zuhause. Kopfschmerzen, weißt du. Ich fühl mich irgendwie mies.« Denn ich habe einen Patienten sterben lassen. Sie sprach es nicht aus, aber dieses Wissen bebte ununterbrochen durch ihren Körper, wie ein neuer, vorwurfsvoller Pulsschlag, den sie nun ihr Leben lang würde hören müssen.
Zum Glück hatte sie morgen frei, sie würde die Zeit brauchen, um sich für die Party am Abend innerlich zu wappnen. Bis dahin würde sie sich ein paar Folgen The Royals ansehen, sich die Dialoge reinziehen, um sich an den blasierten Tonfall zu gewöhnen. Damit sie wüsste, was sie zu sagen, wie sich zu präsentieren hatte, um nicht unangenehm aufzufallen. Es war klar, dass es Ärger geben würde im Krankenhaus, ein sogenanntes Nachspiel, wie Dr. Lawson angekündigt hatte, da musste sie die Truppen sammeln. Auf Dolly würde Holly immer zählen können, aber es galt auch, William und seine Familie gnädig zu stimmen. Immerhin, William arbeitete in der Krankenhausverwaltung, da würde er ein gutes Wort für sie einlegen können.
Holly schmatzte ihm einen Kuss durchs Handy zu, schickte ein Herz-Emoji hinterher und öffnete die Flasche mit dem tröstlich süßen Eierlikör.
In der hohen Eingangshalle des viktorianischen Hauses in Kensington roch es wie in der Pathologie. Nach Desinfektionsmittel und einem Hauch Verwesung, der von den riesigen Liliensträußen auf den beiden Sockeln rechts und links der Eingangstür ausging. Das ferne metallische Klappern der Rechauds erinnerte Holly an das Geräusch beim Öffnen und Schließen der Leichenkühlfächer. Sie fröstelte und zog tapfer ihre fadenscheinige Jacke aus, damit sie Williams neues Kleid präsentieren konnte.
»Ein Schmetterling verlässt seinen Kokon«, flüsterte William dicht an ihrem Ohr. Er hatte sie abgeholt und betrachtete sie zufrieden in der ihm so vertrauten Umgebung seines Elternhauses. »Du siehst wunderschön aus, Holly!«
Aber das stimmte nicht. Sie war nicht schön. Diese englische Art von Schönheit hatte sie nie besessen. Ihre blasse Haut mit der Neigung zu Sommersprossen unter dem drahtigen schwarzen Haar, das rundliche Kinn und ihre stechenden grünen Augen fielen auf zwischen all diesen aseptisch wirkenden, leintuchblassen Hausmütterchen, die eine Schwäche für das England der sechziger Jahre entwickelt hatten. In ihren Tweedröcken und Seidenblusen mit Schleife, in ihren gerüschten Cocktailkleidern und doppelreihigen Perlenketten sahen sie aus, als seien sie einer populären Fernsehserie über das britische Königshaus entsprungen.
Williams Mutter stöckelte in einem Albtraum aus violettem Chiffon vorüber und winkte majestätisch mit der Hand.
»Du hältst sie für snobistisch?«, raunte William ihr zu, der ziemlich gut darin wurde, ihre Gedanken zu lesen. Gefährlich gut. »Ist sie. Sie hat von Oxford geträumt.«
»Sie wollte nach Oxford? Gibt es dort ein Hauswirtschaftscollege?«
»Ich sollte nach Oxford. Dort auf die Kinder aus den Privatschulen treffen. Das war ihr Plan.«
»Prinz William und so weiter? Armes Lämmchen.«
»Die Königskinder waren nie in Oxford«, wischte er ihre Ironie beiseite.
»Und du hast dir eine Freundin ausgesucht, die im National Health Service arbeitet. Tja, nicht gerade eine royale Goldgrube, was?«
»Du hast ein gutes Händchen im Umgang mit deinen Patienten, Holly. Du bist empathisch, sorgfältig, beliebt.«
»Wie bitte? Wo hast du das denn her?«
»Ich habe die Einträge in deiner Personalakte gesehen. Wenn du so weitermachst, wird man dir eine leitende Position im Pflegemanagement anbieten. Also stell dein Licht nicht unter den Scheffel. Stell dir einfach vor, meine Mutter würde an einer komplizierten Autoimmunerkrankung mit begrenzter Lebensdauer leiden und pack deinen Schwesterncharme aus.«
»Also schön.« Holly lächelte ergeben, griff nach Williams Hand und stürzte sich mit ihm in den Salon.
Seine Mutter hielt Hof am Buffet und schwenkte ein Champagnerglas in die Runde. Williams Vater stand am Kamin, ein wenig verloren überblickte er den Raum voller Damen. Er war ein etwas geistesabwesender, schwerer Mann mit kartoffelbreifarbiger Haut und spärlichem Haarwuchs. Im postkolonialen Indien der Sechziger Jahre geboren, war er in England ausgebildet und von Williams Mutter eingefangen worden, wie ein exotischer Schmetterling. Er stammte aus einer ehrwürdigen Händlerfamilie, doch im Moment schien er sich nach männlicher Unterstützung zu sehnen.
»Mein Sohn!«, polterte er und hob begeistert sein Glas über den Kopf.
»Bin gleich zurück«, raunte ihr William zu und ließ Holly stehen.
»Hallo, meine Liebe! Ich bin Roberta, Williams Tante.«
Eine Wolke schweren Parfums raubte Holly beinahe die Sinne, als eine drahtige kleine Person mit dem Gesicht eines Rehpinschers plötzlich vor ihr stand und ihr ein Glas hinhielt.
»Champagner, my dear? Der Catering-Service ist einfach grauenvoll unaufmerksam. Und keiner räumt die leeren Teller weg, man könnte meinen, man sei auf einer Mülldeponie! Cynthia hat einfach kein Händchen für Dienstpersonal.«
Holly konnte keine schmutzigen Teller entdecken, nahm aber artig einen Schluck Champagner. Die Dame legte ihr vertraulich die Hand auf den Unterarm und strahlte sie mit schwarzen Knopfaugen und vorgerecktem Schnäuzchen an.
»Sie müssen Williams Verlobte sein. Ganz entzückend.«
»Verlobte?«
»Cynthia hat mir alles über Sie erzählt. So eine ambitionierte, aufopferungsvolle junge Dame sind Sie! Nennen Sie mich ruhig altmodisch, aber ich halte Hingabe für eine der wichtigsten Tugenden in einer Ehe. Wann wollen Sie Kinder?«, fragte sie und zwinkerte ihr zu. »Und vor allem, wie viele? «
Was war nur los mit dieser Frau?, dachte Holly. Warum definierte sie sich immer noch über ihre Nachkommen? Als könnten Frauen nicht auch andere Dinge leisten. Die Radioaktivität entdecken. Literaturnobelpreise erringen. Zum Mond fliegen. Verflixt gute Serien drehen. Kranke versorgen, ihnen das Leben retten. Solche Dinge eben. Sie redete, als wäre die Geschichte der Emanzipation nicht bereits über hundert Jahre alt. Tante Roberta sah dabei selber nicht gerade so aus, als würde sie jeden Tag eine große Kinderschar um sich haben, die wie kleine Vögelchen die Schnäbel aufsperrten. Und auch Williams Mutter hatte sich auf einen einzigen Nachkommen beschränkt.
Holly schüttelte kurz den Kopf und genierte sich.
»Wir sind nicht verlobt.«
»Abwarten, Schätzchen, abwarten«, raunte die Tante wie das Orakel von Delphi, tätschelte noch einmal kurz ihren Unterarm und tippelte davon, offensichtlich enttäuscht über die kargen Auskünfte.
Holly bekam es mit der Angst zu tun. Sie war dreißig Jahre alt und wollte das Leben genießen. Und sie wusste, dass es William ebenso erging. Kinder waren nie ein Thema zwischen ihnen gewesen, im Gegenteil.
Sie hatte sich noch nicht von der Fragerunde mit Tante Roberta erholt, da segelte Williams Mutter wie ein Paradiesvogel auf sie zu.
»Holly, meine Liebe!«
»Mrs Dunbridge! Alles Gute zum Geburtstag, wünsche ich. Herzlichen Dank für die Einladung«, sagte sie so wohlerzogen und ironiefrei wie möglich und schüttelte die am langen Arm ausgestreckte Hand.
»Wie schön, dass Sie es einrichten konnten, Holly, zu meiner kleinen Party zu kommen«, flötete die Gastgeberin.
Kleine Party? Das war die Untertreibung des Jahres, dachte Holly. Dutzende echter Kerzen erleuchteten den großzügigen Salon. Er glich eher dem Ballsaal aus Downton Abbey als einem üblichen Esszimmer. Die beiden großen, goldgerahmten Spiegel reflektierten die Flammen ins Unendliche. Während Holly den Raum an Cynthias Seite langsam durchschritt, sah sie sich im Spiegel wie durch einen Schwarm leuchtender Glühwürmchen schweben. Der Tisch, der für dreißig Personen mit Damast, Kristall und edlem Porzellan gedeckt war, war viermal so lang wie ein OP-Tisch und mit nicht weniger blitzenden Instrumenten bestückt.
Natürlich wurde sie nicht neben William platziert, der zur Rechten seiner Mutter saß. Stattdessen flankierten sie Mrs Boldering und Mrs Smith, die eine nach der anderen Hollys schwarzes Kleidchen sowie die Perlenstecker wohlwollend musterten. Mrs Boldering, eine Frau mit Pferdegebiss und warmen Bonbonaugen, trug eine riesige Brosche aus Bergkristall sowie eine huldvolle Miene zur Schau.
Nachdem sie sich am Buffet bedient und wieder zusammengekommen waren, bezogen die beiden Holly in ihr Gespräch mit ein. »Welche Primary-School besuchen denn Ihre Kinder, Mrs …?«
Mrs Smiths Stimme klang abgestanden und gekünstelt. Sie trug ein eher biederes Chanel-Kostüm und übertrieben viel Rouge auf ihren nicht vorhandenen Wangenknochen.
»Higgins. Holly Higgins. Unverheiratet. Keine Kinder.« Sie lächelte schief und hob bedauernd beide Hände, woraufhin die Damen vorsichtig lachten, als hätte sie einen schlechten Witz gemacht.
»Sie Glückliche!«, rief Mrs Boldering aus. »Das waren noch Zeiten, Phyllis, erinnerst du dich?«
»Oh ja! Sonntags ausschlafen, ungeregelte Mahlzeiten, Fernsehen ohne Jugendschutz-Pin!«
»Und keine Elternabende!«
»Wissen Sie, Elternabende sind die schlimmste Erfindung, Miss Higgins. Kommt gleich nach der Einführung der Koedukation.« Mrs Smith rollte die Augen und wandte sich lächelnd ihrer Nachbarin zu.
»Apropos Schule. Unser Albert hat dermaßen viele Stipendienangebote von Privatuniversitäten, er kann sich kaum entscheiden. Was für ein Segen, dass deine Kinder dieses Problem nicht haben, meine liebe Brenda. Ach, und ich hörte von Dan, dein Mann trinkt derzeit keinen Alkohol. Soll ja sehr gesund sein, ich hoffe, er hat keine ernstzunehmenden Leberprobleme?«
Mrs Boldering schob sich gerade eine Mini-Pastete zwischen die Pferdezähne und wiegte kauend den Kopf hin und her.
»Ayurvedische Detox-Kur. Wirkt Wunder, was das biologische Alter und die Falten angeht. Solltest du auch mal probieren«, parierte sie den Hieb.
Holly hätte schreien können und nahm sich stattdessen ein winziges Gurkensandwich von einer dargebotenen Platte. Unter Müttern und Nachbarinnen wurde anscheinend mit harten Bandagen gekämpft. Von Solidarität und gegenseitiger Empathie waren diese Frauen so weit entfernt wie die WHO vom Sieg über den weltweiten Hunger. Bei der nächsten Gelegenheit flüchtete sie auf die Toilette. Glücklicherweise wurde die Tafel kurz darauf aufgehoben, den Nachtisch gab es in Gläsern-to-go, damit man im hell erleuchteten Garten wandeln und den Springbrunnen, die Birnenspaliere und nicht zuletzt die gebrochene, original römische Säule bewundern konnte.
Ein privates Feuerwerk und drei Drinks später hatte Holly William endlich soweit, dass sie gehen konnten. Er war, ebenso wie sie selbst, ziemlich angetrunken, legte den Arm um sie und schaffte es nur, ihr Ohr zu küssen.
»Liebe Disch«, nuschelte er, Treffsicherheit gleich null.
Ja, jubilierte sie innerlich, er liebte sie. So wie sie war. Jung und ungebunden. Keine dieser Vorstadtmuttis mit ihren Alkoholiker-Männern, Drittwägen und Schulgebühren in Höhe eines Einfamilienhauses. Er liebte sie, weil sie eine empathische, gute, um nicht zu sagen, hervorragende Krankenschwester war. Eine Zierde ihrer Zunft, eine, die befördert werden sollte.
»Du fühlst dich so weich an«, sagte er und klammerte sich schmerzhaft an ihrer Brust fest, als er schwankend die Stufen zur Straße hinuntertappte, wo das Taxi wartete. »Du hast dich tapfer geschlagen. Bin so stolz auf dich.«
Alkohol weichte Williams Attitüde auf und machte ihn noch liebenswerter, dachte Holly. Und in einer Anwandlung von Aufrichtigkeit und mit vom Champagner gelöster Zunge, entschied sie, dass es wohl kein Fehler wäre, ihm in dieser zutraulichen Verfassung, während er entspannt im Taxi seinen Kopf an ihre Schulter sinken ließ, reinen Wein einzuschenken. Ihn in dieser, zugegeben etwas unglücklichen Situation mit dem Radfahrer, auf ihre Seite zu ziehen.
»Das ist meine Spezialität: mich tapfer zu schlagen. Habe dem Lawson gestern Paroli geboten. Der wollte mir glatt den Tod von einem Radfahrer anhängen.«
Sie war ihm die Wahrheit schuldig. Hatte sie gedacht. Sie lachte, als hätte Lawson ihr einen Lausbubenstreich gespielt. Aber William hob den Kopf und sah sie alarmiert an.
»Du hast einen umgebracht?«, donnerte er, plötzlich stocknüchtern.
Zu spät erkannte sie ihren Fehler.
3
Nicht sehr überraschend ging ihr die Arbeit am nächsten Montag nur zäh von der Hand. Eine unbekannte Lethargie verklebte ihre Adern. Eine Düsternis durchströmte sie, als sei sie an eine Infusion mit flüssigem Teer angeschlossen, und eine undeutliche, dafür sehr gefährliche Vorahnung. William hatte kaum mit ihr geschimpft, als sie ihm im Taxi nuschelnd die ganze Geschichte erzählte. In empörter Unantastbarkeit saß er neben ihr, bevor er entschied, sie nicht länger ertragen zu können. Mit gelöster Fliege und in verrutschtem Jackett war er am Trafalgar Square in ein anderes Taxi umgestiegen, was sich demütigender anfühlte, als habe er sie von seiner Bettkante geschubst.
»Denken. Ich muss nachdenken«, hatte er gesagt und konnte gar nicht schnell genug von ihr wegkommen.
Nun schlurfte sie durch die Räume der Notaufnahme, sprach mit halb heruntergelassenen Augenlidern und erntete bei ihren Patienten erstaunte Blicke.
»Auf was für einer Droge bist du denn?«, fragte Dolly und musterte sie bei der Übergabe scheel, bevor sie gemeinsam zu einem Untersuchungsraum gingen.
Dort saß eine zierliche Muslimin, die ihr blaues Auge vergeblich mit ihrem Shador zu verdecken suchte. Ihre Wangen waren mit Rinnsalen aus Wimperntusche verschmiert, doch ihre Augen groß und schön, wie dunkle Saphire.
»Ich habe den Mann rausgeschickt und die Sozialstation wegen häuslicher Gewalt benachrichtigt.« Dolly holte die Gipsverbände, während die Frau sich auf der Liege zurechtsetzte.
»Du kennst ihn schon?«, fragte Holly grimmig.
Sie ließ lauwarmes Wasser in eine Edelstahlschüssel laufen und setzte sie neben Dolly auf dem Rolltisch ab.
»Indische Landsleute. Sie sind Stammkunden hier. Alle paar Monate bringt er sie mit gebrochenen Knochen vorbei. Eigentlich ist sie auf Armgips abonniert. Ich habe ihr schon einen Unterarmgips rechts, dann links und einen Schultergips verpasst. Fühle mich wie ihre beschissene persönliche Schneiderin.«
»Psst, Dolly, sie kann dich doch hören.«
»Aber nicht verstehen, sie stammt aus Pakistan. Halt mal kurz.« Sie hob den rechten Fuß der Frau vorsichtig an und als Holly ihn übernahm, begann sie, die feuchten Gipsbinden ordentlich überlappend darum herumzuwickeln. »Arrangierte Ehe. Der Typ lässt sie nicht raus, das ist schlimmer als Knast.«
Sie lächelte der Frau zu, die schnell die Augen niederschlug und zusammenzuckte, als Dolly den Gips auf ihrem Knöchel verstrich. Sie raunte ihr ein paar beruhigende Worte zu, die Holly nicht verstand. Wusch sich die Hände und legte sie der Frau zum Abschied noch kurz auf die Schulter, als die Dame vom Sozialdienst hereinkam.
»Sie wird nicht lange im Frauenhaus bleiben«, sagte Dolly und seufzte, kaum dass die Patientin entlassen war. »Es ist sowieso voll wie ein Bienenstock. Die meisten Frauen dort sind weiße Britinnen, weißt du. Die alten Kelten haben schon immer gerne gesoffen und dann Baumstämme geworfen. Jetzt schubsen manche eben ihre Frauen und Kinder herum, lassen die Fäuste fliegen. Sie wird sich dort nicht wohlfühlen und zu ihrem Mann zurückgehen.«
»Die Kelten? Echt jetzt?«, sagte Holly amüsiert.
Dolly schnaubte bloß.
Es war ruhig geworden in der Notaufnahme. Sie setzten sich in den Aufenthaltsraum, der durch seine popelgrünen Wände scheußlich deprimierend wirkte, und tranken stark gezuckerten Beuteltee mit Milch.
»Schon irgendwas gehört?«, erkundigte sich Dolly.
Natürlich hatte Holly sie gleich am Sonntagmorgen angerufen und ihr die ganze Geschichte erzählt. Im Hintergrund hatten sich ihre Kinder, Rafik und Indira, gekabbelt, während Dolly ganz genau wissen wollte, was mit dem Radfahrer passiert war.
Danach hatte Dolly sie eingeladen, den Sonntag bei ihnen zu verbringen. Aber Holly wäre eine miserable Freundin, wenn sie deren harmonischen Sonntag mit ihren destruktiven Schwingungen störte.
»Hab schon was anderes vor«, sagte sie daher und zog sich eine ganze Staffel von Greys Anatomy rein. Da wurde auch in einem fort gestorben, was ihr eigenes Erlebnis ein wenig relativierte.
Manchmal fragte sie sich, wie sie diesen gefährlichen Beruf hatte ergreifen können. Nicht nur kamen immer wieder aggressive, betrunkene oder zugedröhnte Patienten in die Notaufnahme, die das Personal bedrohten und erst in Handschellen kleinbeigaben. Es schwebte immer diese Verantwortung für die Menschenleben über ihr, eine eigenartige Anspannung, die sich erst löste, wenn die Diagnose feststand, die Therapie eingeleitet wurde und die Patienten einen wehenden Vorhang und ein leeres, zerdrücktes Bettlaken hinterließen. Erst wenn sie ein Behandlungszimmer wiederherrichtete, fiel dieser Druck von ihr ab. Holly hatte sich schon öfters dabei ertappt, beim Aufräumen leise vor sich hin zu pfeifen.
Allerdings arbeiteten sie immer im Team. Es war noch nie vorgekommen, dass sie ganz allein mit einem sterbenden Patienten war. Dass ein Arzt sich geweigert hatte, sie zu unterstützen und ihr auch noch seinen eigenen Fehler anhängen wollte, schockierte sie und löste diese gefährlich summende, innere Unruhe in ihr aus.
Lydias gut frisierter Bubikopf schaute plötzlich durch die Tür in den Aufenthaltsraum.
»Holly, du sollst dich bei Mrs Honeysuckle melden.«
»Jetzt sofort?«
»Sofort!«
Holly stand auf und kippte den blassen Tee weg, der wie dünnflüssiger Eiter in den Ausguss gurgelte. Dolly nahm sie kurz in den Arm.
»Viel Glück«, flüsterte sie ihr zu und drückte sanft ihre Schulter. »Zeig’s ihr!«
Holly nickte nur und trat den Weg in die Chefetage an.
Mrs Honeysuckle war die Personalchefin und Williams direkte Vorgesetzte. Sie kannte sie nicht wirklich, hatte sie bisher nur von Weitem gesehen, seit sie ihren Posten in der Direktion vor zwei Jahren angetreten hatte. William schwärmte davon, wie effektiv, eloquent und durchsetzungsstark sie war. Holly kannte sein Faible für Tyrannen und fürchtete sich plötzlich sehr.
Mrs Honeysuckle ließ sie nicht in ihrem Vorzimmer schmoren. Sie bat Holly sofort in ihr Arbeitszimmer. Nichts könnte unpassender sein als dieser blumige Name, dachte Holly. Mrs Honeysuckle trug einen bleistiftfarben Tweedrock, schwarze Strümpfe und schwarze Schnürschuhe. Eine leichte Strickjacke in Anthrazit über schlichter, weißer Bluse. Ganz offensichtlich war das keine dem traurigen Anlass des Radlertodes geschuldete Kleidung, denn in einem Krankenhaus starben die Menschen trotz aller Bemühungen jeden Tag.
Sie schien nicht viel älter als Hollys Mutter zu sein. Wegen ihrer runden, graugekleideten Figur, der missmutig schwarzen Augen unter einem ungefärbten, schotterfarbenen Scheitel, wirkte sie wie ein unfreundlicher, großer Koala.
Holly betrat mir klopfenden Herzen Mrs Honeysuckles Büro.
Auf der linken Ecke ihres gut aufgeräumten Schreibtischs, hinter dem sie sogleich wieder Platz nahm, stand eine kleine Shakespeare-Büste. Eine nostalgische Welle erfasste Holly. Sie hatte vor Jahren eine euphorische Julia bei der Abschlussvorstellung ihrer Highschool gegeben.
»Sie mögen Shakespeare?«, wagte sie, in einem leicht verschwörerisch klingenden Tonfall zu fragen. Beinahe hätte sie ein verräterisches »auch« hinzugesetzt.
»Shakespeare?« Die Personalchefin sah sie irritiert an. »Nein, nicht besonders. Nie was von ihm gelesen, ehrlich gesagt. Aber er gibt einen ordentlichen Briefbeschwerer ab.«
»Oh. Nun, darüber hätte er sich gewiss gefreut«, sagte Holly und versuchte, ihre Enttäuschung zu verbergen, während sie sich auf den Stuhl vor dem Schreibtisch setzte.
»Wissen Sie, ich habe nichts übrig für Literatur. Nichts für ungut, aber von Shakespeare blieb von meiner Schullektüre nicht viel mehr als Der dumme Esel geht doch nicht schneller, wie du ihn auch prügeln magst hängen.«
Sie lachte.
Das konnte ja heiter werden. Holly wand sich ein wenig auf ihrem Stuhl, Mrs Honeysuckle räusperte sich.
»Es gab da diesen Vorfall. Freitagabend.«
»Sie meinen den Radfahrer.«
»Ich meine Oberarzt Dr. Lawson. Er hat sich offiziell über Sie beschwert.«
Holly verkrampfte die Finger um ihren Sitz. »Er hat was?«
»Eine Beschwerde eingereicht.«
»Worüber hat er sich denn beschwert?« Wut flammte in Holly auf. »Dass ich ihn bei seinem Schäferstündchen unterbrochen habe? Glauben Sie ihm kein Wort. Er ist erst lange, nachdem ich ihn habe ausrufen lassen, in der Notaufnahme aufgetaucht.«
»Sie haben ihn ausrufen lassen?«
Auch die Personalchefin kannte wohl das ungeschriebene Gesetz.
»Was sollte ich denn tun? Er war über den kritischen Zustand des Patienten unterrichtet und ist einfach nicht gekommen.«
»Er sagte mir, dass Sie es so schildern würden. Aber er wusste nichts von einer Verschlechterung.«
»Doch! Er ging noch einmal ans Telefon und da erzählte ich ihm von den Bauchschmerzen. Er sagte, er käme vorbei, aber offensichtlich wollte er erst sein Liebesspiel beenden.«
»Wie bitte?«
»Ich habe sie doch gehört. Eine Frau hat im Hintergrund gekichert.«
»Miss Higgins, Sie bewegen sich auf gefährlichem Terrain. Unter ihren Händen ist ein Patient gestorben! Der Oberarzt beschuldigt Sie eines organisatorischen Vergehens und Sie machen sexistische Bemerkungen?«
»Das sind keine Bemerkungen, das ist meine Aussage zum Ablauf der Geschehnisse. Gebe ich Ihnen auch gerne schriftlich.«
»In jedem Fall werden wir eine Klage wegen fahrlässiger Tötung an den Hals bekommen und ganz ehrlich, ich möchte nicht in ihrer Haut stecken.«
»In meiner Haut? Ich habe alles in meiner Macht Stehende getan, um den Patienten zu stabilisieren. Wäre der Oberarzt sofort gekommen, hätten wir ihn retten können.«
»Sie beschuldigen den Oberarzt?«
Holly dachte an all die schlüpfrigen Bemerkungen, die Hände und die unerwünschten Avancen, die sie in ihrem Berufsleben schon erdulden musste, ohne sich wehren zu können. Sie dachte an den herablassenden Kommandoton vieler Ärzte und ihre Unfähigkeit, dem Pflegepersonal wirklich zuzuhören. Daran, dass sie immer wieder Fehler machten und diese Kerle immer damit durchgekommen waren. Weil sie es alles ins Lächerliche zogen oder am längeren Hebel saßen.
»Ich beschuldige ihn. Ganz genau!«
»Tja, er hat mir gesagt, dass Sie Gift und Galle spucken würden, um sich von diesem Vorwurf reinzuwaschen.«
»Gift und Galle? Ha, dann haben Sie mich noch nicht in Form erlebt. Sie vertreten eine Klinik, die diesen sexistischen, verlogenen Schürzenjäger beschäftigt, der für sein Sexleben das Leben eines Mannes opfert. Schwarz auf weiß werde ich die Wahrheit ans Licht bringen und dann wird er seine Sachen packen müssen, dieser geile, alte Sack.«
Mrs Honeysuckle zog ihre rechte Augenbraue hoch, was ihr ein leicht dämliches Aussehen gab und Holly zum Lachen gebracht hätte, wäre sie nicht so wütend gewesen.
»Machen Sie sich auf disziplinarische Maßnahmen gefasst. Ihre Paranoia ist noch schlimmer, als von Dr. Lawson vermutet. Wäre ich Ärztin, würde ich Ihnen raten, sich behandeln zu lassen.«
»Sind Sie aber nicht, Sie fette Planschkuh!«, fauchte Holly und sprang auf.
Oh Gott, hatte sie das tatsächlich gerade gesagt?, dachte sie im nächsten Moment und biss sich auf die Lippe.
Mrs Honeysuckle blieb beängstigend ruhig. Auf ihre Stirn traten nun sorgenvolle, wenngleich akkurat gerade verlaufende Furchen.
»Es lastet ein hoher Druck auf Ihnen, das sehe ich«, sagte sie, als würde dies irgendetwas an der Situation ändern. »Ich werde versuchen, die Dinge so schnell wie möglich zu klären. Bis dahin sind Sie freigestellt, meine Gute.«
Mit unnachgiebigem Koalablick stand die Personalchefin von ihrem Stuhl auf und Holly verließ, bestürzt von so viel Kaltschnäuzigkeit, fluchtartig ihr Büro.
»Du hast sie Planschkuh genannt!«, rief Dolly begeistert und klatschte hüpfend in die Hände, wie ihre kleine Tochter Indira es immer tat, wenn sie sich freute. »Da hast du es ihr aber richtig gegeben.«
»Mach dich nur lustig, Doyita Bhatti«, maulte Holly und räumte weiter ihren Spind aus. »Ich bin beurlaubt und wahrscheinlich ist es nur eine Frage der Zeit, bis sie mich kündigt.«
Sie warf wütend ihr Ersatzdeo in den Rucksack.
»Sprich dich mit William aus. Der wird ein gutes Wort für dich einlegen. Und nach einer angemessenen Zeit kehrst du in eine andere Abteilung zurück.«
»Ich habe nichts falsch gemacht! Ich bin die Gute und ich will mich nicht für etwas demütigen lassen, was ein anderer ausgefressen hat. Ich sollte auswandern. Den Atlantik überqueren und so viele Seemeilen zwischen mich und diese Killer-Klinik bringen, wie es geht.«
»Amerika? Ganz schlechte Idee. Ich war mal mit einem Texaner zusammen. Das reinste Klischee. Er schlief mit seinem Cowboyhut und hatte grauenvolle Freunde. Dagegen ist der Ku-Klux-Klan die reinste Krabbelgruppe.«
»Ich brauche keinen neuen Freund, ich brauche neue Perspektiven. Neues Spiel, neues Glück«, sagte Holly und versuchte sich an einem missratenen Grinsen. Wie einfach es war und wie verlockend, ihre Situation in abgedroschene Phrasen zu kleiden.
»So eine Veränderung ist nichts für dich in deiner angeschlagenen Verfassung. Eine Bekannte von mir hat in der Notaufnahme in Detroit gearbeitet.«
»Raues Pflaster, oder?«
»Sodom und Gomorrha. Kaminbesteck in der Lunge. Mehrere Baseballs im Dickdarm. Abgesehen davon die tägliche Dosis Schuss- und Stichwunden.«
»Klingt nicht gerade nach Rehaklinik.«
»Ein Neugeborenes in einer Cornflakes-Packung hatten sie auch. Wurde eines Morgens im Eingangsbereich gefunden.«
»Tot?«, fragte Holly vorsichtig. Das Leben schien ihr zurzeit fragiler denn je.
»Nun ja, nicht ganz. Es lag in einer Familienpackung, die noch halb voll war. Das hat es vor einem Tod durch Unterkühlung bewahrt.«