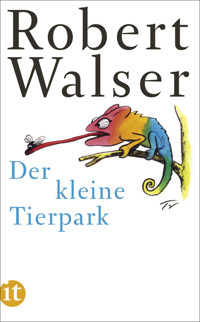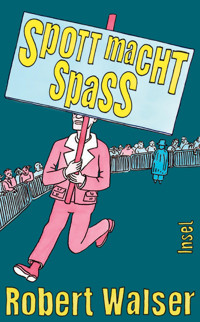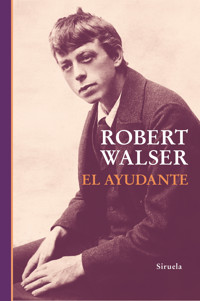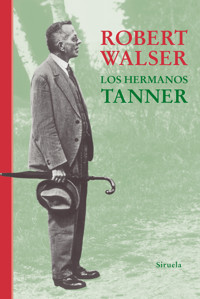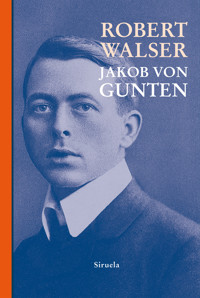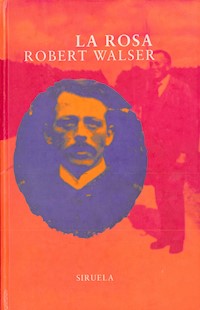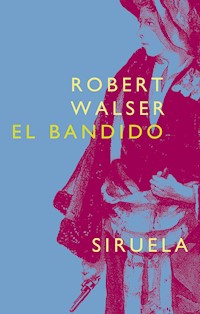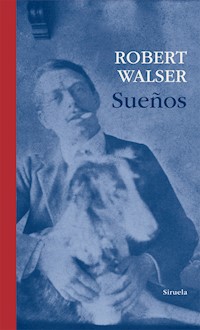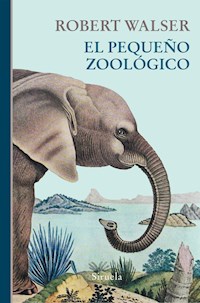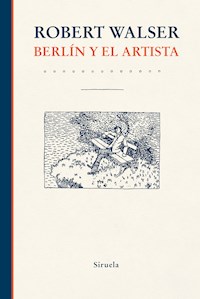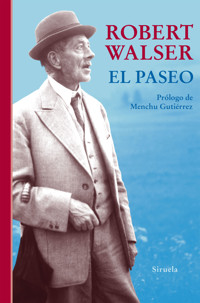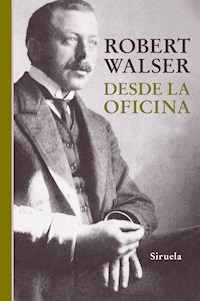11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Insel Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
In Berlin ist Robert Walser zum Schriftsteller geworden. 1905 zieht der gelernte Bankkaufmann in die deutsche Metropole, wo er drei Romane und über hundert Prosastücke veröffentlicht. Hermann Hesse und Robert Musil schreiben begeisterte Kritiken, Franz Kafka lacht sich krumm, wenn Walser die »Weltstadt« und ihre Exponenten porträtiert, wie etwa den Kunsthändler Paul Cassirer und dessen Tochter, »die kleine Berlinerin«.
Walsers schönste Geschichten aus und über Berlin zeichnen das Panorama einer pulsierenden Großstadt. Impressionistische Straßenszenen nebst scharfen Satiren auf den Kulturbetrieb, luzide Analysen einer bahnbrechenden Epoche nebst feinfühligen Berichten von der Schattenseite der Moderne: So poetisch war Sightseeing zwischen Friedrichstraße und Kurfürstendamm, zwischen Tiergarten und Charlottenburg noch nie.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 254
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Robert Walser
Die kleine Berlinerin
Geschichten aus der Großstadt
Mit einem Nachwort von Clemens J. Setz
Herausgegeben von Pino Dietiker und Reto Sorg
Insel Verlag
Inhalt
Das Theater, ein Traum
In der Provinz
Vier Späße
Guten Tag, Riesin!
Kennen Sie Meier?
Kutsch
Lüge auf die Bühne
Einer, der neugierig ist
Etwas über die Eisenbahn
Porträtskizze
Der Park
Vom Zeitungslesen
Fabelhaft
Aschinger
Gebirgshallen
Dinerabend
Feuer
Auf der Elektrischen
Markt
Über das russische Ballet
Friedrichstraße
Die kleine Berlinerin
Bedenkliches
Berlin und der Künstler
Die Großstadtstraße
Berlin W
Ein Schauspieler
Hose
Tiergarten
Blumentage
Kuhstall
Was aus mir wurde
Kino
Das Pferd und die Frau
»Geschwister Tanner«
Frau Wilke
Das Zimmerstück
Frau Scheer
Erinnerung an »Hoffmanns Erzählungen«
Frau Bähni
Besetzt
Der Sekretär
Heimkehr im Schnee
Negermelodien scheinen aus Florida herzustammen
Wie doch nun schon Adelina Patti
Für das Lebensbild des Kaisers Wilhelm
Diesen Aufsatz über Frank Wedekind
Einen Weltstadtaufenthalt nicht höher einzuschätzen
Weltstadt
Nachwort
Zu dieser Ausgabe
Textnachweise und Anmerkungen
Die kleine Berlinerin
Ich bilde mir ein, daß Berlin die Stadt sei, die mich entweder stürzen und verderben oder wachsen und gedeihen sehen soll. Eine Stadt, wo der rauhe, böse Lebenskampf regiert, habe ich nötig. Eine solche Stadt wird mir gut tun, wird mich beleben. Eine solche Stadt wird mich begünstigen und zugleich bändigen. Eine solche Stadt wird mir zum Bewußtsein bringen, daß ich vielleicht nicht gänzlich ohne gute Eigenschaften bin. In Berlin werde ich in kürzerer oder längerer Zeit zu meinem wahrhaftigen Vergnügen erfahren, was die Welt von mir will und was meinerseits ich selber von ihr zu wollen habe. Halb fühle und sehe ich es schon; aber es ist mir noch dunkel. Dort in Berlin wird es mir klar sein; dort in Berlin werde ich es eines Abends oder frühen Morgens mit erwünschter Deutlichkeit wissen. Es gilt zu handeln; zu wagen! In Berlin, mitten im Strudel und Getümmel und in all der Unruhe aufgeregten Weltstadtlebens, in angestrengter Geschäftigkeit und Tätigkeit, werde ich meine Ruhe finden.
Aus: Würzburg (1915)
Das Theater, ein Traum
Das Theater gleicht einem Traum. Im griechischen mag es anders gewesen sein; unseres ist von einem dachbedeckten, dunkeln Haus geheimnisvoll und fremdartig eingeschlossen. Man tritt hinein, tritt nach ein paar Stunden wie aus einem merkwürdigen Schlaf wieder heraus, an die Natur, in das wirkliche Leben, und ist dann dem Traum entflohen.
Im Traum haben die Bilder, die einem vor dem Auge entstehen — es mag das Auge der Seele sein —, etwas Scharfes, Festgezeichnetes. Raumhaft natürliche Perspektiven, einen realen Erdboden, frische Luft gibt es da nicht. Man atmet Schlafstubenluft, während man über Berge schreitet wie der Mann mit den Siebenmeilenstiefeln. Es ist alles verkleinert, aber auch verschrecklicht im Traum; ein Gesicht hat meistens einen erschütternd bestimmten Ausdruck: furchtbar süß, wenn es ein süßes und wohlwollendes, furchtbar abstoßend, wenn es ein Furcht und Entsetzen einflößendes ist. Im Traum haben wir die ideale dramatische Verkürzung. Seine Stimmen sind von einer entzückenden Schmiegsamkeit, seine Sprache ist beredsam und zugleich besonnen; seine Bilder haben den Zauber des Hinreißenden und Unvergeßlichen, weil sie überwirklich, zugleich wahr und unnatürlich sind. Die Farben dieser Bilder sind scharf und weich zugleich, sie schneiden mit ihrer Schärfe ins Auge wie geschliffene Messer in Äpfel und sind einen Moment nachher schon wieder zerflossen, so daß man oft, träumend sogar, bedauert, dieses und jenes so schnell verschwinden zu sehen.
Unser Theater gleicht einem Traum, und es hat alle Ursache, ihm noch ähnlicher zu werden. In Deutschland will alles umwoben und umschlossen sein, alles will ein Dach haben. Die armen, pompösen Bildhauerwerke in unseren Gärten sogar sind Träume; aber in der Regel erfrorene. Es ist eine bekannte Tatsache, wie schlecht uns öffentliche Monumente gelingen. Wir sind talentlos in der luftumflossenen Freiheit. Wir treten lieber in ein liebes, traumhaft seltsames Haus, wo uns unsere wahre Luft und Natur entgegenkommen. Warum gelingen uns die Weihnachtsfeste so schön, warum sind wir glücklich, in einer warmen Stube zu sitzen und es draußen in der Straße schneien, winden, wettern oder regnen zu sehen? Wir sind so gern in dunkeln, nachdenklichen Löchern. Nicht diese Vorliebe ist eine Schwäche; unsere Schwäche besteht vielmehr darin, uns solcher Vorliebe zu schämen.
Sind nicht auch die Dichtungen Träume, und ist denn die offene Bühne etwas anderes als ihr großgeöffneter, wie im Schlaf sprechender Mund? Während des anstrengenden Tages treiben wir in den Straßen und Lokalen unsere Geschäfte und nützlichen Absichten vor uns her, und dann finden wir uns in den engen Sitzreihen wie in engen Betten zum Schauen und Hören ein; der Vorhang, die Lippe des Mundes, springt auf, und es brüllt, zischt, züngelt und lächelt uns befremdend und zugleich herzensvertraulich an; es setzt uns in eine Erregung, deren wir uns nicht bemeistern mögen und können, es macht uns krümmen vor Lachen oder erbeben vor innerlichem Weinen. Die Bilder flammen und brennen vor den Augen, die Figuren des Stückes bewegen sich übernatürlich groß, wie nie gesehene Gestalten, vor uns. Das Schlafzimmer ist dunkel, nur der offene Traum glänzt in dem starken Licht, blendend, redend, daß es einen zwingt, mit offenem Munde dazusitzen.
Wie melodiös sind Farben im Traum! Sie scheinen Gesichter zu werden, und plötzlich droht, schluchzt, singt oder lächelt eine Farbe; ein Fluß wird zu einem Pferd, und das Pferd will mit seinen behuften Füßen eine enge Treppe emporsteigen, der Reiter zwingt es, man verfolgt ihn, man will ihm das Herz aus dem Leib reißen, man kommt näher, aus der Ferne sieht man die Mörder herstürmen, namenlose Angst packt einen an — der Vorhang sinkt. Ein Erdbeben ist auf einem städtischen Platz, die Häuser sinken schräg nach vorn, die Luft ist wie mit Blut bespritzt, feurig-rote Wunden hängen überall; Menschen schießen ihre Gewehre ab, sie wollen mit der Natur im Mord wetteifern; dazu ist der Himmel von einem süßen Hellblau, aber er liegt ganz kindlich über den Häusern, wie ein gemalter Himmel. Das Bluten ist wie Werfen mit kleinen Rosen; die Häuser fallen immer und stehen doch, und es ist immer ein entsetzliches Geschrei und Büchsengeknall und ist doch keines. O, wie der Traum göttlich schauspielert! Er gibt vom Entsetzlichen das unanfechtbar reine Bild wie vom Süßen, Beklemmenden, Wehmutvollen oder Erinnerungsbangen. Zu den Empfindungen, Personen und Tönen malt er sofort Schauplätze, zu dem süßen Geplauder einer edlen Frau deren Gesicht, zu den Schlangen die seltsamen Kräuter, worunter sie grauenhaft hervorkriechen, zu dem Geschrei von Ertrinkenden die schwermutvolle abendliche Fluß- und Uferlandschaft, zum Lächeln den Mund, der es ausdrückt.
Aus dunkelgrünen Gebüschen hängen weiße Antlitze hervor, eine Bitte, eine Klage oder einen Haß in den schrecklich klaren Augen. Manchmal sehen wir nur Züge, Linien, manchmal nur Augen; dann kommen die blassen Züge und umrahmen die Augen, dann die wilden, schwarzen Haarwellen und begraben das Gesicht; dann ist es wiederum nur noch eine Stimme, dann geht eine Tür auf; es stürzen zweie herein, man will erwachen, aber unerbittlich dauert das Hereinstürzen fort. Momente gibt es im Traum, deren Erinnerung wir im Leben nie vergessen können.
So wirkt auch das Theater mit seinen Gestalten, Worten, Lauten, Geräuschen und Farben. Wer möchte zu einer holdseligen Liebesszene den üppig verwachsenen Garten vermissen, zu einem Mord die dunkle Wand der Gasse, zu einem Schrei das Fenster, durch welches er ausgestoßen werden kann, zum Fenster die zärtlich und frauenhaft weiße Gardine, die es verfenstert und verzaubert und wieder vernatürlicht? Schneelandschaften, nächtliche, liegen auf der Bühne, daß man glauben sollte, sie erstrecken und dehnen sich meilenweit; ein Eisenbahnzug mit rötlich schimmernden Waggonfenstern zieht vorüber, ganz langsam, als zöge und winde er sich in weiter Ferne, wo das Schnelle dem Auge nicht schnell entfliehen will. Ferne und Nähe sind im Theater dicht nebeneinander. Zwei Schurken flüstern immer zu laut; der edle Herr hört alles, und er stellt sich doch ahnungslos. Das ist das Traumhafte, das wahre Unwahre, das Ergreifende und zu guter Letzt das Schöne. Wie schön ist es, wenn zwei Kerle laut brüllend miteinander flüstern, während des andern Gesichtszüge sagen: wie still ist es rings umher!
Solches ähnelt den grausigen und schönen Gesichten im Traum. Die Bühne setzt alles daran, zu erschrecken; sie tut gut daran, das zu beabsichtigen, und wir tun gut, das Etwas in uns zu hüten, das uns den Genuß und den Schauder dieses Schreckens noch empfinden läßt.
(1907)
In der Provinz
Ja, in der Provinz, da kann es der Schauspieler etwa noch schön haben. Dort, in den kleinen Landstädtchen, die noch von alten Ringmauern trotzig umschlossen sind, gibt es keine Premieren und keine fünfhundertste Aufführung ein und desselben Salates. Die Stücke wechseln mit den Tagen oder Wochen wie die blendenden Toiletten einer geborenen Fürstin, die zornig würde, wenn einer ihr zumuten wollte, jahrelang immer dasselbe Kleid zu tragen. Auch keine solche schnauzige Kritik gibt es in der Provinz, wie dergleichen der Schauspieler in den Weltstädten zu ertragen hat, wo es nichts mehr Ungewöhnliches ist, mit anzusehen, wie der Künstler von oben bis unten von grimmigen Witzen wie von wütenden Hunden zerrissen wird. Nein, in der guten, ehrlichen Provinz wohnt erstens der Mann mit der Maske vor dem Gesicht im Hôtel de Paris, allwo es toll und urgemütlich zugeht, und zweitens lädt man ihn etwa noch zu Abendgeselligkeiten ein, in feine, alte Häuser, wo es ein ebenso wohlschmeckendes Essen wie eine delikate Unterhaltung mit den ersten Personen der Kleinstadt gibt. Zum Beispiel meine Tante in Madretsch, die gab es nie und nimmermehr zu, daß von den Komödianten in unziemlichem, wegwerfendem Ton geredet wurde, im Gegenteil, nichts war ihr angenehmer und erschien ihr passender, als zum Abendessen, dessen Zubereitung sie selber beaufsichtigte, jede Woche einmal mindestens, so lange sie in der Stadt spielten, diese umherziehenden Leute recht lustig und fidel bei sich zu sehen. Meine Tante, die jetzt gestorben ist, war eine geradezu schöne Frau, auch noch zu einer Zeit, wo andere Frauen beginnen, ältlich und runzelig zu werden. Mit ihren fünfzig Jahren schien sie noch eine der allerjüngsten zu sein, und während in ihrer Umgebung die Frauen plumpe, mißförmige Figuren zur Schau trugen, zeichnete sie sich durch eine feste, üppig-schlanke Körperform zu ihrem eigenen, sehr großen Vorteil aus, daß sie jedermann, der sie ansah, für schön erklären mußte. Nie vergesse ich ihr helles, zartes Gelächter und nie den Mund, aus dessen reizender Öffnung das Lachen heraustönte. Sie wohnte in einem seltsamen, alten Haus; wenn man die schwere Tür auftat und eintrat, in den stets dunkeln Korridor, lispelte einem das Plätschern eines unaufhörlich fallenden Brunnens entgegen, der kunstreich in die Mauer eingefügt worden war. Die Treppen und deren Geländer strotzten und dufteten förmlich von Sauberkeit, und erst die Zimmer. Ich habe nie nachher wieder solche Zimmer gesehen, solche heitere, polierte, zimmerliche Zimmer. Ich glaube, wenn ich mich nicht irre, man sagt Gemach, wenn man von einem Zimmer redet, das traulich und zugleich äußerst vornehm und etwas altertümlich ausgestattet ist. In einem solchen Hause, bitte ich zu beachten, dürfen also in der Provinz Bühnenkünstler aus- und eingehen, dürfen solche Treppen mit ihren wahrscheinlich manchmal ungeputzten Stiefeln berühren, solche Klinken, messingene und rasend peinlich glänzende, mit ihren Händen anfassen, um in solche Gemächer hineinzutreten, und dann einer solchen Frau, wie meiner Tante, ungezwungen guten Abend zu sagen. Was tut der Schauspieler in der Großstadt? Er schuftet, läuft wie wahnsinnig in die Proben und reibt sich auf, um es ja der säuerlichen Kritik recht zu machen. So etwas gibt es in der Umgegend von Madretsch nicht, meine Damen und Herren. Von Kranksein und Aufreiben wird da kaum die Rede sein dürfen, vielmehr bummelt so ein Kerl, den Zylinder, den er weiß der Himmel woher hat, auf dem Kopf, die Hände in womöglich hellgelben Handschuhen, den Stock in der Rechten, in einem tragischen Mantel, dessen Schöße im Winde flattern, so gegen elf Uhr vormittags oder halb zwölf, um nicht gelogen zu haben, seelenheiter und von allen Passanten auf der Straße für einen illegitimen Fürstensohn gehalten, angeblinzelt von Mädchenaugen, die schöne Promenade entlang, um vielleicht zum See hinauszugehen und dort eine halbe Stunde lang, bis es Zeit zum Essen ist, in die Ferne zu schauen. Das, meine Herren, verschafft Appetit, ist gesund und wohl etwa noch zu ertragen. Wo gibt es in der Großstadt einen See, einen Felssturz, dessen Gipfel von einem im griechischen Stil erbauten, niedlichen Pavillon gekrönt wird, wo man in der hellen Vormittagssonne mit einer Frau, die man eben hat kennen lernen und die, sagen wir mal, dreißig Jahre alt ist, ein seelenvolles Gespräch führen kann? Wo gibt es ein Schulhaus in Weltstädten, in das der Herr jugendlicher Liebhaber, Herr von Beck, so gegen drei Uhr, weil er gerade Lust zu einem solchen Unternehmen hat, eintreten und den kleinen neun- bis zwölfjährigen Schulmädchen einen Schulbesuch abstatten kann? Es ist gerade Religionsstunde, die Mädchen langweilen sich ein bißchen, da tritt Beck ein und frägt an, ob ihm wohl gestattet wäre, dem ihn im höchsten Grade interessierenden Unterricht beizuwohnen. Der Pfarrer, ein durchaus weltmännisch gebildeter, sympathischer Herr, errötet über die Keckheit und weiß nicht recht, was er sagen soll, im ersten Augenblick nämlich, wo ihm die Heldenmanieren eines von Beck den Verstand rauben. Aber schon hat er sich gefaßt und schiebt den Darsteller des Ferdinand in Kabale und Liebe sanft zur Tür hinaus, wohin er ja schließlich, wenn man die Umstände bedenkt, auch gehört. Aber, Hand aufs Herz, ist das etwa nicht reizend, und gibt's in Millionenstädten etwas Derartiges? Wie hübsch dieser Herr Pfarrer gehandelt hat, Herrn Beck zu verbieten, in der edlen Religionsstunde mit den Schülerinnen Allotria zu treiben. Aber wie entzückend wiederum dieser Beck ist, der den Pfarrer zu dem liebenswürdigen Benehmen veranlaßt hat; denn wenn es keine Becks gäbe, die die Unverschämtheit besitzen, den Schulaufsichtsrat zu spielen, am hellen Tag, wo die Sonne überall scheint und es in ganz Madretsch nach Käsekuchen duftet, so gäbe es auch kein pfarrerlich-schönes Betragen, wie denn Spitzbuben nicht fehlen dürfen, wo man noch hoffen will, Tugenden anzutreffen. Solche Dinge ergeben sich in einer Kleinstadt von selber; das reizende Erlebnis nimmt dort noch gern plastische Gestalt an, und wer eignet sich in der Provinz besser zu Erlebnissen aller Art als die Lumpenkomödianten, denen der Ruf des Gefährlichen, Schönen, Geheimnisvollen und Abenteuerlichen immer vorangeht? Da sieht sie der Bewohner von Bözingen oder Mett oder Madretsch in Gruppen vor dem Rathause stehen, gestikulierend und in fremdartigen, eleganten Akzenten sprechend, die Rollen, die sie abends spielen, in den blassen durchgeistigten Händen, so wildfremd, so sehr scheinbar aus Königsschlössern und Mätressenboudoirs herkommend, mit so schönen, hohen Stirnen und mit wenn immer denkbar goldenen Haarlocken! Kann der hauptstädtische oder gar reichshauptstädtische oder gar noch literarische Schauspieler diese Genugtuung auch genießen, eine wildfremde Figur auf Straßen, Plätzen und Promenaden zu sein? Kann er überhaupt auch nur noch tiefer und inniger interessieren, als was auf fünf Spalten im Lokalanzeiger gedruckt paßt? Und wenn er gar berühmt ist und viel genannt wird, was ist das? Ich muß geradezu lächeln, daran zu denken, wie oberflächlich das Interesse im Laufe der Jahre wird, das man Berühmtheiten zollt. Nein und noch einmal nein. Wer gern mag, daß ihm eine rote, warme, saftvolle, gequetschte, spritzende, sprühende und duftende Empfindung dargebracht wird, der werde so rasch wie möglich Schmierenschauspieler. Das bißchen finanzielle und ökonomische Elend, das mit diesem Berufszweig ja allerdings immer verbunden sein wird, ist zu ertragen. Ich mache gern noch auf ein paar Einzelheiten aufmerksam: Schauspieler Beck wird eines Nachts von einem unkultivierten Burschen einfach mir nichts dir nichts Hundsfott genannt. Das ist allerdings starker Schnupftabak. Beck stürzt vor, und beide, der lümmelhafte Sohn des Uhrenfabrikanten und das zierliche Söhnchen der dramatischen Kunst packen einander am beiderseitigen Stehkragen, an den Haaren, beim Genick, am Schopf, bei den Nasen, an den Lippen und Ohren, unterm Knie, rund um die Leiber, um den Kampf zweier erzürnter Gottheiten aufzuführen. Auch nicht denkbar in Reichsmetropolen, wo die Menschen anfangen, so windig gesittet zu werden und ihren Zorn immer in die Taschen stecken, wenn zu befürchten ist, daß er losbrennen will. Im Hôtel de Paris sind immerhin noch ganz andere Sachen möglich. Dort küßt man beispielsweise den Kellnerinnen die Hände, so fein sind sie, und plaudert englisch mit der Leiterin des Geschäfts am Buffet, so lange, bis einer kommt und einem von hinten her quer eins hinüberhaut, bis man genug hat. Und dann die Natur in Kleinstädten. Das ist nun geradezu die Wunderquelle, in der sich Karl Moor bis zum Strotzen gesund baden kann, denn überall lockt's ihn, in Schluchten zu gehen, in denen Wasserfälle schäumend und zischend und kühlend niederbrausen; über ebene, weite Felder bis an den Rand mächtig-hoher und grüner Eichenwälder; über Waldhügel hinüber, allwo er Blumen suchen und sie in seine Botanisierbüchse stecken kann, um sie zu Hause in ein Glas Wasser zu tun; auf breite, tausend Meter hohe Berge, entweder zu Fuß oder zu Roß, wenn er eins auftreiben kann, oder per Drahtseilbahn, zu der entzückend gelegenen Weide mit ihrer Blumen- und Gräserpracht, bis er am Abend, erschöpft und erfüllt von schönen, müden Empfindungen, unter einer hundertjährigen Tanne in die Matte sinkt, um den herrlichen Sonnenuntergang zu betrachten. In Krächen und Schluchten liegt noch der winterliche Schnee, obgleich es schon toller, üppiger Frühling ist. Oder es lockt ihn, in eine leichte, schwankende Gondel zu steigen, die zu haben ist bei Frau Hügli, Schiffsvermieterin, dicht am Ufer des Sees, und aufs schöne, spiegelglatte Wasser hinauszufahren, zwischen knirschenden Schilfgewächsen hindurch, bis er in der Mitte des Sees angelangt ist und, die Ruder fahren lassend, sieht, wie köstlich die Rebberge und Landhäuser und kleinen Jägerschlösser sich im tiefen Wasser naturgetreu widerspiegeln. Und so noch vieles, und zu allen Jahreszeiten, im Winter, Herbst, Sommer und Frühling. Die Natur ist bekanntlich in allen ihren Verkleidungen erfrischend und bezaubernd und immer des ganz und gar innigen Ansehens und Genusses wert. Geht in die Provinz, in Kleinstädte; dort habt ihr noch Hoffnung, daß man euch an euerm Benefizabend einen Lorbeerkranz vor die Füße und Nase wirft, den ihr dankend aufheben und freudig nach Hause tragen könnt. Den schauspielenden Damen nicht minder als den Herren sind diese Städte zu empfehlen, auch sie werden sehr bald finden, daß ich nicht unrecht gehabt habe, ihnen anzuraten, es einmal wieder mit der Provinz zu versuchen. Zu guter Letzt: Es wird gut gekocht an solchen Orten, und es muß ratsam erscheinen, bald einmal hinzugehen und diese vortreffliche Kost zu probieren. Schmackhaftes Essen ist nicht zu verachten.
(1907)
Vier Späße
1.
Bei Wertheim, zu oberst, dort, wo man Kaffee trinkt, ist gegenwärtig etwas Köstliches zu sehen, nämlich der dramatische Dichter Seltmann. Er hockt auf einem kleinen Rohrstuhl auf erhöhtem Gestell, allen Blicken eine leichte Zielscheibe, hämmert und nagelt und klopft in einem fort und schustert, wie es denen vorkommt, die ihn betrachten, Blankverse. Das kleine, viereckige Gestell ist mit dunkelgrünen Tannenzweigen geschmackvoll bekränzt. Der Dichter ist anständig angezogen worden, Frack, Lackschuh und weiße Binde, das alles ist da, und keiner wird sich zu genieren haben, dem Mann seine Aufmerksamkeit zu schenken. Das Wunderbare aber ist der rostgelbe, herrliche Haarsturz, der sich von Seltmanns Kopf, über die Schulter weg, mächtig bis an den Fußboden niederwölbt. Er gleicht der Mähne eines Löwen. Wer ist Seltmann? Wird er uns von der Schmach befreien, unser Theater etlichen Salpeterfabriken ausgeliefert zu wissen? Wird er das nationale Schauspiel schreiben? Wird er uns eines Tages als der Kerl erscheinen, nach dem wir uns jetzt alle wieder mal so blutwürstig sehnen? Jedenfalls aber muß man der Leitung des Warenhauses Wertheim für die Ausstellung Seltmanns Dank wissen.
2.
Wie dem Theater allmählich die besten und gediegensten Kräfte dahinschwinden, geht zu unserm großen Leidwesen aus einer Zuschrift hervor, die Frau Gertrud Eysoldt an uns adressiert hat. Sie teilt uns mit, daß sie an der Kantstraße, Ecke Joachimsthaler Straße, nächstens einen Korsettladen eröffnen werde, um sich allda gänzlich als Geschäftsfrau zu etablieren. Welch sonderbarer Entschluß, und wie schade! Auch Schauspieler Kayßler will wegmachen, und zwar, wie wir hören, aus der Empfindung heraus, daß es sich in die Zeitläufe besser schicke, hinter einem Schanktisch zu stehen, als Figurinen auf den Brettern zu spielen. Er soll zum ersten Mai eine kleine Kneipe im Osten übernommen haben, und er freut sich schon darauf, sagen einige, Bier einzuschenken, Gläser zu putzen, Butterbrote zu streichen, Bücklinge zu servieren und nachts die Besoffenen zur Bude herauszustiefelwichsen. Ein Jammer! Wir aber müssen aufs tiefste bedauern, zwei so sehr bewunderte und wertgeschätzte Künstler ihrer Kunst untreu werden zu sehen, und wir wollen hoffen, daß solches nicht Mode werde.
3.
In den Kammerspielen ist noch kurz vor Toresschluß eine kleine Änderung getroffen worden. Die Direktion hat den Dramaturgen kleidsame hellblaue Fräcke übergeworfen, mit großen, silbernen Knöpfen dran. Wir halten das für hübsch, denn wir halten's für richtig. Die Theaterdiener sind abgeschafft worden, und die Dramaturgen nehmen nun an den Spielabenden, also zu einer Zeit, wo sie ja sowieso nichts zu tun haben, den Damen die Mäntel ab und weisen den theaterbesuchenden Herrschaften die Plätze an. Auch öffnen sie Türen und geben allerhand kleine, aber notwendige Auskünfte. An den Beinen tragen sie jetzt lange, dicke, ledergelbe, kniehohe Getern, auch können sie einem schon ganz ausgezeichnet, unter einer eleganten Verbeugung, Programme darreichen und Guckgläser anbieten. In der Provinz würden sie außerdem noch Zettel vertragen; dies ist aber hier in Berlin nicht nötig. Kurz und gut, kein Kritiker wird nunmehr noch fragen dürfen, was ein Dramaturg sei, und was er für Obliegenheiten zu erfüllen habe. Sie tun jetzt ihr Äußerstes, und man wird sie in Zukunft in Ruhe lassen müssen.
4.
Um endlich einmal dem ewigen Gejammer und den beständigen Vorwürfen, er gebe nur Ausstattungen, keine Stücke, energisch auszuweichen, ist Direktor Reinhardt auf die Idee gekommen, zukünftig seine Stücke einfach vor weißer Wäsche spielen zu lassen. Seine Dramaturgen haben natürlich das Geheimnis bereits ausplaudern müssen, und er wird erstaunt, wenn nicht entrüstet sein, uns schon heut mit der Neuigkeit auftrompeten zu sehen. Weiße Wäsche! Muß es denn gerade schneeweiße sein? Kann sie nicht von irgendeiner unbekannten Riesendame aus dem Panoptikum, sagen wir, etwa anderthalb Tage lang getragen worden sein? Alsdann würden die Dekorationsstücke einen sicherlich bezaubernden Schenkelduft ausströmen, was den Herren Kritikern nur gut tun könnte, die dann vergäßen, wo sie säßen, und betäubt würden in ihren schärfern Sinnen. Ohne Spaß. Reinhardts Idee scheint uns entwicklungsfähig, also glänzend. Auf den weißen Tüchern werden sich die Gesichter und Spukgestalten der Akteure und Aktricen außerordentlich farbig abheben. Ob Reinhardt das aber auch am Hoftheater durchsetzen wird?
(1907)
Guten Tag, Riesin!
Es ist einem, als schüttle da eine Riesin ihre Locken und strecke ein Bein zum Bett heraus, wenn man am frühen Morgen, noch ehe die Elektrischen fahren, von irgendeiner Pflicht angetrieben, in die Weltstadt hineingeht. Kalt und weiß liegen die Straßen wie ausgestreckte Menschenarme da; man läuft, reibt sich die Hände und sieht, wie zu den Toren und Türen der Häuser Menschen heraustreten, als speie ein ungeduldiges Ungeheuer seinen warmen, flammenden Speichel aus. Augen begegnen dir, wenn du so dahergehst, Mädchen- und Männeraugen, trübe und frohmütige; Beine laufen hinter und vor dir, und du selber beinelst auch, was du nur kannst und schaust mit deinen eigenen Augen, mit denselben Blicken, wie alle blicken. Und die Brüste tragen alle irgendein verschlafenes Geheimnis, und in den Köpfen allen spukt irgendein wehmütiger oder anspornender Gedanke. Herrlich, herrlich. Da ist es also kalter, halb sonniger, halb trüber Morgen, viele, viele Menschen liegen noch in ihren Betten, Schwärmer, die die Nacht und den halben Morgen durchgelebt und -geabenteuert haben, Vornehme, zu deren Lebensgewohnheiten es gehört, spät aufzustehen, faule Hunde, die zwanzigmal erwachen, gähnen und wieder einschnarchen, Greise und Kranke, die sich überhaupt nicht mehr, oder nur mühsam erheben können, Frauen, die geliebt haben, Künstler, die sich sagen: a was, quatsch, früh aufstehen, Kinder von reichen, schönen Eltern, fabelhaft gepflegte und behütete Wesen, die in ihren eigenen Stuben, hinter schneeweißen Fensterumhängen, das Mündchen offen, märchenhaft träumend, bis neun, zehn oder elf Uhr schlafen. Was zu solch früher Morgenstunde auf den wild ineinander verschlungenen Straßen gramselt und ameiselt, das sind, wenn nicht Dekorationsmaler, so doch vielleicht Tapezierer, Adressenschreiber, kleine, lausichte Agenten, Menschen auch, die einen frühen Eisenbahnzug nach Wien, München, Paris oder Hamburg erreichen wollen, kleine Menschen in der Regel, Mädchen von allen möglichen Erwerbszweigen, Erwerbende also. Einer, der dem Rummel zusieht, muß das notwendigerweise einzig finden. Er geht dann so und meint beinahe, auch rennen, atempusten und seine Arme hin und her schwenken zu müssen; das Treiben und Emsigtun ist ja so ansteckend, wie etwa ein schönes Lächeln ansteckend sein kann. Nein, nicht so. Der frühe Morgen ist noch etwas ganz anderes. Er schleudert aus Kneipen etwa noch ein paar schmierig gekleidete Nachtgestalten mit ekelhaft rotbemalten Gesichtern auf die blendend-staubig-weiße Straße hinaus, wo sie eine gute Weile, den Hakenstock an der Schulter tragend, blödsinnig stehen bleiben, um Vorübergehende anzuöden. Wie ihnen die trunkene Nacht zu den schmutzigen Augen hinausblendet! Weiter, weiter. Bei Besoffenen hält sich das blauäugige Wunder, der frühe Morgen, nicht auf. Er hat tausend schimmernde Fäden, womit er dich weiterzieht, er schiebt dich von hinten und lockt und lächelt dich von vorne an, du siehst hinauf, wo ein weißlich verschleierter Himmel ein paar zerrissene Stücke Blau hervorläßt; hinter dich, um einem Menschen, der dich interessiert, nachzuschauen, neben dich, an ein reiches Portal, hinter dem ein fürstliches Palais verdrossen und vornehm emporragt. Statuen winken dir aus Gärten und Parkanlagen entgegen; immer gehst du und hast flüchtige Blicke für alles, für Bewegliches und Feststehendes, für Droschken, die träge fortrumpeln, für die Elektrische, die jetzt zu fahren beginnt, von der herab Menschenaugen dich ansehen, für den stupiden Helm eines Schutzmannes, für einen Menschen mit zerrissenen Schuhen und Hosen, für einen zweifellos ehemals Gutsituierten, der im Pelzmantel und Zylinder die Straße fegt, für alles, wie du selber für alles ein flüchtiges Augenmerk bist. Das ist das Wunder der Stadt, daß eines jeden Haltung und Benehmen untertaucht in all diesen tausend Arten, daß das Betrachten ein flüchtiges, das Urteil ein schnelles und das Vergessen ein selbstverständliches ist. Vorüber. Was ist vorüber? Eine Fassade aus der Empirezeit? Wo? Da hinten? Ob sich da einer wohl entschließen kann, sich nochmals umzudrehen, um der alten Baukunst einen Extrablick zu schenken? I woher. Weiter, weiter. Die Brust dehnt sich, die Riesin Weltstadt hat jetzt in aller üppigen Gemächlichkeit ihr schimmernd-durchsonntes Hemd angezogen. So eine Riesin kleidet sich eben ein bißchen langsam an; dafür aber duftet und dampft und pocht und läutet jede ihrer schönen, großen Bewegungen. Droschken mit Amerikakoffern obenauf poltern und radebrechen vorbei, du gehst jetzt im Park; die stillen Kanäle sind noch mit grauem Eis bedeckt, die Matten frieren dich an, die schlanken, dünnen, kahlen Bäume jagen dich mit ihrem zitternd-frörlichen Aussehen flugs weiter; Karren werden geschoben, zwei herrschaftliche Fuhrwerke aus der Remise irgendeines Menschen von offiziellem Gepräge, jedes zwei Kutscher und einen Lakaien tragend, jagen vorüber; immer ist etwas und jedesmal ist das Etwas, wenn man es näher betrachten will, verschwunden. Natürlich hast du eine Unmenge Gedanken während deines einstündigen Marsches, du bist Dichter und kannst dazu ruhig deine Hände in den Taschen deines hoffentlich anständigen Überziehers behalten, du bist Maler und hast vielleicht bereits während deines Morgenspazierganges fünf Bilder fix und fertig gemacht. Du bist Aristokrat, Held, Löwenbändiger, Sozialist, Afrikaforscher, Tänzer, Turner oder Kneipenwirt gewesen, hast flüchtig geträumt, eben jetzt dem Kaiser vorgestellt worden zu sein. Er ist vom Thron herniedergestiegen und hat dich in ein halbstündiges, vertrauliches Gespräch, an welchem sich auch die Frau Kaiserin dürfte beteiligt haben, gezogen. Du bist in Gedanken Stadtbahn gefahren, hast Dernburg seinen Lorbeerkranz vom Haupte gerissen, geheiratet und dich in einer Ortschaft in der Schweiz heimisch niedergelassen, ein bühnenfähiges Drama geschaffen — lustig, lustig, weiter, he da, was? Sollte das? Ja, da ist dir dein Kollege Kitsch begegnet, und da seid ihr zusammen nach Hause gegangen und habt Schokolade getrunken.
(1907)
Kennen Sie Meier?
Meier mit ei geschrieben? Nicht? Nun, in diesem Falle möchte ich mir erlauben, Sie auf diesen Mann ergebenst aufmerksam zu machen. Er tritt gegenwärtig im Café Bümplitz auf, das, ich weiß nicht mehr genau, in welcher Straße liegt. Dort, inmitten schlechten und unpassenden Tabakqualms, roher Worte und zuklappender Bierglasdeckel, spielt er Abend für Abend, bis ihn eines Tages vielleicht eine kluge Direktion abholen will, woran ich eigentlich keinen Augenblick zweifle, daß es nächstens geschehen wird. Dieser Mann, dieser Meier, dieser Kerl ist ein Genie. Nicht nur, daß er einen lachen machen kann, wie zwanzige in ihrem zusammenaddierten Leben nicht lachen können, zum Zerplatzen, was sage ich, zum Zusammenkugeln, was da, zum Sterben, o Tölpel, keinen bessern Vergleich aus deinem Schriftstellerkopf heraussteinklopfen zu können, nicht nur, daß sondern daß, bin ich konfus, ja, ganz recht, sondern daß ihm auch die ganz natürliche Aufreizung des tragischen Schauders nichts Unmögliches, sondern eine nur allzu leichte Sache ist. Bin ich eigentlich mit meinem Satz fertig oder nicht? Wenn nicht, so ist's gerade eine schöne Sache zum Fortfahren.
Meier trägt auch Couplets vor mit einer fabelhaften Wurstigkeit, und die Sprache, die er dazu spricht, ist wohl die unanfechtbarste, die es gibt, da er sie gleichsam, Brocken auf Brocken, fallen läßt, daß einer, der zuhorcht, auf den Gedanken kommen könnte, hinzugehen, zu des Mannes Füßen, um die Dinger da aufzulesen. Der Ton dieser Stimme, ich habe ihn nur zu genau studiert, gibt ungefähr klanglich den Eindruck wieder, den der Gang einer Schnecke aufs Auge macht, so prachtvoll langsam, so faul, so braun, so sehr gekrochen, so schleimig, so breiig und so sehr Kommichheutenichtkommichmorgen hört es sich an. Ein Genuß, ganz einfach. Ich kann's mit bestem Gewissen empfehlen.
Dieser Meier, muß man wissen, wenn man es noch nicht weiß, spielt einen Theaterdiener, seine Glanzrolle, eine Figur mit entsetzlichen Hosen, hohem Hut, angepappter Nase, Schachtel unter dem Arm, Löchern am Ellbogen, Zigarre im Mund, Maul statt nur frecher Schnauze und einem Bündel schlechter Witze auf der Tolpatschenzunge. Diese Figur ist zum Entzücken. Ich für mich habe sie jetzt bald, warten Sie mal, ich glaube, zum fünfzigsten Mal gesehen und bin noch lange nicht müde davon. Man wird eben nie müde, Vortreffliches anzuschauen.
Eine kleine Bühne, grell beleuchtet, ein Tisch darauf, ein Stuhl daneben, das soll das Bureau einer Direktorin vorstellen. Sie selber, die schlanke, jugendliche Frau, gibt bekannt, daß sie jetzt alles habe, was nötig sei, einen Zyklus von Vorstellungen zu eröffnen, nur eben gerade noch so ein Theaterdiener, das fehle ihr, aber sie habe bereits Annoncen in die Zeitungen einrücken lassen und sei nun begierig, wer sich melden wolle.
Tritt wer auf, gleich einem der Unterwelt entflogenen Geiste? Meier. Ei, der Teufel, natürlich, das hat man erwartet, aber sehen Sie, das Wunderbare ist, man sieht sich dennoch im höchsten Grade von der Neuheit überrascht, mit der es Meier mit ei versteht, die Treppe emporzuhosenbeinen, daß man in der Tat glauben muß, er müsse etwas gemacht haben, was in guter Gesellschaft nicht schicklich ist, auszusprechen.