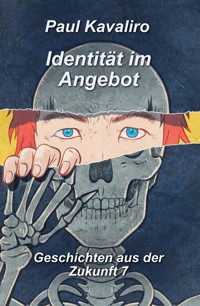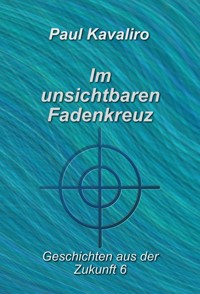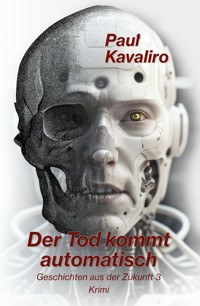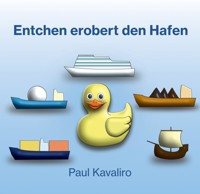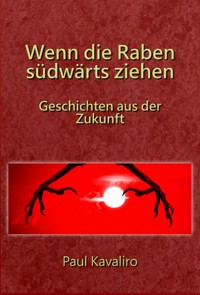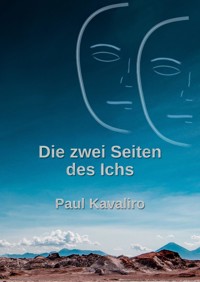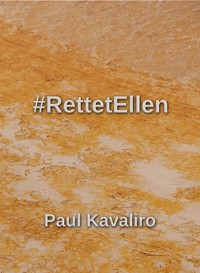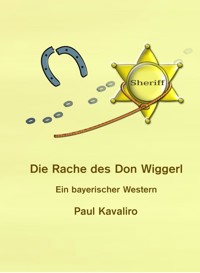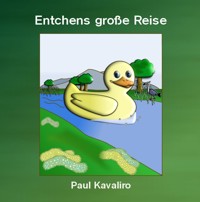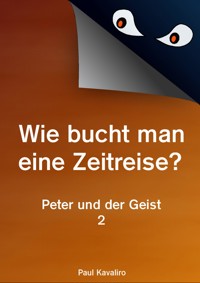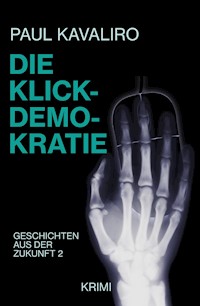
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
Kommissarin Wilke soll die Zukunft retten und das gleich doppelt: Die neue Klick-Demokratie mit ihrem wählerfreundlichen elektronischen Abstimmungssystem und die moderne und bequeme Form der Essenszubereitung per 3D-Druck. Beides hat viele Anhänger. Aber bei der Polizei gehen auch Anzeigen von Unzufriedenen dagegen ein. Also bekommt die Kommissarin gleich zwei Fälle aufgebrummt. Was ist an den Anzeigen dran? Dabei sind diese Themen für Wilke nur die zweite Wahl hinter dem aktuellen Mordfall, den jedoch an ihrer Stelle ihr zielstrebiger Konkurrent ergattert. Doch dann erhält sie Hilfe von unverhoffter Seite und ihre Ermittlung wird schnell einige Nummern größer als gedacht.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 409
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die Klick-Demokratie
Geschichten aus der Zukunft 2
Paul Kavaliro
Buchbeschreibung
Kommissarin Wilke soll die Zukunft retten und das gleich doppelt: Die neue Klick-Demokratie mit ihrem wählerfreundlichen elektronischen Abstimmungssystem und die moderne und bequeme Form der Essenszubereitung per 3D-Druck.
Beides hat viele Anhänger. Aber bei der Polizei gehen auch Anzeigen von Unzufriedenen dagegen ein. Also bekommt die Kommissarin gleich zwei Fälle aufgebrummt.
Was ist an den Anzeigen dran?
Dabei sind diese Themen für Wilke nur die zweite Wahl hinter dem aktuellen Mordfall, den jedoch an ihrer Stelle ihr zielstrebiger Konkurrent ergattert.
Doch dann erhält sie Hilfe von unverhoffter Seite und ihre Ermittlung wird schnell einige Nummern größer als gedacht.
Über den Autor
Paul Kavaliro schreibt Bücher für Kinder („Spuk für Anfänger“, „Entchens große Reise“) und Erwachsene („Final Logout“, „#RettetEllen“, die Trilogie „Die zwei Seiten des Ichs“, „Wenn die Raben südwärts ziehen“), auch als Ratgeber („Heimwerken macht sexy“).
Die Klick-Demokratie
Geschichten aus der Zukunft 2
Paul Kavaliro
1. Auflage, 2023
© 2023 Paul Kavaliro – alle Rechte vorbehalten.
Impressum am Buchende
Der Buchtext wurde ohne Textgeneratoren (KI) erstellt
Der Termin
Kommissarin Leonie Wilke schaut auf die Uhr an der Wand in ihrem Büro im Dezernat. Rastlos wandert ihr Blick immer wieder vom Bildschirm ihres Computers hinüber zu den Zeigern, die unaufhörlich voran ticken. Aber ihre Verabredung mit der Chefin Karla Meilling rückt nur zäh heran.
Heute liegt Aufregung in der Luft hier in der Dienststelle, denn es gibt Arbeit zu verteilen: Gestern kam die Nachricht von einem Mordfall herein. Eine junge Frau wurde erstochen in ihrer Wohnung aufgefunden. Die Kollegen haben sich gekümmert, die Leiche inspiziert, die üblichen ersten Schritte losgetreten.
Eine offizielle Leitung des Falles ist jedoch noch nicht vergeben worden, wie der Flurfunk verlässlich berichtet. Und das ist ihre Chance! Sie hat sich die imaginären Boxhandschuhe angezogen. Ring frei!
Sie hat ihr berufliches Leben lang für eine solche Gelegenheit gekämpft: einen großen Fall zu übernehmen. Das hat Spuren hinterlassen. Ihr Blick fällt auf das Bild auf ihrem Schreibtisch – es zeigt sie gemeinsam mit ihrem Sohn. Laurenz ist vor Kurzem aufs Gymnasium gewechselt. „Er will immer alles genau wissen“, berichten die Lehrer in den Elterngesprächen über ihn.
Das kommt nicht von ungefähr: Leonie trägt diesen Forschergeist in sich, er war ein Beweggrund für ihre Berufswahl. Ihr Junge hat diesen Staffelstab übernommen.
Sie seufzt, denn die Sonne scheint nicht ungetrübt. Nach der Trennung von ihrem Mann ist Laurenz zu seinem Vater gezogen. Am Anfang stand noch das paritätische Modell: eine Woche bei ihr, eine Woche bei Bernd.
Aber bald hat sich ein Ungleichgewicht eingestellt. Den Jungen hat es zu mehr Geborgenheit und Normalität hingezogen. Denn was ist an einem Polizistenjob schon normal? Da sind die Konflikte, die Wilke täglich im Job erlebt, die sie aufklären muss. Da ist das Leid, das sie dabei mitbekommt und kaum verarbeiten kann, so schnell stürmt es auf sie ein, nimmt ihr den Atem, überwältigt sie. All das hat sich wie ein Eimer schmierige Farbe auf ihre private Seite ergossen, abgefärbt, normales Leben erstickt. Und das hat nicht einfach so mit der Scheidung aufgehört. Man kann das nicht ausschalten, so wie man einem Gerät den Stecker zieht und es verstummt.
„Der Zustand unserer Ehe ist ein Kollateralschaden deiner Arbeit!“, hat ihr Bernd an den Kopf geworfen, als sie noch zusammen waren und mal wieder gestritten haben, weil Leonie ihre Gedanken an den aktuellen Fall nicht abschalten konnte.
Ein Kommissar schlüpft nicht geschwind aus seiner Haut, sobald er durch die Bürotür nach draußen tritt. Und er verwandelt sich auch nicht plötzlich in einen unbeschwerten Zivilmenschen. Er oder sie nimmt den Rucksack mit. Laurenz hat das mitbekommen, in der knappen gemeinsamen Zeit, in jeder Unterhaltung mit seiner Mutter oder beim Spielen: Stets war da ein Unterton, ein misstrauischer Blick in die Welt, die Belastung, die fehlende Aufmerksamkeit. Nun bekommt Leonie die Quittung dafür: Er wendet sich von ihr ab – langsam, aber stetig.
Jetzt sitzt sie hier im Büro mit ihren 38 Jahren und lebt dieses Kommissarenklischee aus, das man aus Büchern und Filmen kennt: viel Arbeit, erst wenig Zeit für die Familie und dann hat die keine Zeit mehr für sie.
Einen Lichtblick gibt es: Ihr Sohn hat in der Schule den Sprung auf die nächsthöhere Stufe geschafft. Grundschule war gestern. Er hat sich auf den Weg vom Kind zum Jugendlichen gemacht.
Kann Leonie es ihm gleichtun und im Büro einen Schritt nach vorn wagen? Ja, sie will und sie traut es sich in den meisten Momenten auch zu. Doch wie bald nimmt ihre Karriere Fahrt auf? Zurzeit bewegt sie sich in der Ebene. Wird sie das mit 40, 45, 50 immer noch tun? Wann hat sie genug Schwung aufgenommen, um den Berg hinaufzufahren?
Heute ist so ein Tag der Möglichkeiten. Die Uhr tickt.
Doch sie ist nicht die einzige Bewerberin auf weiter Flur. Auch andere sehen das Sprungbrett vor sich. Da ist etwa der Kollege Kevin Hussmann, ebenfalls im Range eines Kommissars. Sicher steht der in den Startlöchern, bereit zum Lauf hinein in ein neues Kapitel seiner Laufbahn.
Leonie kann den Eindruck nicht abschütteln, dass sie sich beweisen muss – vor allem ihm gegenüber. Er hat einen leichten Vorsprung, ist schon etwas länger hier im Dienst. Der muss keinem mehr was vormachen und seine Bestimmtheit ist Ausdruck von Selbstvertrauen.
Ihrer beider Chefin Karla Meilling schwingt das Zepter. Sie trifft die Entscheidungen und lässt nicht erkennen, ob sie dabei ein „Lieblingskind“ erkoren hat. Falls sie Präferenzen hat, so bindet sie die bislang keinem auf die Nase. Aber sieht sie deswegen die beiden Kommissare mit den gleichen Augen?
Dafür würde Wilke nicht ihre Hand ins Feuer legen. Hussmann blendet mit seiner Geradlinigkeit. Der schaut so selten nach rechts oder links, dass es schon langweilig ist. Hat er sich einmal ein Bild von einem Fall gemacht, bleibt er dabei und führt die Untersuchung dann auch zügig zum Abschluss. „Der erste Eindruck ist der beste“, lobt Meilling.
Es kommt in Ermittlungen vor, dass ihn die Kollegen auf schwer zu entschlüsselnde Spuren mit großem Interpretationsspielraum hinweisen. Dann kontert er kühl, dass jedem Fall eine Verschwörungstheorie innewohnt. Der könnte man nachgehen und Zeit liegen lassen oder man nimmt den direkten Weg. Und er ist eher der geradlinige Pfadfinder. Von abweichenden Theorien spricht er höchstens im Konjunktiv.
Manchmal wünscht sich Leonie insgeheim, dass er mit seiner Eindimensionalität eines Tages auf die Nase fällt. Aber das ist bislang nicht passiert. Wer Erfolg hat, der hat auch recht. So ist das und die Chefin sieht das gewiss nicht anders.
Die Uhr hat sich inzwischen bis auf 5 Minuten an den angepeilten Termin herangepirscht. Wilke steht von ihrem Bürostuhl auf. Kurz darauf setzt sich wieder hin. Wer stellt sich schon so lange vor die Pforte zum Chef und verwartet die Zeit sinnlos? Das suggeriert zwar Pünktlichkeit, aber gleichzeitig auch Mangel an Beschäftigung und Fleiß. Womöglich schreibt die Team-Assistentin, die als Nebenbeschäftigung die althergebrachte Rolle der Vorzimmerdame der Chefin ausfüllt, sogar eine Notiz in die Mitarbeiterkartei. Und am Ende des Jahres wird das dann alles zu einer Statistik über das ineffiziente Zu-früh-Erscheinen aufgebrüht. Die Bürokratie treibt zuweilen seltsame Blüten.
Andere würden sich nicht so viele Gedanken machen. Warum bleibt Wilke nicht gelassen? Weshalb grübelt sie und macht sich Druck? Die Antwort ist: Weil sie schon einmal einen größeren Fall bekommen und den – so war zumindest der Tenor der Betrachter von außen – vergeigt hat. „Präzises Arbeiten“ lautete stets ihr Vorsatz. Daher hat sie damals alle Beweismittel und Zeugenaussagen gründlich analysiert, veranschaulicht, Beziehungen aufgestellt. Es sollte der Kontrapunkt zur Hussmannschen Schnellschussmethode werden. Geht das Leben jemals einen geraden Weg? Nein, denn dann wäre Leonie im Privaten nie den Umweg über ihre gescheiterte Ehe gegangen. Das blieb ihr nicht erspart; keiner hat es sich gewünscht und doch ist es geschehen. Und so ist es auch in ihrem Job, zumindest aus ihrer Erfahrung: Die Spuren der Täter folgen verschlungenen Pfaden, nicht gerade Linien. Nichts ist einfach und Geschenke werden keine verteilt. Alles muss man sich erkämpfen. So sieht sie das Leben und so bewegt sie sich darin.
Das wollte Wilke so durchziehen, den Fall auf ihre Art lösen, nicht in der allgegenwärtigen Schnelllebigkeit. Das dauerte zu lange. Den Oberen riss der Geduldsfaden. Hussmann wurde abkommandiert einzusteigen und die Sache zum Abschluss zu bringen. Er erntete die Lorbeeren. Sie stand am Ende nur als der Wasserträger da.
Wenn sie jetzt eine neue Chance erhält, dann ist Druck im Kessel. Sie muss zügig überzeugende Ergebnisse sammeln, die nicht angezweifelt werden, sie anschließend knackig zusammenfassen, damit sie Meilling auf deren Thron stets Auskunft geben kann, wo sie steht und wo es hingeht. Dynamik, Zielstrebigkeit, Resultate, Fortschritt sollen ihre täglichen Begleiter sein. Ein Misserfolg? Nein, den kann sie nicht gebrauchen. Der würde ihre Laufbahn knicken wie der Sturm einen Grashalm. Er würde auf die Bremse treten, wo Beschleunigung angesagt ist.
Davon würde sie sich nicht mehr erholen. Dann ergeht es ihr wie dem Kollegen Ansgar Boldt ein paar Schreibtische weiter. Er hat die Schallmauer der 40 schon überschritten und die Karriere hat nie an seine Tür geklopft.
Die Uhr tickt.
Der Zeiger ist nahe genug. Wilke steht auf, eilt im Sturmschritt über den Gang, biegt um die Ecke und tritt vor die schwere Tür der Chefin.
Die öffnet sich in diesem Moment. Das hat Leonie gut abgepasst. Sie will eintreten, den Schwung mitnehmen. Doch sie wird gebremst, muss erst jemandem den Vortritt lassen, der auf dem Weg aus dem Chef-Büro heraus nach draußen ist.
Es ist Kommissar Hussmann. Er grinst Leonie kurz an und schaltet danach wieder alle Linien in seinem Gesicht auf Geradlinigkeit. Eilig jagt er den Gang entlang.
Die Chefin lächelt ebenfalls, wie ein Blick durch den Türspalt offenbart.
So viel Frohsinn, bleibt da noch etwas für Wilke übrig?
Die Aufgabe
„Kevin Hussmann wird die Aufklärung des Mordes an Pia Mainburg leiten.“
Karla Meilling fackelt nicht lang und hält sich nicht mit Einleitungen auf, sondern kommt direkt zur Sache. Und sie macht keine Gefangenen. Sie fragt nicht, erkundigt sich nicht nach Vorlieben, Wünschen, Vorstellungen. Sie stellt fest.
„Oh“, entfährt es Wilke.
„Wir müssen dort schnell vorankommen“, nötigt sich die Chefin immerhin eine Erklärung ab. „So ein Fall steht im Fokus der Medien. Und dann liegt er auch noch im Aktivistenmilieu. Diese Frau Mainburg war dort bekannt. Dadurch arbeiten wir unter dem Vergrößerungsglas vieler Interessenten.“
„Und können keine Bauchlandung hinlegen, so wie ich zuletzt“, vollendet Wilke die Begründung in Gedanken, sprich das aber nicht aus.
„Hussmann wird ein Team zusammenstellen“, fährt Meilling ungebremst fort.
Wilke nickt. Jetzt nur nichts Falsches sagen und sich aufdrängen, sonst gewinnt sie eine weitere Runde als Wasserträger in eben dieser Truppe. Dann zementiert sie ihren Status der ewigen zweite Geige hinter diesem Kevin.
Eine kurze Stille entsteht. Leonie sollte jetzt doch etwas von sich geben, sonst wirkt sie zu passiv. Das kommt ebenfalls schlecht an. Gibt es da nicht noch unaufgeräumte Sachen, für die sie sich anbieten kann?
„Ich wünsche dem Team Erfolg“, sagt sie und das ist halb Wahrheit, halb Lüge. „Was kann ich parallel tun? Da war zum Beispiel dieser Verdacht in der Einbruchsserie ...“
Meilling wischt mit der Hand über den Tisch, als ob sie diesen Gedanken ihrer Mitarbeiterin geradewegs in den Papierkorb befördert. „Das ist abgeschlossen und bleibt es auch.“ Sie steht aus ihrem Stuhl auf und geht zum Fenster. Danach dreht sie sich wieder zu ihrer Untergebenen um und schreitet langsam auf sie zu auf ihrem Weg zurück zum Schreibtisch. Wie ein Raubvogel schwebt sie über ihr. „Für Sie habe ich etwas anderes.“
„Ja?“
Meilling kehrt auf ihren Stuhl zurück. „Es geht um das Wahlsystem.“
Mit vielem hatte Wilke gerechnet: ein weiterer Mord, von dem noch keiner weiß, ein Überfall, ein Bankraub. Es gibt tausende Schattierungen von Gewaltverbrechen. Damit kennt man sich hier im Dezernat aus. Doch Stimmabgaben erlebt man nur als braver Wähler. Dazu haben die Kollegen sicher eine Meinung, aber wenig Wissen.
„So ein paar besorgte Bürger haben Anzeige gegen Unbekannt wegen eventueller Unregelmäßigkeiten gestellt“, lässt Meilling eine kleine Dosis Details heraus. Sie zieht ein Blatt Papier aus dem Stapel, der auf ihrem Schreibtisch liegt. Dabei ist doch heutzutage alles digital. „Hier finden Sie die Anzeige.“
Wilke überfliegt den Zettel. „Der Aufhänger sind Abweichungen zwischen Wahlvoraussagen und dem eigentlichen Ausgang?“
„Korrekt. Und ich habe angeboten, dass wir dem nachgehen.“
Wilke findet in diesem Satz gleich zwei bemerkenswerte Worte: „angeboten“ und „wir“. „Unser neues elektronisches Wahlsystem – ist das nicht eher ein Fall für das Dezernat für Cyberkriminalität, wenn da was nicht stimmt?“, stürzt sie sich auf das bedenklichere der beiden – nämlich dass Meilling den höheren Chefs eine Offerte unterbreitet hat. Ihr Antrieb dafür liegt in einer bösen Vorahnung, dass sie als Kommissarin wiederum einiges an Recherche betreiben muss, um in ein neues Gebiet einzutauchen, in dem sie sich nicht heimisch fühlt. Und diese Nachforschung braucht Zeit und von der war zuletzt zu wenig da.
„Die Cyberkriminalisten haben damit angefangen, den Fall dann aber bald auf Eis gelegt. Außer ein paar Protokollen gibt es nichts. Die sind Land unter“, schneidet die Vorgesetzte diesen Faden ab. „Die Polizeiführung sieht es gern, wenn sich die Abteilungen gegenseitig unter die Arme greifen.“
Aha. Aber sicher reicht die Sicht der Führung nur bis auf den Stuhl der Dezernatsleiterin und nicht bis zu ihrem Gegenüber – der Kommissarin, die die eigentliche Arbeit schultert. Leonie und ihre täglichen Mühen bleiben vom Blickpunkt der höheren Sphären aus im Dunkeln.
„Und schließlich will keiner einen Kratzer im Lack der schönen neuen Maus-Klick-Demokratie, oder?“, fragt Meilling. „Also Wilke, kümmern Sie sich darum!“
Damit hat sich das zweite bemerkenswerte Wort von vorhin in Wohlgefallen aufgelöst: Das „Wir“ hatte nur eine kurze Halbwertszeit.
„Kollege Boldt wird Ihnen helfen“, ordnet die Chefin an. „Ich sage ihm das per E-Mail.“
Na gut, wenigstens steht Leonie nicht alleine da. Aber ob der griesgrämige Ansgar Boldt eine große Stütze ist und ob sie sich an jedem Morgen auf die tägliche Zusammenarbeit mit ihm freut, das muss sich erst erweisen. Skepsis ist angebracht.
Meilling steht auf. Das ist das Zeichen dafür, dass das Gespräch dem Ende zustrebt. „Gehen Sie diskret vor. Öffentlichen Trommelwirbel kann bei diesem Thema niemand gebrauchen.“
Gibt es überhaupt ein Thema, wo das anders ist?
Wilke steht ebenfalls auf.
Die Chefin hält ihr die Hand hin.
Das ist eine ungewohnte Förmlichkeit.
Ein fester Händedruck folgt. Womöglich hat die Leiterin beim letzten Soft-Skills-Training gelernt, dass man das so macht – die Mitarbeitermotivation lässt grüßen.
Wilke wendet sich bereits halb zum Gehen.
Meilling stößt in diesem Moment beim Hinsetzen mit ihrer Hand versehentlich gegen den altmodischen Aktenstapel auf ihrem Tisch, aus dem sie vorhin den Zettel mit der Anzeige gezogen hat. Der Stapel kippt um. Dadurch wird ein Umschlag freigelegt, aus dem eine Zeitung mit einer Schlagzeile hervorlugt.
Wilke ist auf Beobachtung getrimmt, nimmt blitzschnell Details auf. „Peter B. – ein Vierteljahrhundert im Rollstuhl“, prangt der Titel in großen Lettern. Eine Melinda Gravenhorst hat den Artikel geschrieben. Sicher geht es darin um einen bemitleidenswerten Mitbürger.
Eilig rafft die Herrscherin des Schreibtischs das Relikt aus einer vergangenen Zeit zusammen: die Druckausgabe einer Zeitung und dann auch noch in einem an sie adressierten großen Briefumschlag.
„Das war alles“, beeilt sich Meilling, die peinliche Situation zu beenden.
Wilke darf gehen.
Die stille Revolution
Jeder Ermittlung gehen ein oder mehrere Ereignisse voraus. Sie bilden den Anlass. Die Vorfälle gilt es zu untersuchen, zu beleuchten, zu verstehen. Etwas ist passiert, jemand hat was getan, ein Unrecht begangen, das so nicht angeht und dessen Täter sowie seine Hinterleute man entlarven muss.
Kommissarin Wilke fragt sich nur, ob in diesem Fall wirklich eine Tat vorliegt oder ob nur ein vager Verdacht besteht, und vor allem, warum ausgerechnet sie darauf angesetzt wurde.
Es ist normal, dass so ein Fall hier in der Hauptstadt anhängig ist – wo sich alles konzentriert, was mit Bundespolitik zu tun hat, wo das Parlament und die Regierung sitzen. Und bestimmt ist da noch die eine oder andere Institution, die entweder ballaststoffreich und geltungsbedürftig ist und man kann sie nicht umgehen, oder sie ist hilfreich und man kommt aus eigenem Interesse nicht an ihr vorbei. Der Wahlleiter ist zum Beispiel ein solcher Kandidat.
Dennoch wundert sich Leonie, warum sich ihre Chefin das Thema auf den Tisch gezogen hat. Tut sie damit jemandem einen Gefallen? Wurde sie gedrängt? Will sie selber vorankommen?
Wenn die Kommissarin schon Berührungsängste mit dem Thema hat, hätte sie als Auftragsempfängerin mehr Gegenwehr leisten sollen? Ihre Schlagfertigkeit hat sie verlassen, wie oft in wichtigen Gesprächen. Und die Begründung Meillings, dass die Abteilung für Cyberkriminalität „Land unter“ ist, kam überzeugend, wenn auch schnell.
Egal, die Würfel sind gefallen. Sie geht es an. Das ist immer noch besser, als in Hussmanns Boot zu sitzen. Und mit dem bärbeißigen Kollegen Boldt wird sie sich schon zusammenraufen. Sie sind beide keine Wahlexperten. Sie werden gemeinsam lernen.
Leonie besinnt sich: In ihrer Zeit als Erstwähler liefen Wahlen noch auf die alte Tour ab. Es gab Wahlzettel aus Papier, man kreuzte darauf an und warf sie anschließend in die Wahlurne. Nach Wahlschluss wurde brav ausgezählt und die Ergebnisse übermittelt. Das dauerte und zu vorgerückter Stunde abends oder gar erst am Morgen hatte man alles zusammengefasst und man hatte ein Wahlergebnis. Man nannte es zunächst vorläufig und nach weiteren Schritten amtlich. Das Procedere ist noch zäher als die Siegerkür beim Eurovision Song Contest.
Wer sich den Weg zum Wahllokal sparen wollte oder es terminlich nicht einrichten konnte, der gab seine Stimme per Brief ab, ebenfalls auf Papier. Den musste man zuvor anfordern und dabei seine Bequemlichkeit überwinden.
Elektronisch zu wählen galt hingegen lange als Risiko und keiner traute sich das heiße Eisen anzufassen. Mit der Zeit wurden die Bedenken aber kleiner und die ungeduldigen Fragen dafür lauter: Wenn man seit Jahrzehnten seine Finanzangelegenheiten per Homebanking vom Smartphone aus abwickelt, warum gibt man dann nicht auf einem ähnlichen Weg seine Stimme als Wähler ab? Papierzettel sind doch ein Relikt des letzten Jahrtausends.
„Das habe ich auch lange nicht verstanden“, knurrt Kollege Boldt, als sich Wilke das erste Mal mit ihm im Büro zusammensetzt, um sich über den Fall auszutauschen. „Ist doch alles hier!“ Dabei zieht er sein Mobiltelefon aus der Tasche und hält es hoch. „Auch wenn ich kein IT-Freak bin“, setzt er der eigenen Begeisterung Grenzen. Das ist Leonie Wilke ebenfalls nicht. Die Informationstechnologie bringt ihr oft Erleichterung, aber manchmal auch zusätzliche Last. Und jedwede Veränderung braucht Eingewöhnung. Nicht jeder saugt Wissen so schnell auf, wie junge Leute das drauf haben – zum Beispiel ihr Sohn Laurenz. Doch sie verschließt sich deswegen der Technik nicht, sondern nimmt gern die Bequemlichkeiten mit, die so manche neue Erfindung der Allgemeinheit ermöglicht.
Und sonntags zur Wahl zu gehen – dafür brachten im Laufe der Zeit immer weniger Bürger Enthusiasmus auf. Man musste sich an seinem Heimatort einfinden. Man war nicht frei in seiner Planung für den Tag. Man musste sich auf den Weg machen, sich in die Schlange einreihen, warten, sich ausweisen, sein Kreuz setzen, den Zettel abgeben und wieder nach Hause gehen. Erst danach konnte das Wochenende weitergehen. Und wenn irgendein armer Tropf seinen Ausweis vergessen hatte, dann durchlief er den Zyklus gleich zwei Mal.
Die Wahlbeteiligung begab sich in einen stetigen Sinkflug und das rief progressive und technikfreundliche Kräfte auf den Plan: Eine Online-Stimmabgabe geht schnell vonstatten. Man kann sie auch der fitten Oma erklären, die schon lange ihre Bankgeschäfte von zu Hause aus erledigt. Man muss nicht die eigenen vier Wände verlassen, kann von überall wählen und benötigt nicht viel Zeit dafür. Ein Wahltag ist ein Tag wie jeder andere. Unter dem Schlussstrich gibt es immer weniger Ausreden, sich nicht zu beteiligen.
Außerdem eröffnet all diese herrliche Bequemlichkeit die Chance, eine größere Anzahl von Abstimmungen abzuhalten und nicht nur die Parlamentswahlen aller 4 oder 5 Jahre. Das allmächtige Volk kann per Klick mit Maus oder auf dem Touchscreen bestimmen und das auch unter der Woche und quasi nebenbei. Die Wahlsonntage wurden ins Museum verfrachtet. Die Mitmach-Demokratie wurde geboren – oder wie Meilling es sagte und dabei eine populäre Formulierung aufgriff: die Klick-Demokratie.
Seitdem gleicht das politische System einem Trichter: Am breiten oberen Rand gibt es die Online-Volksabstimmungen, den sogenannten Volks-Klick. Man wählt das Parlament und man stimmt auch über große Entscheidungen in einer Art Volksbefragung ab. Dabei geht es zum Beispiel darum, wie die Gewichte im Haushalt verteilt werden. Jeder Wähler kann sagen, in welcher Reihenfolge die folgenden Posten bedacht werden sollen: Soziales, innere Sicherheit, äußere Sicherheit, Wirtschaft, Bildung, Landwirtschaft, Ernährung und so weiter.
Bei anderen Gelegenheiten kann zu konkreten Fragen abgestimmt werden, beispielsweise über Auslandseinsätze der Streitkräfte.
Wenn das Volk schon so viel zu sagen hat und alles so leicht geht, benötigt man dann überhaupt noch das Parlament? Man braucht es, zumindest aktuell.
Doch man hat es im Vergleich zu früher komplett umgekrempelt: Glichen die ersten Wahlen einer bloßen Abbildung des Stimmzettels auf eine Eingabemaske in einer Smartphone-App und man fragte sich, ob das nun der erhoffte kühne Schritt ist, so änderte sich doch das Abstimmungsverhalten. Die neue und häufigere Form der Bürgerbeteiligung schickte bald Schockwellen der Veränderung durch das politische System.
So sitzen jetzt anstelle von Vertretern namhafter Parteien zunehmend die Politiker mit den meisten Followern in den Sozialnetzwerken in der Volksvertretung. Diese formieren sich themenbezogen zu gewissen Strömungen gemäß ihrer Meinung und stimmen dann entsprechend ab. Die Zeiten von Fraktionszwang sind vorbei. Parteien verlieren immer mehr an Bedeutung.
Vor den Augen der mündigen Bürger hat sich eine stille Revolution vollzogen.
Diese Entwicklung hat eine neue Form von Abgeordneten in die obere Sphäre der Politik gespült und sie lenken fortan die Geschicke: all die Bommers, Jungwirths, Bergs, Vicarios und wie sie alle heißen sowie regelrechte Popstars wie zum Beispiel ein Sandro Kerst.
Das Parlament nimmt sich die großen Themen, über die das Volk per Klick abgestimmt hat, und regelt deren Umsetzung. Es gibt in diesem Prozess schon noch Debatten in der Volksvertretung, aber die treten immer mehr in den Hintergrund, weil viele Diskussion in den Sozialmedien stattfinden. Dabei haben diejenigen Politiker mit der zahlenstärksten Followerarmee hinter sich die besten Chancen, dass ihre Vorstellungen „populär“ werden, die größte Durchschlagskraft entfalten und am Ende im Parlament beschlossen werden.
Kollege Boldt sagt, dass dieses Konstrukt weder Fisch noch Fleisch ist. Alles sei beliebig. Man habe das verkrustete System der Parteien durch ein unstetes Gewimmel von Möchtegernentscheidern eingetauscht. „Was die da manchmal treiben, das versteht doch kein Mensch.“
„Ist das früher besser gewesen?“, zweifelt Leonie. „Hast du alle Debatten angehört und alle Protokolle von Hinterzimmerbesprechungen gelesen?“
„Auch wieder wahr“, gesteht er ein.
Um Konstanz zu garantieren, hat man daher den 4-Jahres-Wahlzyklus beibehalten. Das Parlament möge seine Zusammensetzung nicht im Takte kurzfristiger Hypes ändern. Den anstehenden Vorhaben wird dadurch genug Zeit eingeräumt.
Am unteren Ende des Trichters, wo etwas Konkretes „herauskommen“ soll, sitzt die Regierung. Sie wird in der Volksvertretung gewählt und setzt deren Entscheidungen um. Kandidieren kann jeder Abgeordnete.
Das Geschacher um Ministerposten und um den Kanzler trägt dabei einen ganz traditionellen Charakter. Da hat sich zu früher nicht so arg viel geändert. Man kommt voran, wenn man einem anderen Mandatsträger oder einer Gesinnungsgruppe vorher mal einen Gefallen getan, eine Abstimmung unterstützt oder ein Gesetzesvorhaben in Ausschüssen so ausgestaltet hat, dass man dafür Beifall bekam.
Allerdings bewegt sich jeder Parlamentarier dabei in einem Minenfeld. Sich Sympathien zu verscherzen ist sehr leicht. Es gibt keine Partei- und Fraktionsräson mehr und dreckige Wäsche wird der Einfachheit halber in der Öffentlichkeit gewaschen. Die Medienvielfalt bietet eine exzellente Plattform dafür.
Optimisten loben die Transparenz und die Einflussmöglichkeiten der Wähler. Skeptiker hinterfragen wiederum gerade die Durchschaubarkeit und nennen das Ganze einen Klick-sanktionierten Dilettantismus.
Kommissarin Wilke sieht die Wahrheit irgendwo dazwischen. Ja, vieles hat sich geändert. So manches wird politisch bewegt. Den einen geht es immer noch zu langsam, die anderen kommen nicht mit.
Es hat ein Gutes, dass ihr der Fall mit dem möglichen Abstimmungsbetrug übergeben wurde: Sie wird ausgiebig Gelegenheit haben, sich eine fundierte Meinung über das neue System zu bilden.
Und sie wird zu Beginn der Ermittlungen schauen, wie all die moderne Abstimm-Herrlichkeit abgesichert ist. Damit alles mit rechten Dingen zugeht.
Vertrauen fassen
„Wenn das Dezernat für Cyberkriminalität so überarbeitet ist, wie man sagt, dann bekommen wir so bald keinen Termin für ein Informationsgespräch“, unkt Ansgar Boldt.
Dabei gibt es wenige Alternativen – es ist das die erste Polizeiadresse, wenn es um Fragen der Computersicherheit geht. Und das schließt Wahlcomputer ein, erfüllen die doch einen hochoffiziellen Zweck.
„Gehen wir es trotzdem an?“, fordert ihn Leonie Wilke heraus.
„Kann es ja mal versuchen“, gibt Boldt nach und greift zum Telefon.
Die Kommissarin schüttelt den Kopf. „Die stehen sicher auf geschriebene Online-Kommunikation, weil die so schön geordnet ist und man nicht sofort reagieren muss.“ Dabei zeigt sie auf ihren Monitor mit dem E-Mail-Programm.
Boldt vertieft sich in seinen Bildschirm. „Ha, du hast recht. Die haben sogar eine Anfragemaske dafür.“ Er tippt etwas ein.
Wilke ist es zufrieden. Ihr Kollege ist fähig, versprüht aber nicht gerade den Charme, der andere Abteilungen der Polizei dahinschmelzen und Wünsche erfüllen lässt. Seine Nachrichten sind selten blumig. Da sorgt eine nüchterne Eingabemaske für Chancengleichheit.
Ein kleines Wunder geschieht und sie bekommen einen Termin schon am nächsten Tag.
„Guten Tag! Danke, dass ihr uns so schnell empfangt. Sicher habt ihr viel zu tun“, drängelt sich Leonie beim Eintritt in das Büro des auskunftsbereiten Kollegen von der Cyberkriminalität vor und übernimmt die Begrüßung. Dadurch kann der für gewöhnlich grummelige Boldt nicht für einen suboptimalen Einstieg sorgen.
„Keine Ursache. Können wir schon machen“, antwortet der Polizist, der sich als Maik Klingler vorstellt.
Und er erklärt ihnen, wie die Mitmach-Demokratie abgesichert wird. „Schließlich sollen die Bürger Vertrauen in die Technik fassen“, betont er und klingt dabei wie ein Politiker.
Dann kommt er zur Sache und zieht am Anfang Grenzen: „Ich erläutere das nur grob, denn die Details liegen unter Verschluss, damit nicht jeder Hacker eine Selbstbauanleitung für Exploits in die Hände bekommt.“
Wilke nickt und Boldt verzieht keine Miene.
„Exploit bedeutet, dass man eine Schwachstelle ausnutzt“, schiebt Klingler eine Erklärung nach und schwenkt so auf ein volkstümlicheres Niveau ein.
Jetzt nickt auch Boldt, der nicht so sehr auf Computer-Elfenbeinturm-Kauderwelsch steht.
„Nicht jeder in- oder ausländische Feind soll unsere Wahlen und Volksabstimmungen fernsteuern können“, holt Kollege Maik aus. Anschließend umreißt er die Struktur: „Es gibt über das Land verteilt zertifizierte Rechenzentren, die die Stimmen in der jeweiligen Region zählen.“
Auf Boldts Frage, wie viele das sind, antwortet Klingler, dass das immer mal wieder wechselt, weil unveränderliche Gebilde angreifbarer seien. „Aber typischerweise bedient eine solche Instanz, ich meine ein Rechenzentrum mit einem Wahlrechner, mehrere Landkreise oder einen Regierungsbezirk.“
„Warum nimmt man nicht einen zentralen und dafür supersicheren Rechner?“, interessiert sich Wilke.
„Weil man dann Gefahr läuft, dass bei einem Einbruch gleich die gesamte Wahl manipuliert wird. Und selbst wenn man das glücklicherweise bemerkt, dann muss man immer noch die ganze Sache wiederholen. Für jeden Bürger.“
„Also je mehr Rechenzentren, um so weniger Gefahr?“, fragt Boldt.
„Ja und außerdem um so mehr Aufwand für die Angreifer.“
Die Wähler geben ihre Stimmen per Computer oder Smartphone auf einer Eingabemaske in ihrem jeweiligen Abstimmungsportal ein, typischerweise gibt es eins pro Rechenzentrum. „Aus ähnlichen Gründen wie für die regionale Struktur überhaupt, damit nicht jede eingegebene Stimme bereits vor der Zählung verfälscht werden kann“, fügt Maik hinzu, als er in Boldts Gesicht blickt, in dem sich schon wieder eine Frage formiert.
Von den Portalen gehen die Stimmen zum Wahlrechner und werden dort zusammengefasst. Abends nach Wahlschluss werden sie gesammelt gemeldet. Das passiert in Sekundenbruchteilen.
„Aber hat man dann nicht tatsächlich den einzelnen Sammelrechner, den jemand übernehmen kann und danach ist alles falsch?“, zweifelt Boldt.
„Gute Frage, daran haben die Architekten aber gedacht!“, triumphiert Klingler und sagt, dass es mehrere solcher Sammelrechner gibt. Und die Wahl ist insgesamt nur gültig, wenn jeder von ihnen die gleiche Stimmensumme ausweisen. „Sicherheit durch Redundanz“ lautet hier der Slogan.
„Alles verteilt, das ist so eine Art Politik-Peer2Peer“, gestattet sich Klingler einen sanften Rückfall in den Jargon, der in Boldts Ohren ein bloßes Kauderwelsch ist.
„Und wie ist das mit den Wählern? Wie wird sichergestellt, dass die Richtigen wählen und nicht irgendjemand anderes, eine Maschine oder so?“, wechselt Wilke die Richtung weg von den Computern und hin zu den Menschen.
„Jeder Wähler ist registriert als Bürger und er hat seinen Ausweis mit Chip. Den muss man beim Wahlvorgang mit dem Rechner, vor dem man sitzt, oder dem Smartphone verbinden“, antwortet Klingler. Er spricht dann noch von sicherer Authentifizierung und dass sogenannte Bots nicht zum Zuge kommen.
„Und wenn jemand seinen Ausweis verliert?“, hakt Boldt ein.
„Dann muss er das sofort melden und bekommt einen neuen. Der verlorene Ausweis ist dann nicht mehr gültig und mit dem kann nicht mehr gewählt werden.“
„Und wenn nun die Kennung eines Wählers abgefangen und er ausspioniert wird, was er wählt und so?“, will Wilke wissen.
„Die Namen der Wähler gehen nicht über die Leitung, sondern jeweils nur ein Hashwert. Die kannst du dir als Nummern vorstellen, die eine Unterscheidung von Wählern ermöglichen. Es gibt nie zwei gleiche Nummern. Aber umgekehrt kannst du von der Zahl nicht auf den Wähler schließen. Dieses Wissen besitzt keiner und kann es daher auch nicht missbrauchen.“
„Aha.“ Sie gibt sich für den Moment zufrieden.
So weit, so gut. Im technischen Ablauf der Wahl steckt eine Menge Grips. Doch Ideen für mögliche Schwachstellen haben sie heute leider nicht entwickelt. Der Weg ist lang.
Wilke und Boldt bedanken sich für das Gespräch. „Wir behalten deine Telefonnummer, falls noch was ist“, sagt Ansgar. Das klingt ein bisschen wie eine Drohung.
Doch Klingler, der anders als erwartet keinen überarbeiteten Eindruck macht, ist entspannt: „Gerne. Dafür sind wir da. Und ihr helft uns ja aus. Na ja, viel Glück.“
Follower
Wilke und Boldt kehren wieder in ihr Büro zurück. Die Arbeit kann noch einen Moment warten. Es bleibt Zeit für einen kurzen Umweg über die Kaffeeküche. Nach dem Gespräch mit Klingler gibt es einiges zu verdauen.
Die Kollegin Jasmin Hornbach kommt ebenfalls herein – für ein Rendezvous mit der Kaffeemaschine. „Wie geht’s? Was macht der Fall?“, versucht sie etwas Smalltalk.
„Geht voran, zäh“, bleibt Wilke einsilbig. So richtig nach kollegialer Unterhaltung ist ihr nicht zumute. Aber in jeder Begegnung schlummert eine Chance. Und daher stellt sie eine Gegenfrage: „Vertraust du eigentlich dem Wahlsystem?“
„Schon. Und da stehe ich nicht allein. Schau doch auf die Wahlbeteiligung“, antwortet sie, ohne aufzuschauen. Sie ist jünger als die Kommissarin und manchmal kann sie sich nicht des Eindrucks erwehren, dass man sich hier im Dezernat dafür rechtfertigen muss, wenn man etwas Neues gut findet.
Doch es stimmt, was sie sagt. Wilke und Boldt haben sich die Statistik der Beteiligung bei Wahlen und Volksabstimmungen angesehen. Die liegt seit der Umstellung robust über 90 Prozent. Das sind paradiesische Zustände im Vergleich zu früher.
Manche in den Medien feiern den Schwenk zu einer Stimmabgabe per Computer daher als einen der historisch größten Beiträge zur Wahrung der Demokratie. Der Grund für den Optimismus liegt darin, dass dicke Beteiligungszahlen das Ergebnis gegen Einflüsse durch Anhänger extremer Gruppierungen absichern. Deren Gefolge ist stets motiviert, die Stimme abzugeben. Die schweigende Mehrheit hingegen war lange ein Sorgenkind. Aber mit der neuen niedrigeren Hemmschwelle, auf den Knopf zu drücken, ist man jetzt auf den Mitbestimmungspfad gewechselt und der ist seitdem gut bevölkert.
Die Unterhaltung lockt Heiko Sievertz an, einen noch jüngeren Polizisten, der in seinen Zwanzigern ist.
„Ist doch gut“, meint er mit Bezug auf die Wahlbeteiligung und stellt sich hinter Jasmin in die Reihe zum Kaffeeautomaten. „Je mehr, je besser.“
„Keiner will hinterher mehr sagen, nicht dabei gewesen zu sein“, ergänzt Hornbach. Die beiden scheinen sich einig zu sein.
„Stimmt schon“, gibt Boldt zu. „Früher hieß es manchmal: ‚Gehst du etwa wählen‘?“
Das Eis taut und Hornbach und Sievertz setzen sich an den kleinen Tisch zu Wilke und Boldt. Gemütlich ist es hier nicht. Schließlich soll im Kommissariat gearbeitet und nicht geplauscht werden.
„Und, seid ihr Follower?“, schickt Ansgar dann doch eine spitze Frage an die jüngeren Kollegen hinterher.
Die zucken mit den Schultern. Das war kein Nein.
„Ich ‚followe‘ nicht“, bekennt Wilke, was niemanden überrascht. „Es kommt mir immer so vor, als ob man dann ein Anhängsel von jemand Bekanntem ist.“
„Warte nur, das wird dein Sohn anders handhaben“, wirft Jasmin ein. „Und das mit den Followern hat ja immerhin den Vorteil, dass man die Popularität von Politikern messen kann – besser als per Umfrage.“
„Und das um so mehr, nachdem sichergestellt ist, dass die Follower und alle, die in sozialen Medien eine Meinung kundtun, auch wirkliche Personen aus Fleisch und Blut sind“, befeuert Sievertz das Argument. „So kann man sehen, wie viel Gewicht eine Person oder ein Thema haben. Schon vor der Wahl. Die Voraussagen über den Wahlausgang werden besser.“
„Das wurde aber auch Zeit“, grummelt Boldt. Er ist kein Freund von Überraschungen und erst recht niemand, der Schein und Sein gern eng beieinander sieht. „Wäre ja noch schöner, wenn Wahlen so wackelig wie Aktiengeschäfte sind.“
Früher vermochte man echte Follower nicht von Bots oder anderen virtuellen Existenzen zu unterscheiden. Manchmal stand auch ein politischer Widersacher hinter den angehäuften Zahlen für Unterstützer oder Gegner eines Posts. Maschinen können mittlerweile schon so viel und sie rühren einen Topf voller Gerüchte und Ansichten in Windeseile um, sodass die Informationssuppe plötzlich anders aussieht und schmeckt. Hatte man eine künstliche Intelligenz in seinem Arsenal, so konnte man die beauftragen und schon hatte man automatisiert einen Trend kreiert, ohne sich mit eigenen Eingriffen die Finger schmutzig zu machen. Mit der „Personenkontrolle“ wurden diese Einflüsse ins Abseits gestellt.
„Selbst wenn nur Menschen im Spiel sind: Da steht doch der Beliebigkeit Tür und Tor offen. Heute schließe ich mich einer Meinung an, morgen drehe ich ihr wieder den Rücken zu“, bleibt Boldt skeptisch.
„Steht für mich nicht so im Vordergrund“, wagt Sievertz einen Widerspruch. „Die Follower-Zahlen sind Indikatoren. Wer viele davon hat, ist eher auf dem richtigen Weg als einer mit wenigen.“
„Wir steuern dadurch und rennen nicht blind ins Verderben. Wir bestimmen und sind nicht fremdbestimmt“, bekennt sich schließlich auch Hornbach als digitaler Jünger.
„Und wenn man Meinungsmachern zum Opfer fällt?“, quengelt Boldt.
„Die Wahlplakate von früher waren aber auch nicht besser“, fährt ihm Wilke in die Parade.
„Und für die Politiker gab es schon früher Lobbyisten, die die Abgeordneten wie Wachhunde begleitet und alles weggebissen haben, was ihnen an Meinungen der einfachen Leute nicht in den Kram passte“, echauffiert sich Sievertz über die Feinde der Basisdemokratie.
„Tja, die neue Zeit ist anders als die alte“, sinniert Wilke und stellt ihre mittlerweile leere Kaffeetasse in den Geschirrspüler. „Stimmt’s, Nora?“, grüßt die Kommissarin die Praktikantin und Anwärterin, die in diesem Moment mit einem Teebeutel in der Hand hereinkommt, nachdem sie von der Polizeiakademie herübergehetzt ist und eine kurze Verschnaufpause sucht.
„Sowieso“, stimmt Nora Fist in den Klischee-Kanon des Schubladendenkens ein. Um zu widersprechen und Kontroversen zu entfachen – dazu ist sie nicht lange genug dabei.
„Versteht mich nicht falsch“, sagt Boldt, der die Prise Ironie bemerkt, schließlich besitzt er die Augen und Ohren eines Ermittlers. „Fortschritt ist nichts Schlechtes. Und er schafft neue Chancen – für die Rechtschaffenen, aber auch für die Gauner.“
„Deswegen müssen wir ihn kritisch und unterstützend begleiten“, spricht Leonie einen Satz aus, der genauso gut aus einem Politikermund stammen könnte.
Danach nicken zur Abwechslung mal alle gleichzeitig.
„Und was macht euer Fall so?“, fragt Wilke zum Abschluss, da sie inzwischen erfahren hat, dass Hornbach und Sievertz gemeinsam mit Hussmann an dem Mordfall sitzen.
„Geht voran, zäh“, seufzt Heiko.
„Aber geradlinig – du kennst doch Kevin“, ergänzt Jasmin.
Das Milieu
Kommissar Kevin Hussmann fragt sich immer noch, warum die Kollegin Leonie so seltsam geschaut hat, als er vor ein paar Tagen aus Meillings Büro herausgekommen ist, nachdem ihm die Chefin den Mordfall zugeteilt hat.
Tja, sicher hat sie ebenfalls Ambitionen, will vorankommen. Wer möchte das nicht? Doch gleichzeitig ist in seinen Augen klar, dass er einen Vorsprung vor ihr hat. Warum wundert sie sich also? Letztens musste er sogar für sie einspringen und eine Sache zu Ende bringen, die sie sonst vertrödelt hätte.
Dennoch kann er nicht den Eindruck abschütteln, dass er sich ständig beweisen muss, seitdem sie da ist. Dabei will er doch einfach nur arbeiten, ohne Schnörkel und Ablenkungen. Daher hat er Karla Meilling auch gesagt, dass er sich nicht den bärbeißigen Boldt als Mitarbeiter an seinem Fall wünscht, sondern lieber jemand anderen, etwa Jasmin Hornbach oder Heiko Sievertz – am besten alle beide. Die sind willig, formbar und meist kooperativ. Um Befindlichkeiten will er sich nicht kümmern. Das stört nur den Fokus auf den Fall.
Daher sollte er auch schleunigst aufhören, sich Gedanken um Wilke zu machen. Er hat ja bekommen, was er wollte – er klärt den Mordfall Pia Mainburg auf.
Das Opfer wurde tot in ihrer Wohnung aufgefunden. Bei der Tatwaffe handelt es sich um ein Messer, das man blutverschmiert und leicht versteckt im Vorgarten des Mehrparteienhauses entdeckt hat.
Praktischerweise hat man den Verdächtigen gleich vor Ort aufgegriffen, kurz nach der Tat. Es handelt sich um einen Herrn Benno Klausen und der sitzt jetzt in Untersuchungshaft.
Der Fall sieht recht klar aus – wie gemalt für Hussmann. Die Tatwaffe liegt vor, der mutmaßliche Täter wurde gefasst, weil Nachbarn bemerkten, wie er sich gewaltsam und keinesfalls lautlos Zugang zur Wohnung verschafft hat.
Heute früh sind die Ergebnisse der Spurensicherung hereingekommen: Auf dem Messergriff sind Klausens Fingerabdrücke zu finden. „Das ist schlecht für dich, mein Junge“, murmelt Kevin, als er den Bericht liest. Der „Junge“ hat nämlich ausgesagt, dass er das Messer gar nicht berührt hat. Hussmann nimmt ihm das bis auf weiteres nicht ab, umso weniger nach den vorliegenden Resultaten der Kollegen.
Auch der Umstand, dass man in der Bleibe des Opfers keinen Laptop, Tablet oder dergleichen gefunden hat, beschäftigt den Kommissar nicht weiter. Die jungen Leute machen doch heute viel über ihr Smartphone. Dort ist außer ein paar gewählten Telefonnummern und einer Handvoll Chats nichts drauf? Schade.
Seine Gedanken fliegen schon in Richtung Zukunft – zur Gerichtsverhandlung. So eine Waffe mit den Spuren ist ein starkes Indiz für seine Tatausführung. Was immer Klausen an Verteidigern auffährt, sie werden ihn nicht retten können. Der erste Eindruck ist Hussmanns verlässlicher Freund.
„Aber ich war doch gar nicht draußen im Vorgarten, als Sie gekommen sind!“, hat Benno beteuert. Stimmt, die herbeigerufene Polizeistreife hat sich Zugang zur Wohnung verschafft und ihn dort aufgegriffen – über den Leichnam gebeugt, heulend wie ein Schlosshund.
Der Verdächtige ist nicht so unbedarft, wie er vorgibt. Der zieht eine Show ab. Das ist Hussmanns Eindruck. Und er täuscht sich selten, was seine geradezu legendäre Geradlinigkeit bei der Aufklärung von Fällen begründet. „Sind Sie sich sicher, dass Sie das Messer nicht nach draußen gebracht oder durch das Fenster geworfen haben, durch das Sie in die Parterre-Wohnung eingestiegen sind?“
„Nein! Ich meine: ja!“, hat Klausen beim Verhör gestammelt.
„Was denn nun?“
„Ja, ich bin mir sicher, dass ich das Messer nicht in der Hand hatte. Und ich habe es auch nicht nach draußen befördert!“
Der „Junge“ war anfangs ziemlich durcheinander. Mittlerweile hat er sich in der Untersuchungshaft gefangen. Man kann gesittet mit ihm reden, die emotionalen Ausbrüche werden seltener. Wenn man ihn etwas fragt, dann reagiert er inzwischen besonnener. Verzweifelt ist er aber immer noch.
„Soll er auch sein“, denkt sich Hussmann, „bei einem begangenen Mord ist das angebracht.“ Und für schuldig hält ihn der Kommissar – so lange, bis es Beweise für das Gegenteil gibt. Es liegt einfach zu viel auf dem Tisch, als dass man noch die Karte mit der Unschuldsvermutung ziehen könnte.
Und mit dem Bericht von heute früh sind weitere belastende Momente dazugekommen: In der Wohnung wurden Spuren von Mainburg sowie von Klausen gefunden. Dazu ein paar Haare, gleich mehrere mit unterschiedlicher Farbe, die man nicht zuordnen konnte. Die können von anderen, stinknormalen Besuchern stammen. Junge Leute feiern Partys oder laden sich anderweitig jemanden ein. Da ist viel los und allerlei Gelegenheit zur Begegnung.
„Sieht doch sehr nach Beziehungstat aus“, hat Hussmann heute Mittag beim Rapport zu Meilling gesagt, im selbstbewussten Ton.
„Kennen Sie sich näher?“, hatte Kevin zuvor im Verhör gefragt und Klausen bejahte das. „Näher?“ Ebenfalls ja.
„Noch interessanter wären Frau Mainburgs Antworten auf diese Fragen gewesen“, hat die Kollegin Hornbach nach der Befragung des Verdächtigen eingewandt. „Vielleicht sah diese Pia das ganz anders, zumal sie mit 28 schon drei Jahre älter als Klausen ist.“
„Dann ist es doch wahrscheinlich, dass dieser Benno es nur nicht wahrhaben wollte, dass die Beziehung in die Brüche geht oder gar nicht erst aus den Startlöchern kommt“, hat Hussmann gekontert.
Diesem Ansatz bleibt er bis auf weiteres treu. Warum sonst ist Klausen in die Wohnung der jungen Frau eingebrochen?
„Ich habe sie von draußen liegen sehen, da habe ich mir Sorgen gemacht!“, lautete die Antwort des Verdächtigen auf die entsprechende Frage.
Dabei zeigen die Fotos vom Tatort, dass er sich schon enorm angestrengt haben muss, etwas von außen durch die spiegelnde Fensterscheibe hindurch zu erkennen. Die Frau lag größtenteils im Sichtschutz der Möbel im Wohnzimmer.
„Als ich reinkam, war sie schon tot. Meine Wiederbelebungsversuche haben sie nicht zurückgebracht“, hat Klausen geschluchzt. Hussmann hält das für eine Masche. Eine vorgetäuschte Reanimation ist ein probates Mittel, um Spuren durcheinanderzubringen, abzuschwächen oder gleich ganz zu tilgen.
„Mord im Aktivistenmilieu“, haben die Zeitungen getitelt, die unweigerlich Wind von der Sache bekommen haben. So eine Untersuchung geht nicht ohne einen mittleren Auflauf an Polizei am Tatort vonstatten. Da sind Zaungäste aus der Nachbarschaft oder neugierige Passanten vorprogrammiert. Diese bilden wiederum das Futter für gierige Journalisten, die ausfragen, wer dort wohnt, was diejenige so getan hat und was an ihr besonders ist. Und danach geht es gleich darum, wer der junge Mann ist, den man abgeführt hat und von dem der Fotografenkollege gerade so noch eine Aufnahmegelegenheit erhascht hat.
So bekommen die Vertreter der berichtenden Zunft einen Zugriff auf das Thema und fördern schnell weitere Informationen an die Oberfläche: Diese Pia war an politischen und Umweltaktionen beteiligt. Auch ihr Bekannter oder Freund oder Geliebter Benno wurde in diesen Kreisen gesehen.
Dass Mainburg und Klausen einer Aktivistengruppierung angehören, gießt Öl ins Feuer des öffentlichen Interesses. Von diesen Zusammenballungen gibt es so viele, dass man sich die Namen gar nicht merken kann. Aber gemein haben sie, dass sie eine schillernde Anmutung haben, dass sie der Zusammenhalt stärkt, dass Freunde nicht nur Freunde, sondern Verbündete sind. Und sie pflegen den Austausch. Es gibt eine Bandbreite von Treffen – offizielle an einem neutralen Ort, regelrechte Kongresse und welche im kleinen Kreis zu Hause. Sie bewegen sich nicht in der Illegalität, also können sie abhalten, was sie wollen.
Dieser Umstand ist nicht jedem Bundesbürger bekannt. Manche fragen sich zum Beispiel, ob sie das Wort Chaos Computer Club überhaupt öffentlich aussprechen dürfen oder ob sie sich damit als Systemfeinde offenbaren. Diese Befürchtungen sind unbegründet. Es geht hier nicht um Verbrechen.
Und beherbergt eine Organisation wie der CCC nun Hacker oder Aktivisten oder beides oder keins von beiden? Die Dinge sind doch stets im Fluss.
Aktivisten gelten allerdings fernerhin nicht als Asketen. Bei denen ist tendenziell mehr los als in einem durchschnittlichen Spießerhaushalt. Auch in der Wohnung von Frau Mainburg gab es einigen Durchlauf, wenn man nach den Aussagen der Nachbarn geht. Da ist es nicht verwunderlich, dass man Haare findet, deren Besitzer nicht in der Datenbank der bekannten Straffälligen auftauchen. Auf Spuren dieser Art kann man keine alternativen Theorien gründen.
Es bleibt also dabei: Alle Wege führen zu Klausen, und zwar ziemlich geradlinig.
Eine Statistik zur Statistik
Dr. Zerber, Wahlforscher – das steht auf dem Schild an der Tür, vor der Kommissarin Wilke und Ansgar Boldt stehen, um sich über Wahlen und das Verhältnis zwischen den Erwartungen im Vorfeld und dem eigentlichen Ausgang schlauzumachen. Ihr besonderes Interesse gilt dabei Abstimmungen, die einen unerwarteten Verlauf nehmen. Hinter ihrem Wissensdurst steht die Frage, welches Gewicht sie der Anzeige beimessen können, der sie nachgehen. Ist sie fundiert oder ist es eine haltlose Behauptung?
Ein schwächliches „Herein“ heißt sie willkommen. „Nehmen Sie doch Platz“, bietet ihnen der altehrwürdige Experte eine Sitzgelegenheit an. Er macht die Andeutung aufzustehen, aber Wilke hält ihn schnell davon ab, damit nicht aus bloßer Etikette etwas passiert. Der Mann kratzt seinem Aussehen nach zu urteilen knapp am dreistelligen Alter. Tja, seine Wahlforscherrente scheint nicht zu reichen und er bessert sie mit Terminen und Beratung auf.
Wilke schluckt einen kleinen Zweifel hinunter, ob sie den richtigen Experten gewählt haben. Doch er hatte aktuelle und ausgesprochen positive Beurteilungen.
Boldt hat unterdessen den Rollator hinter der Eingangstür bemerkt, den der Herr des Büros gewöhnlich benutzt, und ist deshalb prophylaktisch in einer für ihn untypisch schnellen Bewegung neben den Schreibtisch gesprungen und steht bereit, den Alten aufzufangen wenn nötig.
Doch der greise Experte belässt es bei der Geste und verbleibt in seinem Stuhl. Er ist erleichtert, dass er diese körperliche Herausforderung auslassen kann. Er muss sich seine Kräfte einteilen. Gegen ihn sind diese zwei Polizisten Jungspunde und er hat denen auch so gezeigt, dass er ein Mann der alten Schule ist.
Genau dieser Umstand lässt Wilke einen besorgten Blick zu ihrem Kollegen werfen. Findet sich Opa Zerber überhaupt in der neuen Zeit zurecht? Wird er ihnen einen dicken ausgedruckten Aktenwälzer präsentieren? Einen zum Selberlesen?
Doch das tut er nicht. Stattdessen zieht er einen flachen Tabletcomputer aus der Schublade, den er mit Sprachbefehlen bedient.
„Sie schrieben ja in Ihrer E-Mail von einer Anzeige wegen Abweichungen zwischen Wahlprognose und dem Wahlergebnis selbst. Hierzu zeige ich Ihnen was.“
Damit dreht er flugs sein Display um und hält es den beiden unter die Nase. Sie versuchen, die Diagramme vor ihren Augen zu entschlüsseln: Da sind Balken nebeneinander aufgereiht, die die Wählerstimmen pro Spitzenkandidat ausweisen. Die Darstellung zerfällt in zwei Abschnitte: „vor der Wahl“ und „Wahl“.
„Oh“, vermag selbst Boldt seine Verblüffung nicht zurückzuhalten.
„Voraussage und Wahl liegen schon etwas auseinander, oder?“, versucht sich auch Wilke in einer Interpretation.
Der Alte dreht das Tablet zu sich, wischt kurz. „Und ich will Ihnen noch eine Wahl zeigen.“
Das Bild ist recht ähnlich.
Wieder wischt er.
Es tauchen andere Politikernamen auf. Auch ändern die Balken ihre Größe, aber die Unterschiede zwischen vor der Abstimmung und danach bleiben bestehen.
Der Dr. wischt noch ein paar Mal. Die Darstellung folgt dem bekannten Schema.
„Also haben wir schon einen messbaren Gegensatz“, orakelt Wilke. „Wählen wir falsch oder vielmehr: Zählen wir falsch?“
„Könnte man meinen“, stimmt ihr der Alte zu. „Aber wissen Sie, was ich Ihnen da gerade gezeigt habe?“ Dabei macht er große Augen.
Boldt räuspert sich, weil er nicht so auf Ratespiele steht.
Die Antennen des Experten oder vielmehr sein Hörgerät nehmen das auf und daher spannt er seine Gäste nicht lange auf die Folter. „Das waren allesamt Zahlen aus dem 20. Jahrhundert!“
„Noch die alte Form der Wahl?“, kann Boldt seine Verwunderung zum zweiten Mal nicht im Zaum halten. „So richtig mit Kreuz und Papier?“
„Ganz genau!“
Per Sprachbefehl holt Dr. Zerber die Zahlen des aktuellen 21. Jahrhunderts auf den Schirm. „Sehen Sie, die Balken sind etwas anders. Das Prinzip bleibt aber gleich.“
Nachfolgend erläutert er, dass es eine Statistik über die Wahlstatistiken hinweg gebe, die die Differenz zwischen Voraussage und Ergebnis analysiert. „Danach liegen wir aktuell ziemlich nahe am langjährigen Mittel. Die Klick-Demokratie, wie es so schön heißt, ist besser als ihr Ruf – zumindest von meinem Blickpunkt aus.“
„Die elektronische Wahl bringt keine Ausschläge in der Abweichung?“, wundert sich Wilke. Dabei kann sie sich noch gut an all das Trara bei der Einführung erinnern.
„Anfangs schon, wegen des Schubs, den die hohe Wahlbeteiligung gebracht hat. Aber das hat sich eingependelt“, bestätigt Zerber. „Sehen Sie, wenn die Leute auf der Straße oder vor dem Rechner sitzend für eine Prognose gefragt werden, was sie als Nächstes wählen, dann denken sie im Jetzt und Heute und dann sagen sie, was ihnen auf der Zunge liegt – entdecken den kleinen Revoluzzer in sich wieder, der sie vielleicht mal waren.“
„Und das ändert sich bei der eigentlichen, echten Abstimmung?“, fragt Wilke.
„Ja, denn dabei denken sie an die Bedeutsamkeit ihrer Entscheidung und dass sie mit ihrer Stimme etwas bewegen und dass das zählt und dass sie danach viel Zeit vor sich haben, sich zu ärgern, wenn sie das Falsche genommen haben. Mit anderen Worten. Sie denken an das Morgen!“
„Und dabei befällt sie die Angst vor der eigenen Courage“, sinniert Boldt.
„So ist es!“ Der Alte macht eine leichte, gemütliche Schaukelbewegung auf seinem Stuhl. Das ist die kleine Portion Frohsinn, die er sich gönnt und die seine Muskeln zulassen.
„Wissen Sie, es gibt da immer so einen Abstand oder Puffer zwischen Vorhersage und Ergebnis. Oder nennen Sie es Schwankungsbereich. Den haben wir seit Jahren nicht verlassen.“
„Aber was sagen Sie“, entdeckt Boldt sein Faible für den Zweifel wieder, „wenn sich nun jemand, der mit den Möglichkeiten der heutigen Zeit ausgestattet ist, diesen Puffer oder Schwankungsbereich zunutze macht und darin Manipulationen versteckt?“
„Das ist natürlich ein guter Punkt“, gibt der Alte zu und hört auf, auf seinem Stuhl zu wippen. „Ich als Wahlforscher kann nur sagen, ab wann Ausreißer in den Ergebnissen unerwartet sind. Dafür hat es schon Fälle gegeben. Doch aktuell ist das wenig offensichtlich. Ich habe also keinen konkreten Verdacht. Ob hier trotzdem ein böser Bube die Hände im Spiel hatte, ist eine technische Frage und das können nur Sie als Polizisten herausfinden und am Ende beantworten. So weit reicht nur Ihr Arm.“
Damit hat er den Ball galant zurück in das Feld der Polizei gespielt und wippt wieder auf seinem Stuhl – wie ein Schüler in der ersten Klasse. Das Leben ist ein ewiger Kreis.