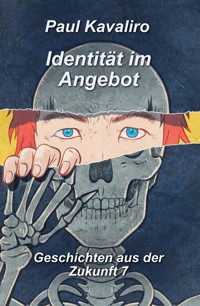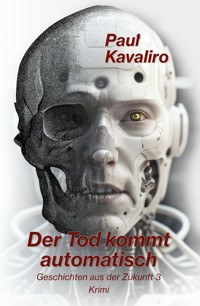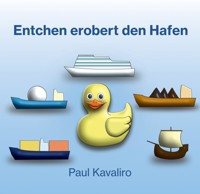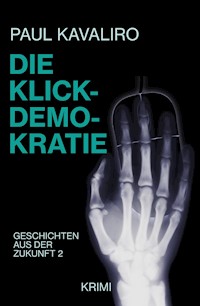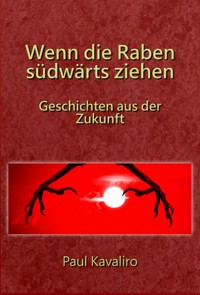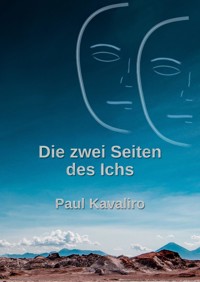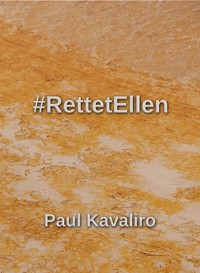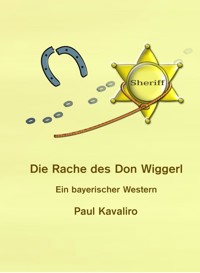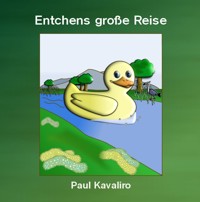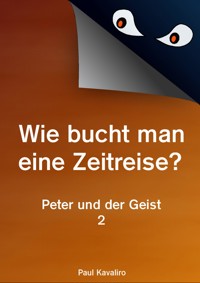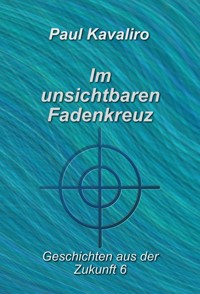
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Während sich Kommissarin Wilke und ihr Team im Erfolg der vorigen Ermittlung sonnen, tauchen Unbekannte auf, die noch eine Rechnung mit ihnen offen haben. Ein Attentat mit einer neuartigen Waffe ist der Auftakt zu einem Katz- und Mausspiel um Technologie, Diebstahl und einen Todesfall, den man schon zu den Akten gelegt hatte, der aber ein dunkles Geheimnis birgt. Wilke gerät unter Zeitdruck, denn die Öffentlichkeit ist in Aufruhr angesichts der Bedrohung durch den neuen Terror, vor dem sich niemand schützen kann. Und die Täter stellen ein Ultimatum und drohen schon mit dem nächsten Einsatz der Waffe. Den Ermittlern bleibt nur eine Woche Zeit, um das Puzzle zu lösen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 207
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Im unsichtbaren Fadenkreuz
Geschichten aus der Zukunft 6
Paul Kavaliro
Buchbeschreibung
Während sich Kommissarin Wilke und ihr Team im Erfolg der vorigen Ermittlung sonnen, tauchen Unbekannte auf, die noch eine Rechnung mit ihnen offen haben.
Ein Attentat mit einer neuartigen Waffe ist der Auftakt zu einem Katz- und Mausspiel um Technologie, Diebstahl und einen Todesfall, den man schon zu den Akten gelegt hatte, der aber ein dunkles Geheimnis birgt.
Wilke gerät unter Zeitdruck, denn die Öffentlichkeit ist in Aufruhr angesichts der Bedrohung durch den neuen Terror, vor dem sich niemand schützen kann.
Und die Täter stellen ein Ultimatum und drohen schon mit dem nächsten Einsatz der Waffe.
Den Ermittlern bleibt nur eine Woche Zeit, um das Puzzle zu lösen.
Über den Autor
Paul Kavaliro schreibt Bücher für Kinder (Spuk für Anfänger, Entchens große Reise) und Erwachsene (Final Logout, Die zwei Seiten des Ichs, Wenn die Raben südwärts ziehen, Die Klick-Demokratie, Herrscher der Gedanken), auch als Ratgeber (Heimwerken macht sexy).
Beim Literaturwettbewerb Goldenes Kleeblatt gegen Gewalt 2024 erhielt er den 2. Preis.
Im unsichtbaren Fadenkreuz
Geschichten aus der Zukunft 6
Paul Kavaliro
Impressum
Texte und Umschlag:
© Copyright Alf Ritter
Bild:
vargazs auf Pixabay
Verlag:
Alf Ritter
Weidenstraße 10A
D-85253 Erdweg
E-Mail:
Druck:
epubli – ein Service der Neopubli GmbH, Berlin,
www.neopubli.de
Erstveröffentlichung:
23. Mai 2025
Noch so ein Termin
Tag 1, Montag, 7:40 Uhr
Kommissarin Leonie Wilke kämpft gegen ein Gähnen an, als sie sich an diesem Wochenanfang an ihren Tisch im Büro setzt. Mal sehen, was diese Woche für sie bereit hält. Läge etwas Spannendes an, dann hätte man sie schon lange zu einem dieser Notfälle gerufen, bei dem Leute wie sie tun, was Kommissare eben tun: Licht in das Dunkel einer Straftat bringen. Aber an diesem Wochenende ist ihr Telefon stumm geblieben. Und sie hat es genossen, konnte sich ausruhen. Warum sie trotz all der frisch getankten Kraft gähnt? Diese Woche beginnt im grauen, normalen Trott. Da darf eine Kommissarin schon mal gelangweilt reagieren.
Wie jeden Morgen geht sie die aufgelaufenen elektronischen Botschaften durch. Neben den üblichen Berichten zur Kenntnisnahme liegt diesmal außerdem eine E-Mail der Pressestelle der Polizei in ihrer Inbox. Was wird heute die nächste Jubelbotschaft sein? Doch es ist nicht eine dieser Rundmails, in der mit einer neuen Ausrüstung geprahlt oder ein Erfolg gefeiert und breitgetreten wird. Diese Nachricht hier geht nur an sie, ihr Kernteam und ihren Chef Heiner Althaus. „Die Kollegen Öffentlichkeitsarbeiter wissen noch, dass es uns gibt“, murmelt sie und liest genauer.
Soso, es liegt eine Interviewanfrage von einem Journalisten vor. Die Pressestelle hat den Originaltext des Herrn mit Namen Peter Schulz angehängt. „Wir treffen uns vor dem Polizeigebäude zu einem Foto und ich freue mich darauf, Sie anschließend im Gespräch näher kennenzulernen. Wir polieren Ihre Medienpräsenz auf!“, verspricht er.
„Tsiss!“, schüttelt Wilke den Kopf. Das ist zwar charmant formuliert, denn Presseleute wissen Sprache zu gebrauchen. Es klingt allerdings auch wie das Inserat einer Renovierungsfirma, die den bröckelnden Putz am Haus in eine strahlende Fassade verwandelt.
Und das passt zu Wilkes Situation. Ihre Truppe mit Ansgar Boldt, Nora Fist und der externen Beraterin Merle Beirer stand unmittelbar nach dem Ende der Kampfhandlungen des digitalen Erstschlags hoch im Kurs bei den Medien. Unter diesem Schlagwort werden im etablierten öffentlichen Sprachgebrauch die Cybersecurity- und Terrorattacken zusammengefasst, die bis vor einem reichlichen Monat das Land, den Kontinent, ja den gesamten Globus erschüttert haben. Es gab Ausfälle, elektronische Lebensadern hatten nicht mehr den Pulsschlag, den die moderne Gesellschaft braucht. Das Leben wurde auf den Kopf gestellt. Zum Cyberkrieg kamen Sprengstoffanschläge hinzu. Opfer waren zu beklagen.
Wilkes Gruppe hat maßgeblich dazu beigetragen, dass eine klebrige Mischung aus Interessenvertretern und Industrie, gepaart mit der Sicherheitsorganisation White Hat und schwarzen Schafen aus anderen verbündeten Sicherheitsfirmen, aufgedeckt und aufgelöst wurde. Als Zugabe waren zwielichtige Kriminelle ebenfalls Teil der Bewegung. Jetzt beschäftigt sich die Justiz mit ihnen.
Die Trockenlegung dieses Sumpfes genießt den Ruf der Nachhaltigkeit. Die Bürgerschaft atmet auf, die Sicherheit kehrt zurück und der Schleier des Vergessens legt sich allmählich über diese chaotische Phase der Erschütterung der Gesellschaft in ihren Grundfesten. Parallel zur kollektiven Rückgewinnung des komfortablen Lebens mit Messengern, Streaming und allem, was vernetzte Geräte vom Mobiltelefon bis zum Supercomputer bieten, ist auch das journalistische Interesse an Wilkes Mannschaft erkaltet – und zwar schneller als ein dünner Lavastrom im eiskalten Island.
Doch jetzt kommt dieser Peter Schulz und nährt die Hoffnung auf Aufmerksamkeit. Dabei braucht Wilke das Rampenlicht nicht. Auch die Kollegen in ihrer Gruppe sowie ihr Chef Althaus drängt es nicht in die medialen Scheinwerfer. Aber öffentliches Interesse wird insbesondere in höheren Sphären des Polizeiapparates bemerkt und damit steigt gleichzeitig die Chance auf mehr Budget und größere Möglichkeiten, auf eine attraktivere Aufklärungsrate. Kurz gesagt: auf ein besseres Polizistenleben. Und wer will das nicht?
Als Wilkes Blick auf die Teilnehmerliste des Journalistentermins fällt, versetzt das ihrer aufkeimenden Freude einen Dämpfer. Die polizeiliche Presseabteilung wird keinen Vertreter schicken; auch wird Althaus der ranghöchste Anwesende sein. Also gibt es weder Händeschütteln mit höheren Polizeirängen noch öffentliche Versprechungen in Richtung einer gesteigerten Aufmerksamkeit und aufgestockter Mittel für Wilkes Terrain der „Neuen Verbrechen“.
Die Pressestelle setzt neuerdings auf andere Pferde und stellt ihre Truppe nicht mehr von sich aus ins öffentliche Schaufenster. Und dafür hat sie leider einen Anlass. Es ist eine Sache, die an der Kommissarin nagt: Im harten Kampf gegen White Hat und deren Kolonnen hat man nach polizeilicher Abstimmung auf dem kurzen Dienstweg die Gegner aufeinandergehetzt, um Strukturen zu erkunden. Zwietracht in den Verbrecherreihen führte zu internen Säuberungsaktionen, zu Opfern, zu Kollateralschäden, wie es offiziell heißt. Der Kampf stand auf des Messers Schneide und so war man aufseiten der Ordnungshüter nicht wählerisch.
Wilke und den Sicherheitsorganen insgesamt wurde daraus kein Strick gedreht. Doch es wurde andererseits auch niemand mit Lorbeeren überhäuft. Die Orden warten weiter in den Schubladen auf irgendeinen anderen Jubilar. Journalistisches Interesse hat die Pressestelle zwar nicht abgewürgt. Man entfacht jedoch keine neue Aufmerksamkeit: Galaveranstaltungen bleiben aus, Details und Erfolgsgeschichten werden unter der Decke gehalten. Niemand erfährt, wie es den Gegnern an den Kragen gegangen ist. Unauffälligkeit lautet das Motto. Die Kommissarin bleibt in dieser Situation in einer Mischung aus erfolgloser Verdrängung und Gewissensbissen zurück, weil sie eine der Personen ist, die nicht wählerisch gewesen sind.
Zum Glück treffen Wilke in dieser Phase ein paar Freuden des Alltags und sorgen für Ablenkung. Einen bedeutsamen Fortschritt gibt es nämlich in der Entwicklung ihres Sohnes Laurenz zu vermelden: Er hat ein Schülerpraktikum bei der Polizei angetreten. Er geht am Gymnasium zur Schule und nutzt die dort extra für Praktika vorgesehenen Wochen, um sich ein eigenes Bild von der Verbrechensbekämpfung zu machen – über das hinaus, was er von seiner Mutter mitbekommt. Gefüttert wurde sein Interesse von einem von Wilkes Kontakten aus der zurückliegenden Ermittlung: Jochen Hamberg, der offiziell das Siegel „Verbindungsmann“ trägt, aber gerüchteweise ein Geheimdienstler ist. Er hat Laurenz mit Informationsmaterialien versehen, die tatsächlich gezündet und sein Interesse geweckt haben.
Die zukünftige Berufswahl wirft ihre Schatten voraus und Wilkes Sohn sieht sich um, was für ihn taugt. Jetzt läuft er hier als Praktikant mit, begleitet so manchen Termin und wird ansonsten von vertraulichen Daten und von brisanten Rendezvous mit gewaltbereiten Kräften ferngehalten. Abends unterhält er sich mit seiner Mutter regelmäßig über die gewonnenen Einblicke. Wilke freut sich darüber, dass sie wieder mehr gemeinsame Themen haben.
Die Polizei buhlt nicht gerade um Hospitanten im Schüleralter. Sie könnten ja den besagten Gefahren begegnen und außerdem Kraft und Konzentration von den sie betreuenden Polizisten abzweigen. Doch die mütterliche Fürsprache bei den Entscheidungsträgern hat den Weg geebnet. Nun ist er hier in ihrer Dienststelle, sperrt Augen und Ohren auf und heimst Eindrücke ein.
In eine technische Studienrichtung wird er später alternativ ebenfalls reinschauen. Aber darin liegt nicht seine oberste Priorität. Denn er blickt sich auch in seinem Umfeld um – zum Beispiel auf Elternbeispiele seiner Mitschüler. Und er hat bemerkt, wie die sich als Ingenieure mit anderen Technikfreaks umgeben, um nach Fortschritt zu streben und dabei im eigenen Saft zu schmoren. Das betrachtet er als einen Sprung hinein in eine Schublade, aus der man nicht so leicht wieder herauskommt. Die Nähe von sogenannten Fachidioten oder Nerds bereitet ihm Unbehagen.
Was er ebenfalls überlegt: Wird er Journalist? Er hat Interesse für alles Neue; wer hat das nicht? Als Medienvertreter kann er Weiterentwicklungen begleiten und kommentieren, einordnen, beflügeln und vor negativen Begleiterscheinungen warnen. Das ist reizvoll. Aber selber einen Quantensprung zu befördern – das kann der zuvor genannte Techniker besser. Und der ist für Laurenz wie gesagt nicht die erste Wahl.
Dann bleibt eben noch der Polizist, der darüber wacht, dass der Fortschritt auch wirklich zum Segen der Menschen angewendet wird. Wenn der junge Wilke auf die Taten seiner Mutter blickt, so hat sie Betrügern im neuartigen elektronischen Wahlsystem auf die Finger geklopft und die Demokratie bewahrt. Außerdem hat sie dafür gesorgt, dass Lebensmittelhersteller die Segnungen des modernen gedruckten Essens nur mit nicht manipulativen Zutaten versehen. In einem anderen Meilensteinfall hat sie bei der Etablierung der direkten Kommunikation zwischen menschlichem Gehirn und Maschine knifflige Rätsel gelöst und Morde aufgeklärt. Und zuletzt hat sie entscheidende Impulse gegeben, dass ein Ausfall all der Technik und Computernetzwerke nicht in einem gesellschaftlichen Tsunami mündet, der alles wegschwemmt. Der Wert dieser Tätigkeit offenbart sich ihm glasklar. Das kommt auch in den Gesprächen mit seiner Mutter rüber.
Wenn Wilke ihrem Sohn nun von dem neuerlichen Pressetermin erzählt, dann wird ihm das eher Auftrieb geben und die Polizei in einem noch besseren Licht erscheinen lassen. Dieser Peter Schulz scheint ein Freund der Gilde der Ordnungswächter zu sein. In der E-Mail sind drei Links auf Berichte und Interviews enthalten, die er geführt und die die Presseabteilung durchgesehen hat. Missfällige Akzente sind dort nicht zu finden.
Und die bisherige Berichterstattung über seine Mutter hat Laurenz mit Aufmerksamkeit, wenn auch teilweise kritisch verfolgt.
Dadurch liegt für Wilke in jeder Reportage ein Anreiz. Wie viele Berufe gibt es, in denen es der tägliche Kampf und das stete Bemühen des Einzelnen es eben nicht aus dem grauen Nebel der öffentlichen Nichtbeachtung nach oben ans Licht schaffen? Die E-Mail der Pressestelle verspricht neuen Sonnenschein. Wilke wird die wohlige Wärme für einen Moment genießen, bevor sie mit ihren Leuten abermals im Dunst des Alltags verschwindet.
Der Schuss
Tag 8, Montag, 7:30 Uhr
Das Wochenende ist vorbei und Wilke sitzt wieder am Schreibtisch, sortiert wie immer die Neuigkeiten in ihrer Inbox. Die 7 Tage bis zum Termin mit dem Journalisten sind schnell vergangen. In einer Stunde wird es losgehen. Jedes dieser Interviews ist wie eine Wundertüte. Was wird dieser Schulz wissen wollen? Sie fragt sich zum Beispiel, welche Antwort sie auf die mögliche Frage geben soll, was ihre größte Tat der letzten sieben Tage gewesen sei. „Nichts Weltbewegendes“, lautete die wahrheitsnächste Erwiderung. Im Kommissariat geht es zurzeit beschaulich zu. Nicht dass das ein übler Zustand ist und sich jemand beschweren würde. Im Gegenteil – bei jedem Kriminalfall wird das Schicksal von Menschen berührt. Manche von ihnen stürzen dabei in ein Unglück, wenn nicht sogar in eine persönliche Katastrophe. Das ist belastend für alle Beteiligten.
Gleichzeitig bedeutet die Abwesenheit von all dem Tumult: kein Drama. Und diese Situation bietet nicht den idealen Nährboden für einen Mann der Presse. Also wird der sicher versuchen, das Besondere herauszukitzeln, Informationen freizulegen, so wie ein Ermittler das in seinem Alltag tut. Nur eben kann dann jeder hinterher in der Presse darüber lesen. Das ist heikel.
Peter Schulz trifft pünktlich ein. Wilke läuft zusammen mit den anderen und mit leicht weichen Knien die Treppen hinunter in Richtung Eingang. Das geplante Foto vor dem Haus ist eine willkommene Gelegenheit zum Lockermachen und Kennenlernen.
Außerdem verbringen die Polizisten schon genug Zeit in den Diensträumen. Entgegen der romantischen Verklärung in Kriminalromanen und -filmen findet im modernen Ermittleralltag der Großteil der Arbeit innen statt: in Datenbanken recherchieren, Daten heraussuchen und abgleichen, Profile studieren, Querbezüge herstellen und sich weiteres Wissen anlesen, wo nötig. Wenn man nach all dem mit den Kollegen Informationen abzugleichen hat, dann veranstaltet man das, was typische Sesselpupser tun – ein Meeting im Besprechungszimmer mit schier endlosen Dialogen. Die paar Termine an Tatorten, um sich ein Bild zu machen oder Ausflüge in die Gegend, um Zeugen zu befragen, nehmen sich dagegen bescheiden aus. Sie sind ein Farbtupfer im Alltag.
Es spricht daher für die journalistische Intuition, dass Schulz die Ermittler aus der Sauerstoffarmut des Kommissariats an die frische Luft lockt. Das hat er geschickt eingefädelt; gleichzeitig sorgt er so für den nötigen Schwung.
Nur Merle Beirer taut nicht auf. Es ist Montag, es ist früh am Tag und die Laune kommt nicht so recht in Gang. Boldt und Fist verhalten sich ebenfalls still und laufen so mit. Wilke schaltet in den Beobachtungsmodus. Sie wartet ab, wann es etwas zu sagen gibt. Vorher mischt sie sich nicht ein, denn ihr Vorgesetzter Althaus ist bereits in Fahrt und schon mitten in den Small Talk mit dem Vertreter der Presse eingetaucht.
Dieser Herr Schulz ist der erwartet eloquente Repräsentant seiner Zunft. Er ist mittleren Alters, dabei freundlich und sprachlich gewandt. Seinen leichten französischen Akzent begründet er mit seiner Zweisprachigkeit. Galant bindet er alle ein, hat für jeden ein nettes Wort. Sogar Beirers Miene hellt sich auf. Er knipst die gute Laune wie mit einem Lichtschalter an.
Boldt stupst Wilke in die Seite: „Der will vorankommen.“
Sie nickt. „Dafür ist er in der besten Zeit des Lebens.“
„Wenigstens ist das nicht so ein Hochglanz-Lackaffe. Anders als die, mit denen wir schon zu tun hatten“, tuschelt Boldt zurück. „Der steht zu seinem Alter und färbt sich nicht die Haare.“
Schulz‘ blonder Kopfschmuck ist nämlich bereits von ein paar grau angehauchten Strähnen durchzogen. Der leichte Wind heute Morgen fährt hinein und zerzaust sie ein wenig, was einen unfreiwillig komischen Anblick ergibt. Der Journalist versucht die Haarpracht mit den Fingern zu bändigen, was misslingt. Seine Bewegungen wirken etwas hektisch. Ist er ebenfalls nervös? Und wenn schon. Das macht ihn noch sympathischer, menschlicher. So einem gibt man gerne Interviews und posiert für einen Schnappschuss mit der Kamera.
Als er die fünfköpfige Polizistengruppe in Position für das Foto bringt, ist er in seinem Element. Er zieht den einen mal hierhin, die andere dahin, bis alle in durchdachter Ordnung vor ihm stehen. Althaus landet in der Mitte, flankiert von Wilke und Fist, Beirer und Boldt besetzen die Ränder.
„Sind wir außen vor?“, flachst Boldt.
Schulz quittiert den Spruch mit einem ultrakurzen Lächeln.
Jetzt greift er in seine Umhängetasche und holt den Fotoapparat heraus.
„Na so was, der macht alles allein“, flüstert Boldt zu Fist neben sich. „Der bringt noch nicht mal einen echten Fotografen mit.“
„Oh, haben Sie Zweifel?“, lässt Schulz sein sensitives Gehör aufblitzen. „Urteilen Sie, wenn das Ergebnis da ist. Dann sehen Sie, ob ich ein Profi bin oder nicht.“
Das bringt den schnippischen Boldt zum Schweigen.
Da stehen sie nun – aufgereiht wie Modelle für ein Ermittler-Denkmal.
Schulz reckt ihnen seine Kamera entgegen, macht Probeaufnahmen. „Ich überprüfe noch die Belichtung. Bitte bleiben Sie in Position!“, spult er sein Standardprogramm ab.
Boldt wundert sich, warum er keine zusätzlichen Lampen oder ein Blitzlicht dabei hat. Oft geraten Schatten in den Gesichtern zu dunkel. Aber er sagt nichts, will nicht eine Grundsatzdebatte vom Zaun brechen.
Die Polizisten harren wie erstarrt aus, während um sie herum das Leben pulsiert. Autos fahren die mehrspurige Straße entlang. Parken ist nur gegenüber vom Polizeigebäude erlaubt. Eine Reihe von Drohnen zieht in der Luft vorbei, um kleine Lasten zu tragen, oder nur zur Beobachtung. Das Summen ihrer Elektromotoren ist heutzutage allgegenwärtig in der Öffentlichkeit. Man nimmt es gar nicht mehr bewusst wahr.
„Ich wäre dann so weit“, übertönt Schulz den Straßenlärm.
Die Porträtierten straffen nochmals ihre Statur. Auf solchen Bildern ist eine starke Pose gefragt, kein krummer Rücken oder hängende Schultern. Die Körpersprache ist der Schlüssel zu einem gelungenen Auftritt. Und das ist hier das Ziel.
Schulz nimmt die Anstrengungen wohlwollend wahr und führt den Sucher seiner Kamera zum Auge. Er hat sie noch nicht richtig angesetzt und den Auslöser betätigt, da sackt Althaus plötzlich zusammen. Wilke versucht ihn zu stützen. Doch er ist zu schwer und entgleitet ihr. Hart fällt er auf die Fliesen des Fußwegs, auf dem sie stehen.
„Verdammt!“, flucht Wilke. „Ein Herzinfarkt?“ Ihre Augen suchen Boldts Blick.
Der hat keine Zeit für eine Erwiderung. Stattdessen springt er vom Außenrand der Gruppe auf die Kommissarin zu und reißt sie mit all seiner Kraft zu Boden.
„Boldt?! Was in aller Welt ...?“, stößt sie aus.
Doch der Kollege antwortet nicht, sondern packt sie am Arm und zieht sie wieder hoch. Er stellt sich zwischen die Straße und Wilke. „Sofort zurück ins Haus!“, brüllt er. „Das ist ein Anschlag!“
Schulz steht mit seiner untätigen Kamera in der Hand da und verfolgt die Szene wie versteinert.
„Keine Fotos mehr! Gehen Sie in Deckung!“, ruft ihm Boldt zu.
Die Polizisten retten sich ins Haus. Den leblosen Althaus ziehen sie mit sich in den Flur. Weitere Beamte stürmen herbei, suchen eine Schussverletzung am Körper des Opfers, finden aber nichts, rufen den Notarzt, sichern den Eingang, fordern Verstärkung an. Der Kollege Boldt bleibt selbstbewusst bei seiner Anschlagsthese. Da wird nicht debattiert, da wird gehandelt.
Ein Krankenwagen trifft Minuten später ein, kurz darauf noch einer. Bei einem Notruf durch die Polizei schlägt nicht die Stunde der Sparsamkeit.
Vereint machen sich gleich zwei Ärzte an Althaus zu schaffen. Wilke atmet auf, als sie die Herzdruckmassage und Beatmung kurz darauf beenden und sich weiter um das Opfer kümmern und es nicht an Ort und Stelle für tot erklären.
Sie laden ihn auf eine Trage und einer der beiden Notarztwagen prescht mit ihm davon. Das Personal des anderen sondiert, ob es noch weitere Verletzte oder jemandem mit Schick gibt.
„Wir fahren hinterher!“, will Wilke das ärztliche Prozedere nicht abwarten und winkt ihre Leute zusammen. „Die Kollegen werden in der Zeit die Szene sichern.“ Ein gegenseitiges Zunicken mit einem der Beamten bestätigt die Arbeitsteilung.
Mit immer noch zitternden Gliedern sitzen die vier Ermittler kurz danach in einem Polizeiwagen, der sie zum Krankenhaus bringt.
„Wie bist du darauf gekommen, dass das ein Anschlag ist?“, fragt Wilke.
„Die Laserpunkte auf deinem Oberkörper“, antwortet Boldt. „Die haben dich gerettet. Und dass ich sie ohne Brille sehen konnte.“
„Sind die auch auf Althaus‘ Brust erschienen? Oder woanders auf seinem Körper?“
„Keine Ahnung. Eher nein. Das ging alles zu schnell. Womöglich hätte ich doch eine Brille gebraucht.“
„Also ich habe nichts dergleichen gesehen“, meint Fist. „Du etwa?“, fragt sie Beirer.
Die schüttelt den Kopf. „Ich habe in die Kamera geschaut, sonst schmiert ihr mir später wieder aufs Brot, dass ich bei Fototerminen bei der Sache sein muss. Und überhaupt, wer weiß denn, ob die diese Punkte tatsächlich brauchen oder ob die auch so in ihr Ziel treffen? Ist eigentlich ein Schuss gefallen? Ich habe nichts gehört.“
„Ich ebenfalls nicht, doch wir haben einen zusammengebrochenen Althaus und Boldt hat Laserpunkte gesehen“, sagt Fist. „Zurück zu den Laserzeichen: Du meinst, die waren nur zur Dramatik da?“
„Kann schon sein“, spinnt Boldt anstelle Beirer den Faden weiter. „Es sollte ein Opfer geben, aber kein zweites. Die haben uns womöglich eine Hintertür offengelassen.“
„Und du hast das gecheckt und jeden mit Laserbeleuchtung auf dem Körper erst zu Boden geworfen und dann weggezerrt“, lobt Beirer. „Na alle Achtung, alter Mann!“
„Danke dir“, sagt Wilke mit leiser Stimme. „Sie hätten mich niederstrecken können wie Althaus. Dann wäre ich jetzt womöglich tot.“
„Wir alle haben in Gefahr geschwebt“, relativiert Boldt. „Wer weiß, vielleicht hatten wir einfach nur Glück und die Kanone hatte Ladehemmung?“
Sie kommen am Krankenhaus an, fragen sich nach Althaus durch. Sie werden in ein Wartezimmer verwiesen, in dem sie drei Stunden lang gemeinsam mit anderen Wartenden Löcher in die Luft starren. Wilke unternimmt einen halbherzigen Versuch herauszubekommen, wie sie Althaus‘ Angehörige erreichen kann. Dann übergibt sie die Aufgabe per Nachricht der Dienststelle. Die regeln das.
Schließlich betritt ein Arzt den Raum. „Wer gehört zur Familie oder den Kollegen von Herrn Althaus?“, fragt er in die Runde. Wilke und ihre Leute springen auf.
Der Mediziner winkt sie aus dem Zimmer heraus und führt sie in einen unbesetzten Behandlungsraum.
„Wie geht es Herrn Althaus?“, erkundigt sich Wilke. „Kommt er durch?“
Der Arzt holt Luft, ehe er antwortet. „Wir haben ihn stabilisiert, ja“, sagt er.
„Aber?“
„Das Weitere wird sich zeigen. Sein Gehirn war kurz unterversorgt. Er liegt zur Sicherheit in einem künstlichen Koma. Alles muss sich wieder einspielen, so hoffen wir.“
„Wie lange?“
„Da kann ich Ihnen keine seriöse Prognose anbieten.“
„Was ist überhaupt mit ihm passiert?“, bricht es aus Beirer heraus. Sie saß die ganze Zeit im Warteraum, hat nichts Wort gesagt und ist nicht wie sonst üblich irgendeiner Ablenkung nachgegangen. Niemand von ihnen hat es gewagt, zur Zerstreuung sein Mobiltelefon herauszuziehen – außer Wilke, die etwas organisiert hat. „Was ist das, das ihn getroffen hat? Wir haben nichts gehört, keinen Knall, und ein Mündungsfeuer hat auch niemand gesehen. Unser Kollege ist plötzlich zusammengebrochen. Am helllichten Tag. Wie nach einem Schuss aus dem Nichts, einem unsichtbaren, der keine offenen Wunden reißt und der dennoch tötet. Oder eben fast.“
„Ein Schuss? Mit einer Waffe also?“, wundert sich der Mediziner. „Wunden sind in der Tat nicht zu erkennen. Man sieht ihm äußerlich nichts an, wie Sie schon sagen. Wir haben ihn als normalen Patienten aufgenommen und behandelt, dessen Herz und Kreislauf ausgesetzt haben. Wie einer, der auf der Straße umkippt. Sind Sie sich da sicher mit Ihrer These?“
„Also die Laserpunkte auf Wilkes Jackett habe ich nicht geträumt“, beteuert Boldt. „Da hat jemand gezielt!“
„Und Althaus wurde getroffen. Ja, das ist unsere These“, bekräftigt Wilke.
„Stimmt schon, solche massiven Probleme bekommt niemand aus heiterem Himmel“, bestätigt der Arzt. „Und seine bisherige Krankenakte liefert keinerlei Hinweise auf eine Herz-Kreislauferkrankung. Da würde ich sagen: Er hatte Glück, dass die Waffe nicht stärker oder länger gewirkt hat. Dann wäre er gestorben. So kämpft er noch.“
„Schrecklich“, seufzt Fist.
„Sehen Sie es so: Er hat Glück im Unglück gehabt“, sagt der Arzt. Dann mustert er seine Gesprächspartner. „Und Sie alle ebenfalls. Das müssen wir aber untersuchen. Bitte bleiben Sie heute Nachmittag hier. Personal wird sich um sie kümmern und Tests durchführen – Herz und Kreislauf.“
Dann verabschiedet er sich vorerst. „Ich muss nach anderen Patienten sehen“, erklärt er im Hinausgehen.
Die Polizisten bleiben zurück.
„War das also ein Warnschuss?“, fragt Fist.
„Sieht so aus“, antwortet Wilke und schaut an sich herab – froh, dass sie noch in einem Stück ist. „Allerdings ein heftiger.“
Fists Telefon vibriert.
„Ein Anruf von deinen Lieben?“, fragt Boldt.
„Die kann ich hoffentlich selber informieren, damit sie sich gar nicht erst aufregen“, antwortet sie und zieht das Gerät aus der Tasche. „Das sind Alarme, die ich auf Nachrichtenkanäle gesetzt habe, wenn etwas wirklich Spannendes passiert.“
„Und?“, fragt Boldt, während die Kollegin das Display überfliegt.
„Ihr glaubt es nicht!“, stößt sie hervor.
„Was glauben wir nicht?“
„Seht selbst.“ Sie hält ihnen das Gerät hin.
Und da stehen sauber aufgereiht eine ganze Stafette an Meldungen über den Vorfall vor dem Polizeigebäude. Sie lassen nichts an Direktheit vermissen. „Tödlicher Terror gegen den Polizeichef“ ist da zu lesen. Gleich daneben prangen Fotos aus unterschiedlichen Perspektiven. Auch wenn die Gesichter darauf pixelig unkenntlich gemacht wurden, so erkennen die Ermittler doch anhand der Körperstaturen den zusammensackenden Althaus, die hilflos helfen wollende Wilke, dann Boldt in bester Bodyguard-Manier, schließlich den Rückzug ins Haus, den Notarztwagen, das Blaulicht.
„Ist das echt?“, fragt Wilke.
„Sieht mir nicht wie ein Machwerk aus der KI-Retorte aus“, urteilt Beirer nach kurzem Blick. „Insbesondere bei einer höheren Zahl von Bildern erkennt man oft irgendeinen Ausrutscher. Hier sehe ich keinen. Aber beschwören kann ich die Echtheit nicht.“
In diesem Moment klingelt Wilkes Telefon. Sie blickt auf die Anzeige des Geräts. „Die Pressestelle“, liest sie vor und verdreht die Augen. „Die erkundigen sich jetzt womöglich, wie der Termin mit Schulz lief und ob wir zufrieden sind. Mir ist im Augenblick nicht nach Presse-Tirili-Tirila.“
Sie nimmt dennoch an. Danach sagt sie kein Wort mehr, sondern hört nur zu. „Verstanden“, haucht sie am Ende kraftlos und legt auf.
„Was ist?“, fragt Boldt.
„Ein Erpresserschreiben ist eingetroffen.“
Der Brief
Tag 9, Dienstag, 7 Uhr
Der nächste Tag beginnt und im Kommissariat herrscht immer noch heller Aufruhr. Überall stehen Kollegen in Gruppen und versuchen in hektischen Gesprächen all das zu verarbeiten, was gestern vor ihrer Tür passiert ist.
Wilke macht einen Bogen um all die Grüppchen. Ihr steht nicht der Sinn danach, mit anderen außerhalb des eigenen Teams im Kaffeesatz zu lesen und Gerüchte zu befördern. Nur an dem ihr gleichgeordneten Kollegen Kevin Hussmann kommt sie nicht vorbei.
„Wenn du dir ein paar Tage freinehmen willst ...“, ist sein zweiter Satz nach der Frage, wie es ihr geht.
„Vergiss es“, würgt Wilke diesen Pfad ab. „Die Ärzte haben gestern während dieses Untersuchungsmarathons den ganzen Nachmittag über keinerlei Probleme bei uns festgestellt. Nur Althaus hat es erwischt. Und wir müssen herauskriegen, wer daran schuld ist. Zu Hause sitzen und grübeln bringt doch nichts.“
Er nickt.
„Du“, tastet er sich langsam an sein eigentliches Thema heran. „Althaus liegt im Krankenhaus und das anscheinend noch eine ganze Weile.“
„Ich weiß. War ja gestern lange genug dort.“
„Ja, und ich gehe da auch hin. Gleich heute!“