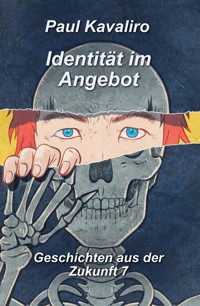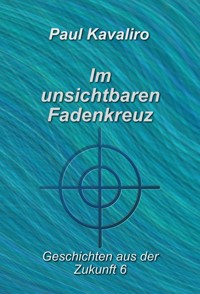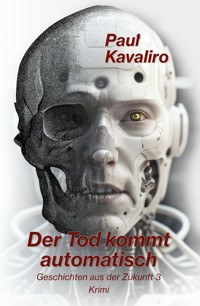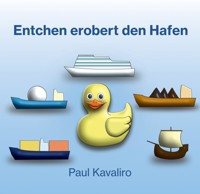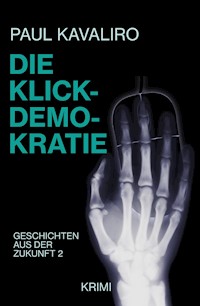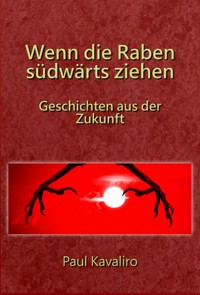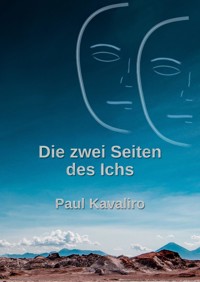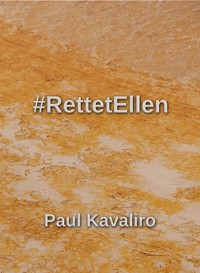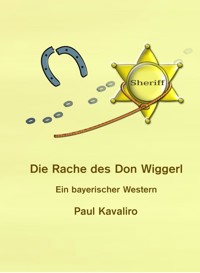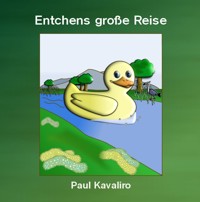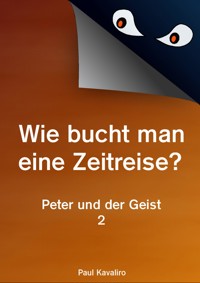Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
Kommissarin Wilke und ihr Team sind wieder im Einsatz: Ein Mord, der wie eine normale Messerstecherei aussieht, entpuppt sich als kniffliges Rätsel. Denn: Opfer und Täter sind einander vollkommen unbekannt. Und was bedeutet die unachtsam am Tatort liegen gelassene Tasche voller Geld? Technologie ist ebenfalls im Spiel und so ist es eines dieser neuen Verbrechen, für die man Wilkes Gruppe ins Leben gerufen hat. Sie muss herausfinden, wer ihr Gegner ist. Und der ist mit dem Morden noch lange nicht am Ende.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 237
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Herrscher der Gedanken
Geschichten aus der Zukunft 4
Paul Kavaliro
Buchbeschreibung
Kommissarin Wilke und ihr Team sind wieder im Einsatz: Ein Mord, der wie eine normale Messerstecherei aussieht, entpuppt sich als kniffliges Rätsel. Denn: Opfer und Täter sind einander vollkommen unbekannt. Und was bedeutet die unachtsam am Tatort liegen gelassene Tasche voller Geld?
Technologie ist ebenfalls im Spiel und so ist es eines dieser neuen Verbrechen, für die man Wilkes Gruppe ins Leben gerufen hat.
Sie muss herausfinden, wer ihr Gegner ist. Und der ist mit dem Morden noch lange nicht am Ende.
Autor
Paul Kavaliro schreibt Bücher für Kinder („Spuk für Anfänger“, „Entchens große Reise“) und Erwachsene („Final Logout“, die Trilogie „Die zwei Seiten des Ichs“, „Wenn die Raben südwärts ziehen“, „Die Klick-Demokratie“), auch als Ratgeber („Heimwerken macht sexy“).
Herrscher der Gedanken
Geschichten aus der Zukunft 4
Paul Kavaliro
Impressum
Texte und Umschlag:
© Copyright Alf Ritter
Bilder:
Cico Zeljko (Titelbild) und Ivana Tomášková auf Pixabay
Verlag:
Alf Ritter
Weidenstraße 10A
D-85253 Erdweg
E-Mail:
Druck:
epubli – ein Service der Neopubli GmbH, Berlin,
www.neopubli.de
Erstveröffentlichung:
Juli 2024
Eilig
Scheinwerferkegel huschen auf der Straße vorbei.
Thilo Heimann nimmt sie nur aus den Augenwinkeln wahr, während er die Chaussee entlang eilt. Nur wenn eines der Autos seine Fahrt verlangsamt, schaut er genauer hin. Sobald klar ist, dass es nur abbremst, aber weiterfährt, richtet er seinen Blick wieder voran.
Es zieht ihn nach Hause, weg von der Erledigung, die er heute zu Ende gebracht hat. Eigentlich war es ein Treffen, ein bedeutendes. Sein Puls ist noch nicht wieder in den normalen gemächlichen Rhythmus zurückgekehrt. Er hämmert in seinen Adern, bis hinauf zum Hals.
Thilo schüttelt seinen Arm, als könnte er seinen Blutmotor damit verlangsamen, besänftigen, in ruhigere Bahnen zwingen. Wenigstens kann er dadurch das Hemd zurechtziehen, das ihm unter der Jacke am Körper klebt.
Der Schweißausbruch von vorhin beim Treffen lässt allmählich nach. Er rührt nicht davon, dass er zu warm angezogen ist. Nein, die Jacke ist der Witterung des Herbstes angemessen. Sie hat eine dunkle Farbe. Er hat sie vor dem Termin aus dem Kleiderschrank gezogen, weil er sich davon einen Vorteil versprochen hat. Sie ist unauffällig, reflektiert weniger Licht. So bleibt er unscheinbar, während er durch den Abend gleitet.
Er hat eine Ware abgegeben. Und es hat sich gelohnt. Der Trageriemen der Umhängetasche zerrt an seiner Schulter. Doch das ist eine angenehme Last. Denn die Tasche ist bis zum Rand mit Geld gefüllt. Um ein Haar hätte er sie zu klein gewählt. Darüber kann er jetzt sogar lachen. Aber ein prüfender Blick über die Schulter hin zu einem der Autos, die vorbeiziehen, erstickt den Frohsinn wieder.
Dabei hat er allen Grund, erleichtert zu sein. Er hat geliefert, die andern haben, was sie gewollt haben und sie haben ihm gegeben, was er verlangt hat: einen Haufen Moneten.
Er hat das auf die alte Tour abgewickelt: Bargeld ist in den heutigen elektronisch geprägten Zeiten Mangelware. Dabei hat es nach wie vor all die süßen Vorzüge für jemanden, der gern unbeobachtet vom Auge der Gesellschaft bleibt: Es hinterlässt keine Spuren, wenn es von der Quelle zum Empfänger wandert.
Er beschleunigt seine Schritte, das befreit ihn, und zum kalten Schweiß der Aufregung von vorhin gesellt sich der von der körperlichen Anstrengung. Das ist das angenehme Gefühl wie beim Sport. Dabei umklammert er den Trageriemen seiner wertvollen Tasche. Er marschiert leicht abseits von der Straße, auf einem Radweg. Warum hat er nicht seinen Drahtesel genommen? Das Wetter war ihm zu zweifelhaft. Er hasst einsetzenden Nieselregen. Und ein Auto besitzt er nicht, aus Überzeugung. Also läuft er hier. Eilige Pedalritter, die ihm seine Bahn streitig machen, muss er im Herbst zu dieser Tageszeit nicht mehr fürchten.
Hier, ein Stück weg von der Straße, steht er nicht im Rampenlicht, denn den auf Effektivität, aber auch Sparsamkeit getrimmten Straßenleuchten geht schon wenige Meter abseits von Straße und schmalem Fußweg die Puste aus. Sie malen mehr Schatten als Helligkeit auf den zerrissenen Asphalt des Radweges.
Die Sträucher neben der Straße halten ebenfalls das Licht auf. Thilo kann sich an damals erinnern, als man sie gepflanzt hat. In den Jahren seitdem haben sie ordentlich zugelegt. Er muss seinen Blick heben, um ihre Höhe zu schätzen. Sie sind ihm wortwörtlich über den Kopf gewachsen. Das ist praktisch, denn so kann er als einsamer Wanderer nicht durchgängig von der Straße aus gesehen werden. Falls es sich seine Geschäftspartner mit dem dicken Portemonnaie anders überlegt haben und ihm mit einem Wagen folgen, dann will er es ihnen nicht zu leicht machen. Sie haben sich beim Treffen vorhin nur mit Vornamen angesprochen. Er hat seinen wahren nicht verraten und sie sicher ihren ebenfalls nicht. Aber das Geld ist echt. Er hat Stichproben genommen, hat dafür in einen sauteuren Mini-Scanner investiert. Jetzt ist er über die Anschaffung froh.
Er macht ordentlich Strecke und mit jedem Leitpfosten der Straße, den er passiert, wächst seine Zuversicht.
Was wird er mit dem Geld machen? Urlaub? Reisen? Hanna wird sich freuen. Endlich kann er ihr etwas bieten, nachdem die Gelegenheit schon lange vorbei ist, in der aus ihrer wilden Ehe eine ordentlich im deutschen, bürokratischen Standesamt eingetragene hätte machen können. Womöglich ist auch deswegen der Kinderwunsch unerfüllt geblieben, den sie in ihren Plänen hatten. Oft hat ihnen die Konsequenz gefehlt, die Sachen zu Ende zu bringen.
Aber heute ist das anders, heute hat er es durchgezogen! Und ja, jetzt kann er Hanna etwas bieten! Andererseits bräuchte das bescheidene und betagte Haus einen neuen Anstrich. Also doch nur Camping statt Flugreise? Fliegen ist so arg teuer geworden wegen der Umweltauflagen. Das ist der Zug der Zeit.
Thilo strebt jetzt auf eine belebtere Stelle der in dieser Gegend nur locker bebauten Hauptstadt zu. Da vorne gibt es ein paar Passanten. Er kann auch schon die Bushaltestelle sehen, die er im Visier hat. Von dort wird er ein Stück mit den Öffis fahren. Das ist bequem und verwischt Spuren, wenn das denn nötig ist. Doch die, mit denen er das Geschäft abgewickelt hat, wissen womöglich auch so, wo er wohnt.
Seine Beine freuen sich darauf, sich ein Stück im Bus auszuruhen. Und er wird Gesellschaft auf der Fahrt haben. Geselligkeit schafft Sicherheit. Am Wartehäuschen erkennt er aus der Entfernung eine Frau. Von ihr geht keine sichtbare Gefahr aus. Und hier vor allen Leuten wird ihn niemand über den Haufen fahren. Die Umgebung nährt seine Zuversicht.
Dabei bemerkt er nicht den Schatten, der sich aus dem Dunkel eines der stattlichen Sträucher löst, die er gerade passiert hat. Die Gestalt verfolgt ihn anfangs langsam, dann immer schneller, schließlich fliegt er auf ihn zu. Thilo hört die Schritte erst spät, als sie den abendlichen Verkehrslärm übertönen. Er dreht sich um. Eine Klinge blitzt im fahlen Licht der Laterne auf. Thilo ist wie erstarrt. Er umklammert die Tasche, versucht eine Abwehrbewegung. Zu spät. Der kalte Stahl tritt von einem stechenden Schmerz umhüllt zwischen seinen Rippen in den wehrlosen Körper ein. Thilo vernimmt den gellenden Schrei der Frau an der Bushaltestelle. Sie ist nah genug dran, um den Überfall zu sehen.
Es folgt ein weiterer Stich. Und noch einer.
Thilo taumelt. Er fällt zu Boden, der ihn nur kurz aufhält. Er stürzt immer tiefer, hinein in eine pechschwarze Dunkelheit, während seine Sinne erlöschen.
Im Dienst
Das ist einer dieser Abende im Herbst, an dem man einfach nur froh ist, sich auf die Couch fallen zu lassen. Kommissarin Leonie Wilke zelebriert es. Weich ist das Polster. Dankbar schmiegt sie ihren vom langen Dienst-Tag verkrampften Körper hinein. Eine zusätzliche Decke, um den Komfort zu erhöhen, ist jetzt wieder in Mode, schließlich ist der Sommer vorbei. Der Stoff hält die Wärme fest, das entspannt.
Ihr Sohn Laurenz ist derweil mit Freunden unterwegs und nicht zu Hause. So kann sie das Abendessen weglassen und sich ganz der Bequemlichkeit hingeben. Sie lugt hinüber zur Fernbedienung des Fernsehgeräts. Soll sie? Sie ist zu faul, nach ihr zu greifen. Und die Sprachsteuerung hat sie deaktiviert. Wer weiß, wie viele dieser Geräte mithören und wem sie es weitererzählen. Es reicht schon, wenn die mobile Elektronik, die die Kommissarin im täglichen Ermitteln begleitet, noch abends hier zu Hause herumliegen muss und im Standby vor sich hin träumt.
Sie hätte diesen Gedanken nicht fassen sollen, denn in diesem Moment schlägt ihr Tablet an. Das Display leuchtet auf, präsentiert ihr eine Nachricht, die von der Couch aus nicht lesbar ist. 10 Sekunden später schraubt ein zusätzlicher Benachrichtigungston die Penetranz des Eindringens in die abendliche Privatsphäre in neue Höhen. Weitere 10 Sekunden später gesellt sich ein Vibrationsalarm dazu. Die Entwöhnung von der Bequemlichkeit und das Zurückholen in den Dienst folgt einem straffen zeitlichen Rhythmus. Das penetrante Klingeln eines Weckers am Morgen ist dagegen wie eine warme Dusche.
Wilke ächzt, als sie sich widerwillig aus der Behaglichkeit der Decke herausschält. „Es gibt Arbeit“, steht auf dem Display. Die Einsatzleitung denkt an sie. Ein Mord harrt ihrer Aufmerksamkeit und Expertise. Sie quittiert die Nachricht. Als Antwort erscheint die Information, dass man ihr bereits einen dieser autonom anreisenden Polizeiwagen geschickt hat. Somit entfällt der Fahrer. Leute sind knapp, mehr denn je in den heutigen Zeiten. Gut, dass es da die Elektronik gibt. Oder auch schlecht, sonst wäre die Kommissarin womöglich inzwischen auf der Couch eingeschlafen, während sie mit sich gekämpft hat, ob sie das Fernsehgerät einschaltet oder nicht.
Es wäre eine willkommene Ruhe gewesen, denn in ein paar Tagen muss sie zu einer Konferenz nach London aufbrechen. Dort geht es um die Polizeiarbeit der modernen Gegenwart und der noch moderneren Zukunft.
Ihr Chef Heiner Althaus will sie unbedingt in die Metropole an der Themse schicken. „Du hast doch was geschafft, du kannst dich dort sehen lassen“, hat er sie ermutigt.
„Wir, das Team, haben etwas geschafft“, hat sie betont.
„Wie auch immer.“
„Muss ich wirklich?“, hat sie einen zaghaften Versuch unternommen, ihrer Reise-Unlust nachzugeben.
„Ist es dir lieber, wenn ich es wie die anderen Chefs mache?“, hat er gefragt. „Die fahren selber und schwingen dann große Reden. Und ihre Mitarbeiter, die mit der eigentlichen Ahnung, die bleiben zu Hause. Da kommt nur Gesäusel heraus. Und hinterher sind alle unzufrieden bis beleidigt.“
„Ist ja schon gut“, hat sie nachgegeben. Also fährt sie nach London, als Farbtupfer in ihrem Alltag.
Doch heute ist normaler, grauer Dienst und sie befindet sich inzwischen auf dem Weg zum Tatort.
Auf der Fahrt schweifen die Gedanken. Sie ist mittlerweile schon 3 Jahre mit der Leitung der Gruppe um das Thema „Neue Verbrechen“ betraut. Sie ist die Frau der ersten Stunde. Und sie geht gemeinsam mit ihrem Team ans Werk. Da ist der tendenziell bärbeißige Boldt, der dennoch nur schwer verbergen kann, dass er unter der rauen Schale die nette Seite seiner Persönlichkeit versteckt. Die junge Kollegin Nora Fist ist mit von der Partie. Und Merle Beirer darf ebenfalls nicht fehlen – als Beraterin und Computerexpertin.
Der Mord an Professor Bernau war ihr erster großer Fall. Der suchte seinesgleichen – ein Feuerwerk an Wendungen. Seitdem regiert der Alltag. Dazu hören die zahlreichen Delikte von Identitätsdiebstahl. Täter begehen im Namen anderer Verbrechen, bemächtigen sich der elektronischen Widerspiegelung dieser Personen, reiten deren Ansehen und Kontostände in den Dreck und bleiben bei alledem im Hintergrund. Wilkes Team zerrt sie ins Licht der Strafverfolgung.
Sie haben eine stattliche Aufklärungsquote, auch dank Beirers wachem Geist, der dafür sorgt, dass Verbrecher und deren polizeiliche Gegner die Klingen auf Augenhöhe kreuzen. Sie ist das, was man im Westernfilm einen Scout und Spurenleser nennt. Und sie teilt ihr Wissen. Boldt, Fist und Wilke holen auf. Es vermittelt der Kommissarin ein angenehmes Gefühl, über den Dingen zu stehen. Nicht immer, aber immer öfter.
Auch in anderen IT-bezogenen Delikten ermitteln sie, greifen der Abteilung für Cybersecurity unter die Arme, die nach wie vor überlastet ist. Eines der beherrschenden Themen ist der Datendiebstahl – und zwar der im größeren Stil.
Fliegt ein Einbruch in ein System in einem Kleinbetrieb unter dem Radar der Polizei bzw. verweist sie schulterzuckend auf die begrenzten Kapazitäten, so kann sie sich das bei den größeren Hausnummern von Raubzügen in der Industrie nicht leisten. Hier geht es um die Marktstellung, um die Sicherung des Innovationsvorsprungs, um Arbeitsplätze und um die Perspektive ganzer Wirtschaftsstandorte und sogar Regionen. Diese Themen hat auch die Politik im Blick, die sonst nur gelegentlich auf die Statistiken der Verbrechen und auf Aufklärungsquoten blickt. Doch wenn eine Firma wackelt, weil ihr jemand das technologische Wasser abgräbt, da schrillen die Alarmglocken.
Nicht selten haben dort fremde Mächte und an Geheimdienste angebundene Hackerkommandos ihre Hände im Spiel. Und die Möglichkeiten der Polizei reichen oft genau bis zur nächsten Landesgrenze, wenn man Glück hat auch zum Rand der Europäischen Union. Wilkes Alltag ist gespickt mit Frustration, die auf mangelnden Betätigungsmöglichkeiten fußt. Da ist so eine Konferenz wie in London vielleicht genau das Richtige, um darauf zu schauen, wie man sich in eine bessere Position bringt.
„Früher hat man wenigstens Geldscheine markiert; dann konnte man sie identifizieren, sobald sie ein Schurke in den Händen hielt“, hat Kollege Boldt einmal beim Brainstorming zu einem arg zähen Datendiebstahl genörgelt. „Kann man nicht auch Daten markieren?“
„Das ist aufwändig“, hat Beirer geantwortet. „Und es gibt dabei Gegenwind.“ Klar lässt sich die Industrie nicht gerne in ihre Daten schauen und diese mit Kennzeichen versehen. Aber nach ein paar Tagen Ruhe und Überlegung kam sie mit einem Konzept heraus, wie man „Marker“ unterschmuggeln kann. In einem der Betriebe, der mit Datenklau zu kämpfen hatte, hat Beirer dann solche Marker-Dateien untergestreut. Die tauchten tatsächlich später in einer Tauschbörse wieder auf. Dass man den Weg der Daten nachverfolgen konnte, bescherte dem Team einen veritablen Erfolg und Althaus und Wilke ein Pressefoto mit dem Innenminister. „Nicht ohne meine Leute“, hat die Kommissarin klargemacht. Und so wurde es eine Gruppenaufnahme. Nur Beirer hat geschwänzt. Als vormalige Aktivistin war ihr das zu viel der Nähe zum Establishment, auch wenn ihre umstürzlerischen Triebe von früher lange verblasst sind.
Das ist schon eine Entwicklung, die sie da hingelegt haben seit dem aufgeklärten Mord an Professor Bernau. An dessen Stelle ist inzwischen Karina Mühlenbach getreten. Zu der Frau Doktor, die jetzt Frau Professor ist, hält Wilke noch Kontakt. Sie bewundert sie dafür, dass sie das Rennen um den Posten gegen all die internationalen Bewerber und Alpha-Tierchen gemacht hat, und sie verfolgt lose deren Forschung an der „Datenmütze“, einer Kopfhaube aus einem Geflecht aus Stofffäden und elektrischen Drähten, mit der man Gedanken und Erinnerungen aus dem Gehirn sowohl auslesen, als auch neue einschreiben kann.
Hier und da ist Wilkes Team bei einer Demonstration in Mühlenbachs Institut dabei – man will ja auf der Höhe der Zeit bleiben.
Der Wagen hält an einer mittelmäßig belebten Straße, gleich neben einer Bushaltestelle. Die blitzenden Blaulichter der Einsatzwagen tauchen die Szene des Tatorts in ein flackerndes Licht. Da geht der Puls von alleine hoch, auch nach all den Jahren Dienst.
Wilke bahnt sich eine Gasse durch die üblichen Fotoreporter, vorbei an den jede Neuigkeit aufsaugenden Linsen und den Mikrofonen. Manche Passanten drängeln sich vor, so als wollten sie ein Selfie von sich und dem Opfer in der Entfernung machen. Andere sind eher passiv und ziehen ihr Basecap ins Gesicht. Ist vielleicht der Mörder selber mit dabei? Über dem Schauplatz kreist summend eine Flugdrohne der Polizei und macht fleißig Aufnahmen. In diesen Fällen ist Big Brother sofort zur Stelle. Es ist schon vorgekommen, dass man das eine oder andere polizeibekannte Gesicht entdeckt hat. Das wird dann automatisch gemeldet und man gleich an Ort und Stelle eine Befragung einleiten, was man am Tatort verloren hat.
Kurz nach Wilke pflügt Kollege Boldt durch die Passanten. Die Kommissarin hat ihn von unterwegs angerufen. Sicher ist er genauso erfreut über den verdorbenen Abend wie sie. Aber vier Augen sehen mehr als zwei.
Gemeinsam erreichen sie den Toten, der auf einem Radweg abseits der Straße in einer Blutlache liegt. Ein Messer in einer Spuren konservierenden polizeilichen Folienverpackung ist ebenfalls zu sehen.
Das Opfer trägt eine dunkle Jacke. Die Blutflecken darauf erkennt man erst beim zweiten Hinsehen. Es sind einige. Der Täter hat mehrmals zugestochen.
„Na, der ist ziemlich tot“, meint Boldt. „Da hat man nichts dem Zufall überlassen wollen.“
„Wissen wir, wer das ist?“, erkundigt sich Wilke.
„Thilo Heimann, Ausweis hat er dabeigehabt“, sagt Tanja Greve von der Forensik/Spurensicherung, wie sich ihre Abteilung nennt. Sie hat ihre Arbeit unterbrochen, damit die Kommissarin einen unverbauten Blick auf die Szene werfen kann. Sie kennen sich aus früheren Fällen.
„Was ist da drin?“, fragt Wilke und deutet auf die Tasche, die neben dem Opfer steht.
„Eine Rarität“, antwortet der Streifenpolizist, der mit am schnellsten am Tatort eingetroffen ist. Er musste die Tasche untersuchen, um Sprengstoff auszuschließen. Es wäre nicht die erste Polizistenfalle in dieser Stadt. „Sie ist sicher. Schauen Sie hinein!“
Wilke nickt Boldt zu. Der zieht sich Handschuhe über und greift in das Behältnis. „In der Tat: eine Rarität“, sagt er und hält staunend ein Bündel Geldscheine in das künstliche Licht der aufgebauten Scheinwerfer.
„Und das liegt hier so rum?“, führt Wilke mehr ein Selbstgespräch, als dass sie eine Frage stellt. „Hat das der oder haben es die Täter nicht mitgenommen?“
„Es gibt scheinbar nur einen“, antwortet der Streifenpolizist. „Und der ist noch da.“ Damit zeigt er zu einem Krankenwagen ein paar Meter weiter.
Wilke geht gemeinsam mit Boldt hinüber, der Kollege von der Streife begleitet sie. Ein Sanitäter hockt neben einem Mann, der an der Rückseite des Wagens auf der Türkante sitzt und ins Leere starrt. Nebenan steht ein Beamter in Uniform. Er hält seine Hände hinter dem Rücken. Sicher ist er zur Bewachung da und möchte keine furchteinflößende Präsenz ausstrahlen. Er tritt einen Schritt zurück, als er die Verstärkung kommen sieht. Täter brechen oft aus, wenn sie in die Enge getrieben werden.
Der Mann auf der Krankenwagenkante hebt seinen Blick, als die drei Polizisten näherkommen. Den in Uniform kennt er bereits. Der hat vorhin schon Fragen gestellt.
Der Mann zittert. Der Becher mit Tee, den der medizinische Dienst ausgeteilt hat, fällt ihm aus der Hand. Er macht keine Anstalten, ihn aufzuheben.
Dann hebt er die Handflächen in einer Geste, die wie eine Beschwichtigung oder gar Abwehr aussieht. „Ich war das nicht“, stammelt er.
„Und wer war es dann?“, stellt Boldt die Gegenfrage und macht eine ausholende Armbewegung, das Rund der Anwesenden vor und hinter der Absperrung einbeziehend.
„Wir haben eine Zeugin. Sie wurden gesehen“, zieht auch der Streifenbeamte die Schlinge fester um den Hals des mutmaßlichen Täters. Man hat als Polizist die Wahl und kann behutsam vorgehen, um den Mann nicht zu verschrecken, weil er sonst gar nichts sagt oder nach seinem Anwalt fragt und danach nicht mehr spricht. Doch wenn andererseits die Karten so klar auf dem Tisch liegen, vermag man mit Entschlossenheit durchaus eine Aufklärung zu beschleunigen. Als Lohn winkt mehr Freizeit anstelle von Überstunden an kühlen Herbstabenden.
Der Polizist gibt den Blick vom Krankenwagen hin zum Tatort frei.
Der mutmaßliche Täter schüttelt nur leicht mit dem Kopf. Sein Blick wandert wieder nach unten.
Wilke tritt an den Mann heran. Wenn die Kollegen schon den Bad Cop spielen, muss sie nicht auch noch einstimmen. Sie geht in die Hocke. Dadurch blickt sie nicht von oben auf den Delinquenten herab. „Wie ist das passiert?“, fragt sie in einem mütterlichen Ton. Sie gibt ihm eine Wahl, von den Umständen zu berichten. Das baut Druck ab.
Der Mann schaut wieder auf, sieht auf den Toten, die Lache, auf die Spurensicherung, die mittlerweile das Opfer wie ein Bienenschwarm umfliegt. „War ich das?“, fragt er und blickt auf Wilke, anschließend auf Boldt und zuletzt auf den Streifenpolizisten.
Danach wandert sein Blick zurück ins Leere. Seine Schultern hängen jetzt noch tiefer herab. Die Gestalt ist zu einem Häuflein Elend zusammengesunken. Einen Moment später geraten die Augen in Bewegung. Denkt er nach? Erinnert er sich? Begreift er überhaupt, was passiert ist?
Dann findet sein Blick zurück zu Wilke. Ganz leise haucht er: „Ich wollte das nicht.“
„Hatten Sie Streit?“, fragt die Kommissarin.
„Ich kenne den Mann doch gar nicht!“, ist sich der Verdächtige plötzlich in einer Sache sicher.
Wilke steht langsam auf. Sie haben jetzt ein halbes Schuldeingeständnis. Aber das ist vage. Wer weiß, was der Psychologentest ergibt und ob der Mann schuldfähig ist. Sie zieht ihre Begleiter ein Stück zur Seite, sodass der wieder in Gedanken versunkene mutmaßliche Messerstecher nicht mitbekommt, was sie reden.
„Angriff mit einem Messer, Täter ist verwirrt, so neu ist das alles nicht, als dass man eine Sonderabteilung bemühen muss“, sagt sie. „Wozu braucht ihr uns überhaupt?“
Da räuspert sich im Hintergrund der Bewachungspolizist, der geduldig neben dem Krankenwagen gewartet hat. Seine Hände, die er die ganze Zeit hinter den Körper gehalten hat, wandern vor seinen Körper. „Das haben wir beim Täter gefunden“, sagt er und hält einen Gegenstand in einer weiteren spurenerhaltenden Plastiktüte der Polizei nach oben.
Dann reicht er ihn Wilke. Sie greift zu und erkennt sofort, was sie da in der Hand hält. Sie und Boldt kennen das aus den gelegentlichen Besuchen im Mühlenbach-Institut: Es ist eine Datenmütze.
1000 Fragen
Warum müssen die Leute zu den unmöglichsten Gelegenheiten den Schlüssel in die Zukunft in den Händen halten? Zum Beispiel bei einem Angriff mit Mordabsicht?
Kann nicht einfach mal was Schönes passieren und Wilke wird gerufen und man sagt ihr: „Ach, Frau Kommissarin, hier hat etwas Zukunftsweisendes stattgefunden und stellen Sie sich vor, es gibt rein gar nichts aufzuklären! Sie sind nur hier, damit Sie sich daran erquicken können.“
Stattdessen hat dieser undurchsichtige und hochgradig Tatverdächtige von gestern zu allem Überfluss so eine Datenmütze am Start gehabt, als seine Tat vonstattenging. Die Einsatzkräfte haben sie sichergestellt. Jetzt liegt sie hier am nächsten Tag inmitten des Büfetts an Beweismitteln vom Tatort und Wilke kann mit der morgendlichen Kaffeetasse in der Hand ihren unsteten Blick darüber schweifen lassen.
Nora Fist hat all die Gegenstände schon in einer Tabelle zusammengefasst, damit das Ermittlerteam einen Überblick über alle Hinweise hat und die 1000 Fragen, was hinter dieser Tat steckt, möglichst schnell auf 100 oder gar 10 herunterbrechen kann.
Dass bei dem Angriff gestern Abend eine Tötungsabsicht bestanden hat, darüber herrscht wenig Zweifel. Wilke und Boldt haben mit der Zeugin gesprochen, einer Frau Caroline Windeck.
„Das ging alles so schnell!“, hat sie geschluchzt. Sie habe den Täter zunächst nicht bemerkt, er müsse sich angeschlichen haben, sagte sie.
„Aber das Opfer haben Sie gesehen, schon vor der Tat?“, hat Boldt gefragt.
„Aus Langeweile. Ich habe auf den Bus gewartet“, hat sie gemeint und sich die Tränen abgewischt. „Da kann man die Augen schweifen lassen. Und ja, den Fußgänger habe ich die ganze Zeit im Blick gehabt. Zufällig.“
„Und die Tat?“
„Der Mörder war plötzlich da und hat zugestochen.“
„Und dann?“
„Dann habe ich die Polizei gerufen.“
„Und der Angreifer?“
„Diese Drohne war auch gleich da. Er hat sie angestarrt.“
„Aha.“ Die Notrufzentrale schickt eine automatisierte Flugdrohne an den Ort des Geschehens, so genau das die Ortung des Mobiltelefons des Anrufers hergibt. Das Fluggerät ist mit Kameras und Mikrofonen ausgestattet und hilft der Einsatzleitung, sich ein schnelles Bild von der Lage zu machen. Während die Drohne im direkten Anflug ihrem Ziel zustrebt und selten zur Kollisionsvermeidung einen Bogen fliegen muss, ist die nächste Polizeistreife mit ihrem Wagen an das Zickzack der Straßenschluchten gebunden und braucht länger.
„Und die Drohne hat den Täter mit diesem krassen Licht geblendet“, hat die Zeugin weiter berichtet. „Und da ist er wie angewurzelt stehengeblieben.“
„Ja, Widerstand ist zwecklos, der modernen Technik sei dank“, hat Boldt resümiert.
Den Rest der Geschichte wissen Wilke und Boldt von den eintreffenden Streifenpolizisten. Die Zeugin entlassen die Ermittler mit dem üblichen Hinweis, sich verfügbar zu halten, falls weiterer Bedarf an Auskünften besteht.
Das ist aber auch schon das Ende der Fakten und der Beginn der Fragen. Der mutmaßliche Täter heißt Karsten Bergener und ist polizeilich gesehen ein genauso unbeschriebenes Blatt wie sein Opfer Thilo Heimann.
So langsam tröpfelt Wilkes Team am heutigen Morgen in den Besprechungsraum im Kommissariat ein. Ansgar Boldt gesellt sich zur Kommissarin und jetzt kommt auch Nora Fist dazu, die schon eine Weile im Büro ist, schließlich hat sie das Büfett der Spuren dokumentiert. Aus Zurückhaltung hat sie aber der Chefin am Morgen ihre Ruhe gelassen.
Zusammen stehen sie am Fuße des Berges der 1000 Fragen.
„Womit haben wir es eigentlich zu tun?“, lässt Fist ihren Gedanken freien Lauf. „Ein ritueller Mord?“ Sie verweist auf die Bilder des Toten aus der Gerichtsmedizin, die über Nacht eingetrudelt sind. Sie zeigen die zahlreichen Einstiche deutlich und lassen diese Interpretation zu.
„Nach einer unabsichtlichen Tat sieht es jedenfalls nicht aus“, wiederholt Boldt sein erstes Bild vom Vorabend.
„Dabei ist der Täter verwirrt“, komplettiert Wilke die Zusammenfassung der Lage. „Gestern wusste er nicht, ob er es nun gewesen ist oder nicht. Und später hat er immerhin Ansätze von Reue gezeigt.“
„Drogen?“, fragt Boldt. „Hat er damit seinen Verstand ausgeschaltet?“
„Haben wir schon ein Screening?“, erkundigt sich Wilke.
Fist schaut in ihre Liste der bekannten Wahrheiten und schüttelt mit dem Kopf.
„Dann wird es aber Zeit“, befiehlt Wilke. „Und den Alkoholpegel gleich mit. Man weiß ja nie.“
Fist schickt eine Nachricht an die Forensik.
„Auf das Geld war der Täter jedenfalls nicht sonderlich scharf“, meint Boldt. „Davon ist noch sehr viel da, vermutlich alles. Die Tasche ist randvoll.“
„Dreißigtausend Euro“, liest Fist aus ihrer Liste vor.
„Also kein Raubüberfall. Was war es dann? Etwa ein Mord aus Leidenschaft?“, fragt Wilke.
„Einen Nebenbuhler kaltstellen?“, murmelt Boldt und kratzt sich am Kinn. „Na wenn, dann hat er das zum ersten Mal gemacht. Er hat weiter zugestochen, obwohl das Opfer schon lange hinüber war. Er hat mehr getan, als nötig gewesen ist. Vielleicht ist Hass im Spiel?“
„Ja, aufgrund der Intensität der Ausführung ist das möglich“, seufzt Wilke. Sie verbindet mit Beziehungstaten eine besondere Tragik, so wie der Zerfall ihrer Beziehung zu ihrem Ex-Mann tragisch war und es weiterhin ist, auch wenn sie beide glücklicherweise noch unter den Lebenden weilen.
„Und das Geld ist liegengeblieben, das passt ebenfalls zu dieser Variante“, meint Fist. „Der Angreifer wollte sich nicht zusätzlich zur Tat bereichern.“
„Oder war es am Ende doch ein ganz normaler Streit, der aus dem Ruder gelaufen ist?“, fragt Wilke.
„Davon hat die Zeugin aber nichts gesagt. Wenn, dann klang das eher nach Heimtücke“, wendet Boldt ein.
„Bis wir das einordnen können, sollten wir jeden Grashalm umdrehen“, legt Wilke fest. Sie blickt auf Fist.
„Ist gut, ich kümmere mich darum. Wir werten den bunten Strauß an Daten aus, die es so gibt. Ich rede mit Beirer.“
Damit ist Wilkes Team wieder vollständig am Start – auch in diesem Fall.
Neue Horizonte
Leider kann Wilke am kommenden Tag nicht aus nächster Nähe verfolgen, wie ihr Team in die Gänge kommt. Zunächst muss sie zu dieser Konferenz fahren.
Ihr Chef hat ihr mit auf den Weg gegeben, dass sie sich neue Horizonte erschließen möge. Sie ist skeptisch, ob dieser fromme Wunsch erfüllt wird, schließlich ist sie nicht der kontaktfreudige Typ Polizist, der es nicht erwarten kann, neue Kollegen der gleichen Zunft kennenzulernen.
Wenigstens erlaubt ihr die Fahrt mit dem Zug quer durch Deutschland, Belgien und unter dem Ärmelkanal hindurch, die inzwischen eingetrudelten Ergebnisse durchzusehen. Das kann sie in Ruhe tun. Bei einer Flugreise wäre die Zeit knapper gewesen, wenn man mal von der lästigen Warterei am Flughafen und der Sicherheitskontrolle absieht. Doch innereuropäische Flüge entlang ordentlich ausgebauter Schienenwege finden heutzutage so gut wie nicht mehr statt – der Umwelt zuliebe. Dafür hat Wilke Verständnis.
Also vergräbt sie sich in Arbeit. Eine Nachricht von Fist liegt in ihrer Inbox: Bergeners Drogenscreening war negativ. Und Alkohol hatte der mutmaßliche Täter ebenfalls nicht im Blut. Der medizinische Bericht lässt da wenig Interpretationsspielraum. Alle Blutwerte sind innerhalb der Norm, was für einen Mann mittleren Alters nicht selbstverständlich ist. Also scheiden eine durch „Genussmittel“ bzw. Chemie induzierte Verwirrung aus. Bei Heimann ist die Lage ähnlich.
Ist der mutmaßliche Täter stattdessen „einfach so“ durcheinander? Die an der Untersuchung beteiligten Ärzte und Psychologen haben jedenfalls noch keinen Grund für die gestörte Erinnerung an die Motivation für die Tat gefunden. Sie stünden aber mit dem Hausarzt des Verdächtigen in Kontakt. Bei einem Verbrechen dieser Größenordnung erhalten sie gewiss Zugriff auf die Patientenakte.
Um der Frage nachzugehen, ob sich der Tatverdächtige Bergener und das Opfer Heimann gegenseitig gekannt haben, hat Fist allerlei Datenbanken umgegraben – von Meldeämtern und Verzeichnissen aller Art. Sie ist sich anschließend sicher, dass beide niemals Nachbarn waren und nie in derselben Band oder im gleichen Fußballverein gespielt haben. Über ihre eigene Recherche hinaus hat sie wie angekündigt Merle Beirer um Hilfe gebeten.
Leider liegt von der nichts in Wilkes Inbox. Dabei ist sie sehr gründlich. Wenn es etwas zu finden gibt, dann lockt sie es aus ihrem Versteck.