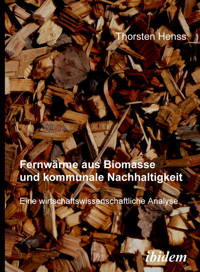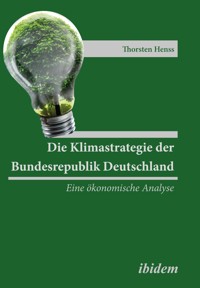
16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ibidem
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Der Kampf gegen den Klimawandel wird zweifelsohne eine der größten politischen, aber auch ökonomischen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts darstellen. Wir stehen erst am Anfang dieses Weges – der, das ist schon jetzt ersichtlich, lang und schwierig sein wird. Damit der Umbau der Weltwirtschaft hin zu einem dauerhaft tragfähigen Entwicklungspfad überhaupt gelingen kann, wird es von entscheidender Bedeutung sein, die Maßnahmen zum Klimaschutz so effizient wie möglich zu gestalten. Zu wenig Engagement im Klimaschutz ist dabei genauso gefährlich wie eine Überbeanspruchung der Opferbereitschaft in der Bevölkerung durch teure Maßnahmen mit fragwürdiger Wirkung. In Deutschland genießt der Umweltschutz im Allgemeinen und der Klimaschutz im Speziellen seit Jahrzehnten große Bedeutung in der politischen Diskussion. Spätestens seit dem Atomausstieg wird die deutsche Umweltpolitik auch international genau beobachtet. Thorsten Henss unterzieht die deutsche Klimastrategie einer eingehenden Analyse aus unterschiedlichen Blickwinkeln verschiedener ökonomischer Strömungen. Im Zentrum stehen dabei drei zentrale Eckpfeiler der deutschen Klimapolitik: die Energieeinsparverordnung (EnEV), das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) sowie die Umsetzung des Europäischen Emissionshandels. Die drei Gesetzeswerke sind besonders interessant, da sie das Problem Klimaschutz mit drei unterschiedlichen Methoden angehen: mit Hilfe von Auflagen, mit Hilfe von Subventionen und mit Hilfe von Marktbildung. Nach einem Abriss der Entwicklung der deutschen Klimapolitik unterzieht Henss die deutsche Klimastrategie einer wohlfahrtsökonomischen Effizienzanalyse. Dabei fällt auf, dass die deutsche Klimapolitik in vielen Bereichen nach wie vor einen planwirtschaftlichen Charakter hat und teils stark von industriepolitischen Erwägungen geprägt ist, was zuweilen in klarem Widerspruch zu einer (kosten-)effizienten Klimapolitik steht. In der Folge beleuchtet der Autor die Entwicklung der deutschen Klimapolitik mit den Mitteln der Neuen Politischen Ökonomie, um so insbesondere mögliche Ursachen für Schwächen und potenzielle Fehlentwicklungen in der Klimapolitik aufzuzeigen. Dabei geht er auch auf die Rolle von Bürokratie, technologischem Fortschritt und Wachstum ein – mit teils überraschenden Ergebnissen, beispielsweise zur Bedeutung solider Staatsfinanzen für einen effizienten Klimaschutz. Henss’ Buch ist für jeden interessant, der sich einen kompakten und doch fundierten Überblick über Stärken und Schwächen der wesentlichen Elemente in der deutschen Klimastrategie verschaffen möchte.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
ibidem-Verlag, Stuttgart
Vorwort
Klimawandel, Klimaschutz, Nachhaltigkeit, Low-Carbon-Economy – alles Schlagwörter aus dem politischen Diskurs der letzten Jahre. Speziell Deutschland sieht sich gern als Vorreiter im Klimaschutz. Spätestens seit sich die damalige schwarz-gelbe Bundesregierung im Frühjahr 2011 nach der Atomkatastrophe von Fukushima auch zum deutschen Atomausstieg bekannte, genießt die deutsche Klimapolitik internationale Aufmerksamkeit. Klimaschutz steht jedoch in einem Industrieland wie Deutschland traditionell auch in einem Spannungsverhältnis zu wirtschaftspolitischen Zielsetzungen.
Sind Klimaschutz und wirtschaftliche Prosperität miteinander vereinbar? Umweltökonomen haben diese Frage schon vor Jahrzehnten mit „Ja“ beantwortet. Allerdings ist dafür eine möglichst effiziente Ausgestaltung der Maßnahmen zum Klimaschutz Voraussetzung. Dies wirft wiederum die Frage auf, wie effizient die deutsche Klimapolitik arbeitet. Erscheinen wesentliche Elemente der deutschen Klimapolitik dauerhaft erfolgversprechend? Und falls bestimmte Maßnahmen sub-optimal wirken, ist dies nur Zufall, oder gibt es auch mögliche Gründe für systematische Fehlentwicklungen in der Klimapolitik? Diesen und anderen Fragen versuche ich im vorliegenden Werk in komprimierter Form nachzugehen und so einen Beitrag zu leisten, sich in der politischen und ökonomischen Debatte um den Klimaschutz besser zu Recht zu finden.
Thorsten Henss, März 2014
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
Es gibt wenige Themen, denen in den letzten zehn Jahren weltweit so viel Aufmerksamkeit zuteilwurde wie der Klimaproblematik. Viele Artikel und Bücher wurden publiziert. Autoren der unterschiedlichsten Fachrichtungen beschäftigten sich mit der Thematik. Auch die Ökonomik befasste sichdamit. Umweltfragen sind fürÖkonomen keineswegs etwas Neues. Die Umweltökonomik analysiert seit Jahrzehnten die ökonomischen Ursachen und Auswirkungen von Umweltverschmutzung, Naturzerstörung und Übernutzung natürlicher Ressourcen. Gleichzeitig gaben Ökonomen der Politik eine Reihe von Empfehlungen an die Hand, wie man den Schutz der Natur und die Sicherung unserer Lebensgrundlagen effizient umsetzen könnte. Lange Zeit schienen diese Empfehlungen allerdings auf wenig Gehör zu treffen. Die Umweltpolitik blieb ein Politikfeld, das sich vor allem als klassische Auflagenpolitik darstellte. Mit der zunehmenden Bedeutung des Klimawandels in der Umweltdebatte wandelte sich dies jedoch allmählich. Der Klimawandel und seine Ursachen sind offenbar ein zu komplexes Problem, um mit den klassischen Methoden allein gelöst zu werden. Diese neue Situation macht die Klimapolitik zu einem äußerst interessanten Untersuchungsobjekt für die Ökonomik.
Es ist jedoch nicht nur die klassische Umwelt- und Wohlfahrtsökonomik, die sich seit Jahrzehnten mit der Umweltpolitik befasst. Auch die sogenannteNeue Politische Ökonomiebeschäftigt sich seit langem mit der politischen Ausgestaltung des Umweltschutzes. Sie ist nicht normativ ausgerichtet wie die Wohlfahrtsökonomik. Sie ist deskriptiv und versucht die real zu beobachtenden Entwicklungen zu erklären.SpätestensBuchanan & Tullock(1975) gelang es in ihrem Artikel,„Polluters’ Profits and Political Response: Direct ControlsVersus Taxes“, zu zeigen, dass dieWirkungen politischer Maßnahmen nicht unbedingt immer so sind, wie man auf den ersten Blick meinen würde. Mit Hilfe der Methoden der politischen Ökonomik lässt sich in vielen Fällen erklären, warum bestimmte politische Maßnahmen manchmal aus unerwarteter Ecke Unterstützung bekommen. Sie kann helfen, das Zustandekommen der Realität ein Stück erklärbarer zu machen.
Die vorliegende Arbeit möchte beide Ansätze der ökonomischen Theorie miteinander verbinden.Anhand der Bundesrepublik Deutschland und ihrer Klimapolitik sollen exemplarisch verschiedene Instrumenteder Umweltpolitikeiner Analyse sowohl aus Sicht der Umwelt- und Wohlfahrtsökonomik, als auch aus Sicht der Neuen Politischen Ökonomie unterzogen werden.
In Kapitel 1 werden die ökologischen und politischen Rahmenbedingungen dargestellt, in denen sich diedeutsche Klimastrategie bewegt.Kapitel 2 erläutert zunächst den wohlfahrtsökonomischen Zugangzur Klimaproblematik. Im Zentrum stehen dabei Marktversagen in Folge externer Effekte und die Allmendeproblematik.Anschließend werdenStandardinstrumente der umweltökonomischen Theorie zur Lösung dieser Probleme kurz vorgestellt und diskutiert. Der Schwerpunkt von Kapitel 2 liegt aber inder Darstellung undder Effizienzanalyse von drei konkreten, gesetzgeberischen Maßnahmen, die zu den wesentlichen Elementen der deutschen Klimastrategie gehören:
·die Energieeinsparverordnung – EnEV,
·das Erneuerbare-Energien-Gesetz – EEG und
·der Emissionshandel.
Die Effizienzanalyse orientiert sich dabei an den Kriterien der wohlfahrtsökonomischenEffizienz (Pareto-Optimalität) –instatischer und dynamischer Perspektive–sowiean der Treffsicherheit der Instrumente in ihrer jeweiligen Form.Nach der normativen Analyse in Kapitel 2 erfolgt in Kapitel 3 eine deskriptive Analyse der deutschen Klimapolitik aus Sicht der NeuenPolitischen Ökonomie.Insbesondere soll versucht werden, mit einigen grundlegenden theoretischen Ansätzen bestimmte Eigenheitender deutschen Klimapolitik, diesich in den vorangegangenen Kapiteln ergeben haben, zu erklären.
Nur durch eine solche Analyse, die normative und deskriptive Ansätze miteinander verbindet,ist es möglich, Klimaschützern substanzielle Verbesserungsvorschläge an die Hand zu geben. Ohne die normativen Aussagen der Wohlfahrtsökonomik kann man keine Politikberatung zum Umweltschutz betreiben. Genauso falsch wäre es aber auch, die Realität mit ihren unterschiedlichen Einflussfaktoren auf den politischen Entscheidungsprozess außer Acht zu lassen. Normative Aussagen allein – losgelöst von der politischen Wirklichkeit – können leicht zur Wissenschaft im Elfenbeinturm werden. Berücksichtigt man beide Sichtweisen, so kann man Aussagen über den gegenwärtigen Effizienzgrad der deutschen Klimapolitik treffen, Ineffizienzen erklären und Verbesserungsvorschläge unterbreiten.
1.Die Klimastrategie der Bundesrepublik Deutschland
1.1GlobaleEnergieversorgungund politische Entwicklungen inDeutschland
Seit Beginn der Industrialisierung hat sich der Energiebedarf der Weltbevölkerung drastisch erhöht. Die Zunahme ist sowohl auf einen Anstieg der Weltbevölkerung zurückzuführen, als auch aufeinen Anstieg des Pro-Kopf-Energiebedarfs.Verbunden mit dem Wachstum der Energienachfrage war auch ein Wechsel im Mix der Energieträger, mit dem die Nachfrage gedeckt wurde.Vermutlich gegen Ende des 19. Jahrhunderts löste (fossile) Kohle die Biomasse als wichtigsten Energieträger der Menschheit ab.[1]Später wurdedann die Kohle ihrerseits von Rohölprodukten und fossilem Gas abgelöst.Und nicht zuletzt gewann die Atomenergie seit Mitte des 20. Jahrhunderts stark an Bedeutung.[2]Aktuell wird der weltweite Energiebedarf durch folgende Primärenergieträgermit folgenden Anteilen gedeckt:
Abbildung1: Anteile verschiedener Primärenergieträger am weltweiten Einsatz2009
Quelle: Eigendarstellung nachUmweltbundesamt Österreich2012 undIEA2011 S. 6
Mit dem Anstieg der Primärenergienachfrage und dem Wandel des Energieträgermixes waren einige erhebliche ökologische Nebenwirkungen verbunden. Viele dieser Probleme wurden zunächst vor allem als lokal-ökologische Probleme wahrgenommen, z.B. Ölteppiche oder Braunkohletagebauten. MindestensseitAnfang der 70iger Jahreweisen jedochAutorenauch in bekannten Journalen auf eine mögliche global-ökologische Dimensionen der Probleme, die mitdem Entwicklungspfad der Menschheit verbunden sind,hin[3].
Eine Publikation, die weltberühmtwurde,löste nicht nur unter Wissenschaftlern,sondern auf praktisch allen gesellschaftlichen Ebenen heftige Debatten aus:die Studiezur Lage der Menschheit, die amMassachussetts Institute of Technology (MIT) im Auftrag des Clubof Rome erstelltwurdeund 1972unter dem Titel „Die Grenzen des Wachstums“erschien.Im Zentrum standen hierbei die fünfFaktoren Industrialisierung, Unterernährung, Ausbeutung der Rohstoffreserven und Zerstörung von Lebensraum, die in sog. „rückgekoppelten Regelkreisen“ miteinander in Beziehung gesetzt wurden.[4]Im Endergebnis prophezeite die Studie, nach einer Phasedes Wirtschaftswachstums unddes Bevölkerungsanstieges, ein dramatisches Schrumpfen der Weltbevölkerungin Folge von Versorgungsproblemen. EinigeAnnahmen, die derStudie zugrunde lagen, wurden in der Folgezeit zwar durchaus kritisiert[5],derregen öffentlichen Diskussion überFragen von Umwelt und zukünftiger Entwicklung tat dies jedoch keinen Abbruch. Und nicht zuletzt begann auch die Politik sich allmählich intensiver mit Umweltfragen zu beschäftigen.Unter anderem rückten in den Folgejahren Fragen der Ressourcenproduktivität ins Zentrum.[6]
Mit Sicherheit sehr stark gefördert wurde dieser politische Trend durch die erste große Ölkrise von 1973, die insbesondere den westlichen Industrieländern ihre dramatische Abhängigkeit von importierten fossilen Energieträgern vor Augen führte.In vielen Ländern sah sich die Politik gezwungen zu reagieren. InFolge erließauchdie bundesdeutsche Politik, vor allem in Reaktion auf die Ölkrise,eine Reihe von Maßnahmen, von denen einige im Rückblickeher aktionistisch wirken – zu nennenwärenbspw. die Sonntagsfahrverbote, die sich auch nicht lange hielten.Andere Maßnahmen hielten sichhingegenwesentlich längerbeziehungsweise halten sichbisheute. Anzuführenwäre bspw. die 1977 erlasseneWärmeschutzverordnung(WärmeschutzV), die verbindliche Vorgaben für den baulichen Wärmeschutz für eine Vielzahl von Gebäudenmachte.Sie wurde2002 von derEnergieeinsparverordnung(EnEV), die u.a.ähnliche Vorgaben in verschärfter Form macht,abgelöst.[7]
Innerhalb der politischen Diskussionen um dieEnergieversorgung rückte im Laufe der Jahrzehnte vor allem ein Punkt mehr undmehr in den Fokus: der Klimawandel in Folge der anthropogenen Emission von Treibhausgasen.In vielen Ländern, so auch in der Bundesrepublik Deutschland, reagierte die Politik mit (Gesetzes-)Initiativen, die zunehmend genau auf diesen Problemaspekt zugeschnittensind.[8]Die hohe mediale Präsenz, die dieses Thema nach wie vor hat,zeigtjedoch ganz klar, dass das Problem der Treibhausgasemissionen (THG-Emissionen) und der zu erwartenden Klimaerwärmung nach wie vor keineswegs gelöst ist.Im Gegenteil, das internationale Ringen um ein Nachfolgeabkommen für das 2012 auslaufende Kyoto-Protokoll zumKlimaschutz zeigt, wie brennend aktuelldas Thema nach wie vor ist. Im Folgenden soll nun versucht werden,darzustellen, welcheZiele die bundesdeutsche Politik im Zusammenhang mit dem Klimaschutz aktuell verfolgt und mit welchen Mitteln sie versucht, diese zu erreichen.
1.2Deutsche Klimaschutzziele im internationalen Kontext
1.2.1Ziele bis 2012
Die Ziele der deutschen Bunderegierung in der Klimapolitik sind eingebettetin internationale Verpflichtungen, die Deutschland im Rahmen der Vereinten Nationen bzw. der Europäischen Union eingegangen ist. Das bis heute wichtigste internationale Abkommen zum Klimaschutz ist dasKyoto-Protokoll, das auf der drittenVertragsstaatenkonferenz der Klimarahmenkonvention im Jahre 1997 in Kyoto verabschiedet wurde.[9]Damit es in Kraft treten konnte, musste es zuvor noch von einer bestimmten Anzahl der Vertragsstaaten ratifiziert werden.Und zwar mussten
·mindestens 55 Staaten das Abkommen ratifizieren, und
·diese Staaten mussten mindestens 55% der CO2-Emissionen der Industrieländer im Jahr 1990 repräsentieren.[10]
Die USA haben das Abkommen bis heute nicht ratifiziert. Da die USA alleine 35% der CO2-Emissionen der Industrieländer im Jahr1990 repräsentierten, führte dies lange Zeit dazu, dass die zweite Bedingung nicht erfüllt wurde und das Abkommen nicht in Kraft treten konnte. Erst als sich Russland nach ebenfalls langem Zögern 2004 doch dazu entschließen konnte, dasAbkommen umzusetzen, konnte es am 16. Februar 2005 in Kraft treten.[11]
DasKyoto-Protokolldefiniert neben Kohlendioxid (CO2), dem mengenmäßig bedeutendstenTreibhausgas,noch weitere Treibhausgase. Dies sindMethan (CH4), Lachgas (N2O) undeinige flourierte Verbindungenwie bspw. perflourierte Kohlenwasserstoffe (FKW) oderSchwefelhexaflourid (SF6), die auch als sog. F-Gase bezeichnet werden.[12]Um eine einheitliche Bewertungsgröße zu haben,werden die übrigen Treibhausgase gewichtet mit ihrer Treibhauswirkung in CO2-Äquivalente umgerechnet.
Im Kyoto-Protokoll verpflichten sich diealsIndustrienationendefinierten Länder von 1990dazu, ihre Treibhausgasemissionen(THG-Emissionen)bis 2012 um mindestens 5% unter das Niveau von 1990 zu senken.[13]Zu beachten ist, dass sich die 5% nur auf die Emissionen der Industrienationen beziehen. Entwicklungsländern wurde hingegen meist eine Ausweitung ihrer THG-Emissionen zugebilligt.Die EU, die damals noch aus 15 Mitgliedern bestand, verpflichtete sich, ihre Emissionen im Durchschnitt der Mitgliedsstaaten um 8% gegenüber dem Basisjahr zu senken. Innerhalb der EU-15 wurden diese 8%im Rahmen eines „Lastenausgleichs“[14]anhand bestimmter Kriterien auf die einzelnen Mitgliedsstaaten aufgeteilt(manchen Staaten wurde sogar noch eine weitere Erhöhung zugebilligt, bspw. Portugal mit +27%). Deutschland übernahm dabeidieVerpflichtung,seine THG-Emissionen um 21% gegenüber 1990 zu senken.[15]Bei der Beurteilung dieser sehr hoch wirkenden Zahl ist zu beachten, dass die Emissionssituation von 1990 in Deutschland noch stark von der DDR-Wirtschaft geprägt war,die sich teilweise durch stark veraltete und ineffiziente Anlagen zurEnergienutzung auszeichnete. Dadurch ergaben sich gerade in der ersten Hälfte der 1990er Jahre viele vergleichsweise „einfache“ Möglichkeiten,Treibhausgasemissionen einzusparen.Und tatsächlich ist es Deutschland auch gelungen,eine sogarnoch höhere prozentuale Einsparung zu realisieren, wie im kommenden Abschnitt gezeigt wird.
1.2.2Entwicklung seit 1990
In den 20 Jahren von 1990 bis 2010konnten dieTHG-Emissionen in Deutschland um über24%gegenüber dem Wert von 1990 gesenkt werden.Lagen sie 1990 noch bei 1.246Mio. t CO2-Äquivalenten, betrugen sie 2010 nur noch ca. 937Mio. t.[16]Folgende Grafiken veranschaulichen diese Entwicklung:
Abbildung2: Deutsche THG-Emissionen in Mio. t CO2 und CO2-Äquivalente1990 bis 2010
Quelle: Eigendarstellung nachUmweltbundesamt Deutschland 2012: Emissionen von direkten und indirekten Treibhausgasen und von SO2
Abbildung3: Relative Veränderung der THG-Emissionen in Deutschland gegenüber 1990
Quelle: Eigendarstellung nachUmweltbundesamt Deutschland 2012: Emissionen von direkten und indirekten Treibhausgasen und von SO2
Auch die EU konnte ihr Ziel von 8% übererfüllen.Im Jahr 2009 lagen die THG-Emissionen der EU-15 Mitglieder im Durchschnitt 12,7% unter jenen des Jahres 1990.[17]Dies trifft allerdings nur auf den Durchschnitt der 15 Staaten, die zum Zeitpunkt der Unterzeichnung des Kyoto-Protokolls EU-Mitglieder waren, zu. Manche Einzelstaaten, wie Österreich oder Italien,konnten ihre Ziele nicht erreichen.[18]Die „neuen“ EU-Mitglieder, dieerstab 2004 der Europäischen Union beigetreten sind,haben eigene nationale Kyoto-Ziele definiert.[19]Bei den meistenZielenhandelt es sich dabei um eine Senkung von 8% unter das Niveau von 1990, bei manchen um eine Senkung von 6%.Bis auf Slowenien konnten alle dieser Staaten in den letzten Jahren eine positive Entwicklung verzeichnen.[20]In Summe sanken die THG-Emissionen in der EU-27 zwischen 1990 und 2010 um 15,5%.[21]Eine Sonderrolle kommt Zypern und Malta zu: da sie nicht zu den Industrienationen von 1990 gehören (sog. Annex I-Staaten im Kyoto-Protokoll),kommt ihnen keine Minderungsverpflichtung zu.[22]
Weltweit sank der Treibhausgasausstoß jener Industrienationen, die sich im Kyoto-Protokoll verpflichtet haben,bis 2008um immerhin 6,1%.[23]Zubeachten ist, dass es sich hier nur um THG-Emissionen jenerIndustrienationenvon1990, die Verpflichtungen eingegangen sind, handelt.Da aber der Anteil, den die Industriestaaten am weltweiten CO2-Ausstoß haben, nur noch ca. 40% beträgt[24], konnte die positive Entwicklung in einer ganzen Reihe von Industrienationen den Boom in den Schwellenländern nicht kompensieren.In Summe aller Staaten stiegen und steigen die THG-Emissionen nach wie vor weiterdeutlichan.Im Jahr 2010wurde der Rekordwert von 30,6 Gigatonnen CO2emittiert[25],dies entsprach einer Zunahme von über 38% gegenüber 1990.[26]Hauptverantwortlich für diesen starken Anstieg sind vor allem die rasant wachsenden Emissionen der boomenden Schwellenländer. Allen voran gilt dies für China, das die USA als größten Emittenten mittlerweile abgelöst hat und 2009 rund dreimal soviel Kohlendioxid ausstieß wie 1990.Auch in Indien und dem mittleren Osten sind die Emissionen seit 1990 stark gestiegen, im Vergleich zum chinesischen Anstieg sind diese Zuwächse aber noch gering.[27]
Nicht zuletzt aufgrund dieserfür den Klimaschutz noch sehr unbefriedigenden Gesamtentwicklung,und weil das Kyoto-Protokoll 2012 ausläuft,wird seit Jahren über ein Nachfolgeabkommen zuKyoto verhandelt, das auch die Schwellenländer, allen voran China,stärker mit in die Verantwortung ziehen soll. Wie man aber der Presse entnehmen konnte, blieben diese Verhandlungen bisher noch ohne Ergebnis.[28]
1.2.3Zieleder EUnach 2012
Auch für die Zeit nach 2012 sind die klimapolitischen Zielsetzungen der deutschen Bundesregierung vom internationalen Kontext geprägt. Da, wie bereits erwähnt, ein Nachfolgeabkommen für das Kyoto-Protokoll noch aussteht, hat sich die Europäische Union, die jetzt als EU-27 auftritt, bislang unilateral selbst dazu verpflichtet,bis 2020 ihre Treibhausgas-Emissionen 20% unter das Niveau von 1990 zu senken.[29]Dies entspricht einer Senkung von 14% gegenüber dem Niveau von 2005.[30]Darüber hinaus hat sich die EU-27 bereit erklärt,ihre THG-Emissionen um 30% unter das Niveau von 1990 zu senken, wenn ein internationales Abkommen zustande kommen sollte, indem sich die anderen Industrieländer zu ähnlichen Zielen verpflichten, und wenndie großen Emittenten unter den Schwellenländern ebenfalls „angemessene Beiträge“ leisten.[31]Da es ein derartiges Abkommen aber bislang noch nicht gibt, gilt weiterhin das 20%-Ziel(bzw. eben 14% gegenüber 2005). Um dies zu erreichen,sollen die Emissionen im EU-Emissionshandelssektor um 21%gegenüber 2005sinken. Da der Emissionshandelssektor mit Beginn der Handelsperiode 2013 EU-weit einheitlich behandelt wird[32], erfolgt hier keine Aufteilung aufdie einzelnen Mitgliedsstaaten. Im Jahr 2020 werden EU-weit um 21% weniger Emissionszertifikate zur Verfügung stehenals 2005.[33]Welche Betriebe aus welchen Mitgliedsländern diese nutzen werden, wird der Markt entscheiden.Die 21%-ige Senkung der Emissionen gegenüber 2005 reicht alleine aber noch nicht aus,um das Einsparungsziel von 14% gegenüber2005 zu erreichen. Ergänzend dazu müssen außerhalb des Emissionshandelssektors (z.B. bei den privaten Haushalten oder im Dienstleistungsbereich) noch 10%amEmissionen im Vergleich zu 2005 eingespart werden.[34]Diese Verpflichtung wird wieder, ähnlich wie die Kyoto-Verpflichtungen in der Vergangenheit, auf die einzelnen Mitgliedsstaaten nach bestimmten Kriterien aufgeteilt. Deutschland hat sich dazu verpflichtet, seine THG-Emissionen außerhalb des Emissionshandelssektors um weitere 14% im Vergleich zu 2005 zu senken.
1.2.4Deutsche Ziele nach 2012
Wie im vorherigen Kapitel dargestellt, müssen,aufgrund von Verpflichtung auf EU-Ebene, die deutschen Treibhausgasemissionen außerhalb der Sektoren, die am Zertifikatehandel teilnehmen, um mindestens 14% sinken.In ihrem aktuellen Energiekonzept, vom Herbst 2010, verlautbart die deutscheBundesregierung(2010)aber noch ehrgeizigere Ziele, wenngleich es sich dabei natürlich nicht um rechtsverbindliche Ziele, sondern um Absichtserklärungen handelt. Folgt man dem Energiekonzept, so sollen die deutschen THG-Emissionen 2020 in Summe (also inkl. des Emissionshandelssektors) um 40% unter jenen von 1990 liegen.[35]Danach sollen die Emissionen weiter sinken, wie folgendeTabelledarstellt:
Tabelle1: geplanter Entwicklungspfad der deutschen TreibhausgasemissionenlautEnergiekonzept
Jährliche Einsparung gegenüber 1990
Jahr
40%
2020
55%
2030
70%
2040
80% (bis mögl. 95%)
2050
Quelle: Eigendarstellung nachBundesregierung 2010: EnergiekonzeptS. 4
Um diese Reduktionsziele zu erreichen,definiert das Energiekonzept der Bundesregierung eine Reihe von Sub-Zielen, die bspw. den geplanten Anteil der erneuerbaren Energien am gesamten Endenergieverbrauch oder am Stromverbrauch betreffen. So sollen die Anteile der erneuerbaren Energieträger deutlich ausgebaut werden:
Tabelle2: geplanter Entwicklungspfad der Anteile EE laut Energiekonzept
Anteile EE an:
Bruttoendenergieverbrauch
Bruttostromverbrauch
2020
18%
35%
2030
30%
50%
2040
45%
65%
2050
60%
80%
Quelle: Eigendarstellung nachBundesregierung 2010: Energiekonzept S. 4f.
Parallel dazu soll durch Steigerung von Energieeffizienz der Energiebedarf insgesamt gesenkt werden. So soll dergesamtePrimärenergieverbrauchin Deutschlandbis 2020 um 20% gegenüber 2008 sinken und um 50% bis 2050.Der Stromverbrauch soll bis 2020 um 10% und bis 2050 um 25% sinken.[36]Der Endenergieverbrauch im Verkehrssektor sollte, so wird angestrebt, bis 2020 um 10% und bis 2050 um 40% sinken, wobei hier das Jahr 2005 als Basis herangezogen wird. Die (energetische) Sanierungsrate von Gebäuden möchte die Bundesregierung auf jährlich 2% des Gebäudebestandes verdoppeln.[37]
Das Energiekonzept der Bundesregierung basiert auf den Berechnungen eines externen Gutachtens, welches für das Energiekonzept in Auftrag gegeben wurde.[38]In diesem Gutachten wurden unter Zugrundelegung bestimmter Annahmen verschiedene Szenarien durchgespielt, die unter anderem Auskunft über mögliche Entwicklungspfade der Treibhausgasemissionen,aufgegliedert nach einzelnen Sektoren[39],geben sollen. Insgesamt werden neunSzenarien dargestellt. Darunter ist ein sogenanntes Referenzszenario, das von der Annahme ausgeht, dass „die bisher angelegten Politiken in die Zukunft fortgeschrieben werden.“[40]Die übrigen achtSzenarien sind Zielszenarien, dievon zusätzlichen Anstrengungen im Klimaschutz ausgehen und die Frage beantworten sollen: „Welche technischen Maßnahmen, die Energieverbrauch und Treibhausgasemissionen verringern, sind geeignet, um die [Anm.:von den Auftraggebernvorgegebenen[41]] Ziele zu erreichen?“[42]In den Werten, die in diesen Szenarien für die zukünftigen THG-Emissionen, Energieverbräuche und andere Größen angegeben werden, sieht die Bundesregierung keine exakten Prognosen.Sie interpretiert die Szenarien aber als „Wegbeschreibung“ oder „Kompass“ bei der Erreichung bestimmter Ziele.[43]Aus diesem Grunde kann man durchaus davon ausgehen, dass die ZielszenarienalsRichtschnur dafür dienen, welche Entwicklung der Emissionsmengen die Bundesregierung je nach Sektorenfür die Zukunft anstrebt.
Aufgrund der unterschiedlichen Annahmen, die hinter den jeweiligen Szenarien stehen, unterscheiden sich auch die in den acht Zielszenarien für bestimmte Zeiträume prognostizierten Wertefür die THG-Emissionen der einzelnen Sektoren.[44]Diese Unterschiede sind jedoch meist relativ gering,und vor allem die Endwerte für das Jahr 2050 unterscheiden sichinden einzelnen Szenarienkaum.Bildet man aus den geschätzten Emissionsmengen der acht Zielszenarien das arithmetische Mittel,so würde sich folgender Entwicklungspfad für die verbrennungsbedingten Treibhausgasemissionen in Deutschland ableiten:
Abbildung4: Mögliche Entwicklung der verbrennungsbedingten THG-EmissioneninDeutschlandnach den Energieszenarien für das Energiekonzept der Bundesregierung
Quelle: Eigenberechnung und Eigendarstellung nach Schlesinger et al. 2010 S. A13 u. A14
Die obige Tabelle bezieht sich nur auf die verbrennungsbedingten THG-Emissionen. Um die Gesamtemissionen zu erhalten,müsste man noch sog. diffuse Emissionen hinzuzählen.Diese sind aber im Vergleich zuden verbrennungsbedingten Emissionen von derart geringem Umfang, dasssie in keinem der Szenarien mehr als 2% der Gesamtemissionen ausmachen.[45]Daher wurden sie bei der Erstellung der obigen Grafik beiseitegelassen.
Wie bereitsausgeführtverstehen sich die Szenarien nicht als exakte Prognose, sie vermittelnaber durchaus einen Eindruck davon, welche Emissionsentwicklung die Bundesregierung aktuell anstrebt. Wie man sieht, müsste die Energiewirtschaft in absoluten Werten die größte Treibhausgasreduktion erreichen. Sie wäre demnach auch 2050 noch immer der größte Emissionssektor, jedoch nur noch knapp vor der Industrie.Setzt man die Einsparungen der einzelnen Sektoren in Relation zu ihren Emissionsmengen im Jahr2008, so ergibt sich folgendes Bild:
Abbildung5: Relative THG-Einsparung der Sektorenim Vergleich zu 2008
Quelle: Eigenberechnung und Eigendarstellung nach Schlesinger et al. 2010 S. A13 u. A14
Es fallen vor allem zwei Dinge besonders auf: zum einen, dassim Endstadium fast alle Sektoren zwischen 80% und 90% ihrer Treibhausgasemissionen von 2008 einsparenwürden, mit lediglich einer Ausnahme, der Industrie.Im kurzfristigeren Zeithorizont bis 2020 müsste, den Energieszenarien folgend, die Industrie noch eine durchschnittliche Einsparungsleistung erbringen, bräuchte danach aber im Vergleich zu den anderen Sektoren ihre Emissionen nur noch unterdurchschnittlichzureduzieren.Über die Gründe, warum die Industrie scheinbar weniger stark in die Verantwortung gezogen wird, kann vielfältig spekuliert werden.Eine mögliche Erklärung wäre, dass dieIndustrie bereits vor 2008 eineüberdurchschnittliche Einsparungsleistung erbracht hat(vgl. dazu Abbildung8 weiter unten).Genauso könnte man aber auch über geschickte Einflussnahme bestimmter Interessenverbände spekulieren. Diese Frage abschließend zu klären, würde, wenn es überhaupt möglich ist, den Rahmen dieser Arbeit sprengen. Daher werden die Emissionsentwick