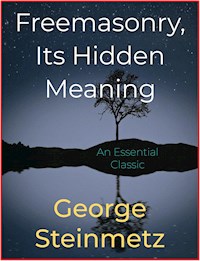40,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Hamburger Edition HIS
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die Welt, in der wir leben, ist geprägt von den Spuren moderner kolonialer Imperien. Welchen Einfluss hat diese Prägung auf die Sozialwissenschaften und auf die postmoderne Soziologie? Für die neu entstehende Disziplin war die Kolonialforschung einst von entscheidender Bedeutung. Ab den 1930er Jahren waren Soziologen und Soziologinnen gefragt, ihr Fachwissen auf soziale Themen wie »Detribalisierung«, Urbanisierung, Armut und Arbeitsmigration anzuwenden. Diese koloniale Orientierung durchdrang alle wichtigen Teilbereiche der Forschung. Gerade in Zeiten der Dekolonisierung war die koloniale Soziologie Avantgarde ihres Fachs, vor allem in imperialen Ländern wie Großbritannien und den Niederlanden, besonders aber in Frankreich. Dort forschten mehr als die Hälfte der Soziologen und Soziologinnen zu kolonialen Themen, sowohl in den Kolonien als auch in den Metropolen; unter ihnen waren nicht nur Apologeten, sondern auch scharfe Kritiker des Imperialismus. Zahlreiche Institutionen entstanden, Universitäten, Forschungsinstitute, Regierungsorganisationen und Museen, die sich der Forschung über Imperien widmeten. Diese fundierte Studie präsentiert überraschende Einsichten und zeigt eindrücklich, dass das ambivalente Erbe der Kolonialsoziologie enormen Einfluss auf das sozialwissenschaftliche Denken der Gegenwart hat.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1077
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
GEORGE STEINMETZ
Die kolonialen Ursprünge moderner Sozialtheorie
Französische Soziologie und das Überseeimperium
Aus dem Englischen von Daniel Fastner
Hamburger Edition
Für Julia. Und in Erinnerung an meinen Vater
Hamburger Edition HIS Verlagsges. mbH
Verlag des Hamburger Instituts für Sozialforschung
Mittelweg 36
20148 Hamburg
www.hamburger-edition.de
© der E-Book-Ausgabe 2024 by Hamburger Edition
ISBN 978-3-86854-426-8
© der deutschen Ausgabe 2024 by Hamburger Edition
ISBN 978-3-86854-392-6
© der Originalausgabe by Princeton University Press, 2023
Titel der Originalausgabe: »The Colonial Origins of Modern Social Thought: French Sociology and the Overseas Empire«
Umschlaggestaltung: Lisa Neuhalfen, Berlin
Inhalt
Abkürzungsverzeichnis der wichtigsten Institutionen
TEIL I
Die Soziologie der Kolonien und Reiche im Kontext der Wissenschaftsgeschichte
1 Über das Verfassen einer Historischen Soziologie der Kolonialsoziologie unter postkolonialen Bedingungen
2 Konstruktion des Gegenstands, Konfrontation mit disziplinärer Amnesie
TEIL II
Die politischen Rahmenbedingungen kolonialsoziologischen Denkens im Nachkriegsfrankreich
3 Koloniale Eroberung, Verwissenschaftlichung und Populärkultur
4 Developmentalismus, Wohlfahrt und Soziologie in den Kolonien
5 Kolonialismus, höhere Bildung und Sozialforschung
TEIL III
Der geistige Bezugsrahmen der französischen Nachkriegssoziologie
6 Die ersten kolonialen Sozialwissenschaften und ihr Verhältnis zur Soziologie – Geografie, Rechtswissenschaft, Ökonomie und die Wissenschaften von der Psyche
7 Andere sozialwissenschaftliche Nachbardisziplinen und ihre Verbindungen zur Soziologie und zum Kolonialismus – Geschichte, Statistik/Demografie und Anthropologie
8 Theorieentwicklungen in der Soziologie der Zwischenkriegszeit als Kontext für die Nachkriegs-Kolonialsoziologie
TEIL IV
Die Soziologie der französischen Kolonialsoziologie, 1918–1960er Jahre
9 Die Soziologie der Soziologie und ihres kolonialen Unterfeldes (Frankreich und Belgien, 1918–1965)
10 Entwurf einer Theorie der kolonialsoziologischen Praxis
TEIL V
Vier Soziologen
11 Raymond Aron als kritischer Theoretiker von Reichen und Kolonialismus
12 Jacques Berque – Ein historischer Soziologe des Kolonialismus und »die dekoloniale Situation«
13 Georges Balandier – Eine dynamische Soziologie des Kolonialismus und Antikolonialismus
14 Pierre Bourdieu – Die Verfertigung von Sozialtheorie im Kessel des Kolonialkriegs
15 Fazit – Die Geschichte von Soziologie, Reflexivität und Dekolonisation
Anhänge
Anhang 1 Soziolog:innen, deren Karriere in Frankreich oder im französischen Kolonialreich vor 1965 begann und die zwischen den späten 1930er Jahren und den 1960er Jahren in der Kolonialforschung aktiv waren
Anhang 2 Soziologisches Feld in Großfrankreich 1946
Anhang 3 Soziologisches Feld in Großfrankreich 1949
Anhang 4 Soziologisches Feld in Großfrankreich 1955
Anhang 5 Soziologisches Feld in Großfrankreich 1960
Anhang 6 Belgische Kolonialsoziolog:innen
Archive und Sammlungen
Literaturverzeichnis
Danksagung
Zum Autor
Abb.
0.1
Karte Afrikas von 1957 mit französischen Kolonien
TEIL I
Die Soziologie der Kolonien und Reiche im Kontext der Wissenschaftsgeschichte
1 Über das Verfassen einer Historischen Soziologie der Kolonialsoziologie unter postkolonialen Bedingungen
»Europa ist buchstäblich das Werk der Dritten Welt.«
Frantz Fanon1
Der Halbschatten des Kolonialismus
Die Schatten vergangener Reiche liegen über den Landen der einstigen Eroberer und Opfer. Genauer gesagt hindert ein imperialer Halbschatten den direkten Blick auf die Lichtquelle, die die imperiale Vergangenheit ist. Das Römische Reich, eines der tiefsten Quellen imperialer Energie, ist omnipräsent und abwesend zugleich. Mit Begriffen wie Kolonie, Imperium, Kaiser, Diktator und Prätorianismus beschreiben wir heute noch das imperiale Gepräge unserer politischen Wirklichkeit. Von Augustus über Hitler bis in die Gegenwart wurden westliche Herrscher heimgesucht von Menetekeln des Niedergangs und Untergangs und vom Auftauchen einstiger »Barbaren« im Herzen der Metropole.2
Die Welt, in der wir leben, ist auch von den Kolonialreichen der Moderne gezeichnet. Von 1492 bis Mitte des 20. Jahrhunderts waren Bevölkerungen in Afrika, Amerika, Ozeanien und Asien einem von Reichs-Staaten beherrschten globalen System unterworfen. Die meisten heute bestehenden Staaten in Afrika, Ozeanien, Amerika und im Nahen Osten sind als Kolonien entstanden oder aus dem Zerfall ehemaliger Kolonien oder der Sowjetunion hervorgegangen.3 Die Außen- und Binnengrenzen von Staaten, die internen Linien zwischen rivalisierenden Ethnien, die ungleiche Ressourcenverteilung im Inneren, die Verwaltungsstrukturen und institutionellen Regierungspraktiken – mit anderen Worten die gesamte Staatskultur postkolonialer Gemeinwesen – lassen sich nur vor dem Hintergrund des Kolonialismus verstehen.4 Ein ungeheurer Ozean der Traumatisierung – Einzelner und ganzer Gruppen – von Botswana bis nach Algerien, von Kambodscha bis zum Pine Ridge-Reservat in den USA verweist auf koloniale Gewalt.5
Auch europäische Staaten tragen das Reichsmal. Laut Eric Williams und Immanuel Wallerstein war der Aufstieg des kapitalistischen Weltsystems von der Eroberung Amerikas angestoßen, von der Plünderung seiner Reichtümer und der sklavenbasierten Plantagenwirtschaft, die dort entstand.6 Für W.E.B. Du Bois bildete die Sklaverei der Kolonialzeit ein wesentliches Element im Aufstieg des Industriekapitalismus, europäische Städte wie Liverpool waren »praktisch auf den Leibern schwarzer Sklaven errichtet«.7 Aus der Sicht kritischer Theoretiker:innen der Geopolitik lässt sich das gesamte System internationaler Beziehungen, vom Europäischen Konzert der Großmächte bis zum Völkerbund und der US-Hegemonie der Nachkriegsordnung nur vor dem Hintergrund des Imperialen verstehen.8
Imperien haben ein riesiges Reservoir an Wissen, Begriffen und Bildern hervorgebracht.9 Die europäischen Sprachen tragen (um Victor Klemperer zu paraphrasieren) die Male der Lingua Imperii.10 Die ganze Kategorie race illustriert die scheinbar unüberwindbare Gegenwart des Imperialismus.11 Viele der rassistischen Strukturen und Ideologien, die heutigen rassistischen Praktiken zugrunde liegen, wurden in kolonialen Zusammenhängen entwickelt.12 Obwohl die letzte Kolonialausstellung 1950 in Bordeaux stattfand,13 reproduzieren ethnologische Museen und Museen nichtwestlicher Kunst heute weiterhin den Geist, in dem die Objekte damals zur Schau gestellt wurden. So wie »die aus der afrikanischen Vergangenheit vermachten Ressourcen« an Kunst und Kultur in Museen und Ländern »so fern von der afrikanischen Jugend verwahrt werden, dass diese oft nichts von deren Reichtum und Potenzial […] weiß«, wurde der europäischen Jugend über Generationen selbst noch nach der Dekolonisation weisgemacht, dass diese Sammlungen afrikanischer Kultur Teil ihres eigenen Erbes seien.14 Museen beginnen erst heute damit, ihre Narrative zu revidieren und aus den Kolonien entnommene Objekte zurückzugeben. Das frühere Kolonialmuseum in Brüssel und das »Tropenmuseum« in Amsterdam haben versucht, ihre Sammlungen zu dekolonisieren.15 Doch während sich langsam auch das neue Humboldt-Forum in Berlin in diese Richtung bewegt, nimmt dieses Museum insgesamt die Form eines asynchronen Projekts an, das aus der Ära des europäischen Hochimperialismus in die Gegenwart verpflanzt wurde.16
Die Kolonialvergangenheit prägt weiterhin die Politik in den europäischen Gesellschaften ebenso wie jene der ehemaligen Kolonien. Einerseits sind die europäischen Nationen mit der Rückkehr des Kolonial-Verdrängten in der Form von Einwanderung und wiedererweckten Formen neokolonialen Rassismus gegen Migrant:innen konfrontiert. Andererseits ist es unterschiedlichen sozialen Bewegungen gelungen, das imperiale Unbewusste und koloniale Ideologeme in den Raum öffentlicher Auseinandersetzung und Infragestellung zu bringen.17 Debatten über die »Dekolonisierung« der Lehrpläne und der Öffentlichkeit werden in Südafrika so intensiv geführt wie in Großbritannien und den Vereinigten Staaten.18
Der Kolonialismus hat sich auch in die institutionalisierten Sozialwissenschaften und in breitere Felder gesellschaftstheoretischen Denkens eingeschlichen. Historiker:innen der kolonialen Wissensproduktion haben Ökonomie, Ethnologie, Orientalistik, Psychologie, Geopolitik, Jura, Architektur, Vergleichende Religionswissenschaft, Geschichte, Politische Theorie und die Naturwissenschaften untersucht.19 Das vorliegende Buch befasst sich mit den wichtigsten Disziplinen der französischen Sozialwissenschaft und ihrer Verstrickung in den Kolonialismus, im Fokus steht dabei die Soziologie.
Es mag nicht unbedingt auf der Hand liegen, sich für eine Untersuchung über die imperiale Verflechtung des gesellschaftstheoretischen Denkens auf Soziologie zu kaprizieren.20 Die US-amerikanische Soziologie konzentriert sich heute recht unnachgiebig auf die unmittelbare Gegenwart in der amerikanischen Heimat. Der Einmarsch im Irak etwa hat US-Soziolog:innen kaum einen Laut entlockt. Dieses Schweigen hat mehrere Gründe: Zunächst einmal wird »Außen«-Politik als tabu empfunden in einer Disziplin, die sich unerbittlich auf die kontinentalen Gebiete der Vereinigen Staaten fokussiert und sich nur um ihre nationalen Angelegenheiten kümmert.21 Auch die Rückstoßeffekte von Imperien oder »kolonialen Bumerangs«, die doch eigentlich als »inländische« Phänomene angesehen werden müssten und erstmals vom britischen Protosoziologen John Hobson diskutiert wurden, werden von der Soziologie nicht angerührt.22 Man sollte annehmen, dass Native Americans »amerikanisch« genug wären, um dem Ukas der US-Soziologie gegen die Erforschung ausländischer Kulturen zu entgehen. Tatsächlich existierte zwischen den 1930er und den 1960er Jahren eine nicht-exotisierende Soziologie der amerikanischen Indigenen.23 Doch diese werden in der absurden Aufteilung von Themenbereichen oder ontologischen Sphären, wie sie an amerikanischen Hochschulen vorherrscht, üblicherweise von der Ethnologie beansprucht. Mit Ausnahme einer Handvoll indigener Soziolog:innen ignoriert die US-Soziologie die intern kolonisierten indigenen Anderen.24
Die Vermeidung des Imperialen lässt sich also nicht in Gänze auf den provinziellen Fokus der Soziologie auf das »eigene Land« zurückführen. Sie entspringt einer komplexeren Gemengelage aus Annahmen, Vorgaben und Stichworten. Die amerikanische Soziologie geht globalen imperialen Phänomenen aus dem Weg, weil sie von einer positivistischen Epistemologie durchdrungen ist, die singuläre Ereignisse als außerhalb des Gegenstandsbereichs wissenschaftlicher Forschung ansieht.25 Ihre Vertreter:innen machen sich eher einen »spontanen« Glauben an axiomatische Neutralität zu eigen, selbst wenn dies der ebenso weit verbreiteten Zustimmung zu den liberalen Werten des politischen Mainstreams und den Forderungen nach »öffentlichen« Formen von Soziologie widerspricht. Die Begriffe »Imperium« und »Kolonialismus« scheinen politisch zu sehr aufgeladen, zu abschreckend für die wertfreien Soziolog:innen.
Diesen Hemmnissen zum Trotz hat die Soziologie wiederholt den Weg imperialer und kolonialer Fragestellungen gekreuzt. Raewyn Connell hat uns mit einer grundlegenden Abhandlung darauf aufmerksam gemacht, wie sehr die europäische und amerikanische Soziologie von den kolonialen Bedingungen des Hochimperialismus (1880er Jahre bis 1918) durchdrungen war.26 Das betrifft viele Protosoziologen und Begründer der Disziplin, unter anderem Auguste Comte, Karl Marx, John Stuart Mill, Aléxis Tocqueville, Herbert Spencer, Ludwig Gumplowicz, Émile Durkheim und Max Weber. Nach Connells Darstellung wandten sich viele Soziolog:innen nach dem Ersten Weltkrieg nach innen und zogen sich auf das nationale Terrain zurück. Bei näherer Betrachtung zeigt sich allerdings, dass eine solche Einkehr vor allem in den Vereinigten Staaten stattfand, und das zudem mit der Einschränkung, dass amerikanische Soziolog:innen im Kalten Krieg durchaus mit Modernisierungstheorie befasst waren.27 Darüber hinaus bewegten sich auch afroamerikanische Soziolog:innen außerhalb der Orthodoxie ihres Fachs und beschäftigten sich auch in der Zwischen- und der Nachkriegszeit weiterhin mit Kolonialismus.28 An vorderster Front war W.E.B. Du Bois, der den Kolonialismus ausgiebig analysierte und mit der Unterdrückung der Afroamerikaner:innen in den USA in Verbindung setzte.29 Andere afroamerikanische Soziolog:innen (St. Clair Drake, E. Franklin Frazier) lehrten in der britischen Kolonie Goldküste und im postkolonialen Ghana. Und schließlich, selbst wenn Talcott Parsons, wie Connell argumentiert, vorübergehend eine »kanonische« Stellung in der amerikanischen Soziologie einnahm, bewegten sich große Teile der europäischen Soziologie auf gänzlich anderen Wegen, vertieften sich in die Kolonialforschung und ignorierten weitgehend die amerikanischen Entwicklungen in ihrem Fach. Diese Ära der soziologischen Kolonialforschung um die Jahrhundertmitte ist von Soziologiehistoriker:innen fast vollständig übersehen und in einigen Fällen sogar aktiv verdrängt worden, wie ich im nächsten Kapitel zeigen werde.
Man könnte eine Beschäftigung der europäischen Soziologie mit kolonialen Fragen und Problemen als Selbstverständlichkeit ansehen. Schließlich war der Imperialismus im europäischen Alltag selbst nach 1945 noch allgegenwärtig (Kapitel 3). Schulkinder wurden über »ihre« Reiche belehrt; Bilder von Kolonien erschienen in Zeitschriften und Filmen; »primitive Kunst« wurde in Galerien verkauft und in Museen ausgestellt. Pariser Geschäfte vertrieben Ausrüstung für Kolonialreisende. Nationale Fluggesellschaften boten Direktflüge in die Hauptstädte der Kolonien an. Über die gesamte Nachkriegszeit kündeten die Titelblätter französischer und britischer Zeitungen von Kolonialkriegen.
Zukünftige Soziolog:innen konnten sich all dem schwerlich entziehen, sollte man annehmen. Kolonien boten Beschäftigung und für manche auch die Verlockung des Abenteuers. Fortschritte in der Medizin verschafften Schutz vor den meisten Tropenkrankheiten und erlaubten Kolonialbeamt:innen und -forscher:innen, ihre Familien auf ihre Posten in Übersee mitzunehmen. In den Kolonien gab es für Soziolog:innen so viele Beschäftigungsmöglichkeiten und Forschungsgelder wie in den Metropolen. Wie wir im dreizehnten Kapitel sehen werden, war der Afrikanist und Soziologe Georges Balandier als Kind von den exotischen Kolonialabenteuern und -geschichten seiner Verwandten fasziniert. Als sich ihm 1946 die Gelegenheit für eine Kolonialkarriere bot, ergriff er die Chance. Andere hatten weniger freie Wahlmöglichkeiten und gerieten durch den Zwang der Umstände in die imperiale Sozialwissenschaft. Raymond Aron wurde durch die NS-Besatzung ins Exil getrieben und fühlte sich dadurch veranlasst, den NS-Imperialismus verstehen zu wollen. Nach seiner Rückkehr nach Frankreich griff er auf einige seiner Theorien über den NS-Imperialismus zurück, um das französische, amerikanische und sowjetische Imperium zu verstehen (Kapitel 11). Jacques Berque wurde von seinem Vater, einem Kolonialbeamten in Algerien, für die Kolonialforschung rekrutiert, was ihn schließlich zur Arabistik und Soziologie des Kolonialismus führte (Kapitel 12). Pierre Bourdieu wurde gegen seinen Willen eingezogen und nach Algerien geschickt, wo er zur Soziologie konvertierte und die Grundzüge seines Theoriesystems entwickelte, an dem er im Laufe der nächsten vier Jahrzehnte weiterarbeitete (Kapitel 14). Albert Memmi, Abdelmalek Sayad, Anouar Abdel-Malak, Paul Sebag und andere Soziolog:innen wurden als französische Kolonialsubjekte geboren und dazu getrieben, sich diese kolonialen Bedingungen begreiflich zu machen (Kapitel 10). Anders gesagt, es wäre vielmehr erklärungsbedürftig gewesen, wenn sich die französische Soziologie nicht mit Kolonien und Dekolonisation auseinandergesetzt hätte. Doch all das wirkt erst heute so offensichtlich – im Lichte der Forschung, die zu diesem Buch geführt hat. Das Rätsel, von dem das nächste Kapitel handelt, ist vielmehr, wie den meisten Historiker:innen, die sich mit der französischen Soziologie der Jahrhundertmitte befasst haben, das »koloniale Faktum« hat entgehen können.
Wieso der Fokus auf Frankreich um die Jahrhundertmitte?
Leser:innen könnten sich fragen, wieso sich dieses Buch auf das Frankreich der Jahrhundertmitte konzentriert statt auf die Zeit des »Hochimperialismus« im späten 19. Jahrhundert oder die 1920er Jahre, als die europäischen Reiche ihre größte Ausdehnung erreichten. Diese Entscheidung entspringt meinem Interesse an Soziologie und den Gesellschaftswissenschaften im Allgemeinen. In früheren Perioden spielten die Naturwissenschaften eine größere Rolle für den Kolonialismus. Vor 1914 bediente sich die Kolonialherrschaft hauptsächlich der Medizin, der Ingenieurswissenschaft und dergleichen. In den 1920er Jahren wurde die Ethnologie zur kolonialen Gesellschaftswissenschaft par excellence. Die Soziologie hingegen blieb zwischen den Weltkriegen in allen Kolonialstaaten eine kleine und ungefestigte Disziplin. Nur in Deutschland und den Vereinigten Staaten existierte in dieser Zeit ein größeres zusammenhängendes Fachgebiet. Die meisten US-Soziolog:innen hatten sich jedoch in ihr nationales Häuschen zurückgezogen. Deutschland hatte im Ersten Weltkrieg sein Kolonialreich verloren, und die nationalsozialistische Machtübernahme 1933 trieb die meisten deutschen Soziolog:innen ins Exil. Zwischen 1933 und 1942 ließ der NS die Kolonialrevanchist:innen von der Rückeroberung des afrikanischen Reichs träumen. Einige wenige Soziolog:innen wie der Berliner Universitätsprofessor Richard Thurnwald ließen das daniederliegende Teilfeld der Kolonialsoziologie wieder auferstehen. Einige deutsche Soziologen lieferten Beiträge zum interdisziplinären imperialen Gebiet der Ostforschung oder unterstützten die NS-Kolonisierung des besetzten Polen mit angewandter Forschung. Wie die amerikanische Modernisierungstheorie unterschied sich diese nationalsozialistische Reichssoziologie grundlegend von der westeuropäischen Kolonialsoziologie. Nach 1945 verschwanden Kolonialismus und Reiche fast vollständig aus der deutschen Soziologie, auch wenn einige ehemals nazifizierte Soziologen für soziologische Entwicklungsforschung (Karl-Heinz Pfeffer, Gunther Ipsen) oder »internationale« Soziologie (Wilhelm Mühlmann) eintraten.30
Mich interessiert die Art von Kolonialsoziologie, die von professionellen Sozialwissenschaftler:innen betrieben wurde, sich selbst von der Anthropologie abgrenzte und eine kritische Masse an aktiven Mitgliedern umfasste. Diese Konstellation begann sich Ende der 1930er Jahre herauszubilden und nahm feste Formen in den späten 1940er und den 1950er Jahren an. Die französische Soziologie fand Anwendung in einer ganzen Bandbreite an Kolonien, die zu unterschiedlichen Zeitpunkten ihre Unabhängigkeit erlangten: Tunesien und Marokko 1956, Guinea 1958 und die meisten verbliebenen französischen Kolonien 1960. Algerien, einer der entscheidenden Schauplätze der Kolonialsoziologie, wurde 1962 unabhängig. Statt mit einem festen Datum zu enden, folgt das Buch den Kolonien daher bis zu ihrer jeweiligen Auflösung und führt die Untersuchung noch bis einige Jahre nach der Dekolonisation fort, um die undurchsichtige Übergangszeit zwischen der formalen Unabhängigkeit und der Dekolonisation der Wissenschaft zu verstehen.
Verschiedene andere Faktoren spielten bei der Festsetzung des Zeitrahmens dieses Buches eine Rolle. Erstens waren die Kolonien in geografisch und politisch definierte Föderationen und Regionen eingebettet. Einige Länder wie Tunesien und Marokko, die ihre Unabhängigkeit relativ früh erlangten, liegen in Nachbarschaft zu Ländern, die weiterhin unter Kolonialherrschaft standen. Zweitens lebte der Kolonialismus in den Köpfen, Herzen und Publikationen von Soziolog:innen fort, die in den Kolonien gearbeitet hatten oder die Forschung zu ihrem Promotionsvorhaben in Übersee vor der Unabhängigkeit begonnen hatten. Mehrere Afrikanisten-Soziolog:innen, die mit ihrer Forschung in den letzten Jahren der Kolonialzeit oder in den ersten Jahren nach der Unabhängigkeit begannen, sahen die Situation ähnlich wie der französische Soziologe Roland Waast, der spezifisch mit Blick auf Wissenschaft und Bildung von »einer akuten Periode zwischen Dekolonisation und Unabhängigkeit« sprach, die »manchmal fast kolonial« war.31 Drittens blieben die Universitäten und Forschungsinstitute in den Überseegebieten, wo die Kolonialsoziologie Fuß gefasst hatte, meist noch Jahre nach der Unabhängigkeit in europäischer Hand.32 Der Soziologiebereich der Universität Dakar, in dem ab 1962/63 weiterführende Studienabschlüsse möglich waren, wurde vom französischen Soziologen Louis Vincent Thomas geleitet.33 Tunesien erlangte 1956 die Unabhängigkeit, ab 1959 konnten sich tunesische Student:innen für die licence in Soziologie einschreiben. Der Gründer des dortigen Soziologieinstituts war der Franzose Georges Granai, und einer der Soziologie-Dozent:innen 1959 und 1960 Frantz Fanon.34 Die meisten französischen Dozent:innen der Universität Algier kehrten ihr 1962 den Rücken, doch der Rektorposten war von 1962 bis 1965 mit dem antikolonialen französischen Historiker André Mandouze besetzt, und mehrere in Frankreich geborene Sozialwissenschaftler:innen setzten ihre Lehrtätigkeit fort. Bourdieu verließ die Universität Algier 1960 und wurde durch die Ethno-Soziologin Jeanne Favret-Saada ersetzt. Drei französische Soziolog:innen lehrten noch nach Erlangung der Unabhängigkeit dort: Andrée Michel (geb. Vielle), eine feministische antikoloniale Soziologin, zu deren ersten Veröffentlichungen eine Studie über algerische Arbeitsmigrant:innen in Frankreich gehört und die aktiv den algerischen Unabhängigkeitskampf unterstützte; Claudine Chaulet, auf die ich an späterer Stelle genauer eingehe; und Émile Sicard, ein Spezialist für Soziologie slawischer Kulturen, der in den 1960er Jahren auf afrikanische Soziologie und Entwicklungsstudien umsattelte.35
Kurz, die professionelle Kolonialsoziologie erreichte zwischen Ende der 1930er Jahre und Mitte der 1960er Jahre ihren Höhepunkt. Entsprechend habe ich hier mit mehreren verschiedenen politischen Regimen zu tun: der späten Dritten Republik, dem Vichy-Regime, dem Frankreich unter NS-Besatzung und den im Zweiten Weltkrieg vom Freien Frankreich kontrollierten Gebieten, der Vierten Republik (1944–1958), der frühen Fünften Republik sowie den verschiedenen halbautonomen »Regimen« in diversen Kolonien und kolonialen Föderationen.
Ein weiterer Grund dafür, sich auf die Periode von den späten 1930er Jahren bis zum Ende der Dekolonisation zu konzentrieren, ist, dass die Arbeiten aus dieser Zeit eine größere Relevanz für gegenwärtige Fragen und Debatten haben. Ein guter Teil aktueller Veröffentlichungen über die »Dekolonisation« der Soziologie befasst sich mit Personen, die für die heutige Sozialforschung gänzlich irrelevant sind, so etwa Lester Ward, W. I. Thomas, Franklin H. Giddings, William Graham Sumner, Albert Keller oder Leopold von Wiese. Dagegen sind im französischen Fall einige der führenden Soziolog:innen des Kolonialismus weiterhin höchst relevant für die gegenwärtige Forschung. Ganz offensichtlich ist das bei Bourdieu, dem nach wie vor meistzitierten Soziologen der Welt. Balandier verdanken wir den theoretischen Rahmen zur Analyse kolonisierter Gesellschaften als Kolonien. Zudem hat er die historische Soziologie Afrikas einschließlich der präkolonialen Staaten, der Religionen des 20. Jahrhunderts und der Städte der Kolonialzeit entwickelt. Jacques Berque war der erste Theoretiker der Dekolonisation der Sozialwissenschaften. Arons scharfsinnige Vergleiche zwischen nationalsozialistischem, französischem, amerikanischem und sowjetischem Imperialismus ermöglichen uns, den anhaltenden Niedergang des amerikanischen Imperiums zu verstehen.
Es ließe sich fragen, ob man mit einer Analyse der Kolonialsoziologie im Rahmen eines Nationalstaats und seines Reichs nicht riskiert, analog zum »methodologischen Nationalismus« in eine Art methodologischen »empireism« zu verfallen.36 Als eine Form von Politik betrachtet, dreht sich Kolonialismus hauptsächlich um einen bestimmten Nationalstaat.37 Natürlich haben gelegentlich auch mehrere Kernmächte gemeinsam Kontrolle über einzelne Kolonien oder imperiale Herrschaftszonen ausgeübt.38 Typischerweise war die koloniale Form jedoch national in dem Sinne, dass über jede Kolonie von einer spezifischen Metropole aus regiert wurde. Die Kolonien, die das Überseereich einer Kolonialmacht bildeten, waren über die zwischen ihnen zirkulierenden Beamten, Militärs, Fachleute, Fachberater, Gesetze und politischen Maßnahmen miteinander verbunden. Die Grenzen zwischen verschiedenen Reichen hingegen waren in Verträgen und Karten klar festgelegt und vor Ort in Form von Schildern, Grenzsteinen und bewaffneten Wachen erkennbar.
Die Ebene des Nationalstaats mag als analytische Bezugsgröße jedoch weniger angemessen erscheinen, wenn es um die kulturellen Aspekte des Imperiums geht. Schließlich stammten die vorkolonialen Erzählungen über Reisen, Erforschung und Eroberung oft von Bürgern anderer Nationen als der späteren Kolonialstaaten.39 Diese Berichte wurden schnell in die großen europäischen Sprachen übersetzt, besonders während der Frühen Neuzeit. Die Haitianische Revolution (1791–1804) fand Widerhall in ganz Europa und wurde auch in den Zeitungen diskutiert, die Hegel in Jena las.40 Missionsarbeiter ignorierten oft die von europäischen Kolonialmächten festgesetzten Grenzen. Afrikanische »Stämme« wurden zwischen verschiedenen Kolonien aufgeteilt.41
Die Soziologie hingegen gehört zu den am stärksten mit nationalen Besonderheiten behafteten akademischen Disziplinen. Dabei haben Historiker:innen selbst bei Naturwissenschaften nationale Traditionen und Eigenheiten aufgezeigt, die nicht der Beschreibung der Wissenschaft als internationalem Unterfangen entsprechen.42 Die Soziologie entstand in einer extrem nationalistisch geprägten Zeit und war anfangs mit Projekten nationaler Selbststilisierung verbunden.43 Sie fristete in erster Linie eine universitäre Existenz, und jedes europäische Land wartete mit seinem eigenen höheren Bildungssystem auf. Jedes Land besaß auch seine eigene Geistestradition, die der Soziologie ihren Stempel aufdrückte. Die nationalen Varianten der Soziologie unterschieden sich in Gesamtumfang der Disziplin, Zeitpunkt ihrer Entstehung, Ausweitung und Schrumpfung, ihrer Beziehung zu Staat, Industrie und sozialen Bewegungen sowie darin, aus welchen Disziplinen ihre Begründer:innen stammten. Die deutsche Soziologie wurde von Wirtschaftshistoriker:innen und Geschichtswissenschaftler:innen entwickelt, die französische von Philosoph:innen, während die amerikanische anfangs hauptsächlich an ökonomischen Instituten angesiedelt war. Doch der intellektuelle Austausch beschränkte sich nie nur auf die eigenen Landsleute. Soziolog:innen verschiedener europäischer Reiche trafen regelmäßig auf Konferenzen und in internationalen Organisationen zusammen und publizierten auch gemeinsam. Institutionen wie die Organisation der United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) förderten Kolonialwissenschaft; amerikanische Stiftungen und Universitäten waren stark in die Sozialwissenschaften der europäischen Kolonien und ihrer Mutterländer involviert (Kapitel 5). Man könnte erwarten, dass die mit der Amerikanisierung einhergehenden Homogenisierungsprozesse die nationalen Unterschiede eingeebnet hätte. Doch eine geradlinige Angleichung an das amerikanische Modell hat es nicht gegeben, nicht einmal in Ländern wie dem Westdeutschland der Nachkriegszeit, geschweige denn in Frankreich. Natürlich versuchten amerikanische Stiftungen, »die Standardisierung in Begrifflichkeiten und Techniken zu unterstützen und dadurch nationale Unterschiede im sozialwissenschaftlichen Betrieb aufzuheben«.44 Stiftungsprojekte waren, in den Worten eines Berichts der Rockefeller Foundation, ausdrücklich darauf ausgerichtet, »Brückenköpfe« zur Schaffung sozialwissenschaftlicher Disziplinen zu errichten, »wie wir sie in den USA kennen«.45 Dennoch entwickelte sich die europäische Sozialwissenschaft relativ unabhängig von diesem Druck aus den USA.
Die französische Soziologie mag das drastischste Beispiel für die kolonialistische Prägung einer sozialwissenschaftlichen Disziplin sein. Wie ich im Folgenden zeigen möchte, arbeitete etwa die Hälfte der französischen Soziolog:innen in der Nachkriegszeit in Kolonien oder an kolonialen Themen. In der britischen Soziologie ergibt sich ein ähnliches Bild: Nach 1945 betrieb dort circa die Hälfte der Soziolog:innen Kolonialforschung.46 In dieser Hinsicht ähnelten der französischen Soziologie auch die des niederländischen und die des portugiesischen Kolonialreichs. Besonders bemerkenswert sind die dort zur Erforschung sozialer Prozesse in den Kolonien entwickelten Methoden, denen der Ansatz Balandiers zugrunde lag, sich auf die Rückbildung älterer Formen von Solidarität und ihre Neubildung entlang der Linien zu konzentrieren, die in »Reaktion auf die von europäischen Nationen durchgesetzten Verwaltungsstrukturen« entstanden waren, das heißt in Reaktion auf die »koloniale Situation«.
Die niederländischen Soziolog:innen büßten mit der Unabhängigkeit Indonesiens 1949 weitgehend ihre Grundlage für koloniale Feldforschung ein, doch um den plötzlich arbeitslos gewordenen Forscher:innen Beschäftigung zu bieten, wurde ein neues Unterfeld mit der Bezeichnung »nichtwestliche« Soziologie geschaffen. Wie ihre französischen und britischen Kolleg:innen grenzten die »nichtwestlichen« Soziolog:innen in den Niederlanden ihren Ansatz von der Anthropologie ab, die sich nach ihrem Verständnis auf die vermeintlich »homogenen sozialen Beziehungen von Stammeskulturen« konzentrierte und die »Probleme der Modernisierung, der Soziologie der kolonialen Situation und anderer makrosoziologischer Konzepte« ignorierte.47
Auch in Portugal stand die Soziologie mit Kolonialismus in Verbindung, wenngleich sie als Disziplin deutlich weniger entwickelt war. Das Centro de Estudos Políticos e Sociais der Junta das Missões Geográficas e de Investigações Coloniais (Rat für geografische Missionen und Kolonialforschung) verzeichnete ab 1956 Hunderte von Forschungsprojekten, in deren Forschungsteams Sozialwissenschaftler:innen unter anderem aus der Soziologie eine zentrale Rolle spielten. Die ersten Soziologie- und Anthropologielehrstühle in Portugal entstanden Mitte der 1950er Jahre an der Kolonialhochschule in Lissabon (Escola Superior Colonial), wo 1972 auch die ersten sozialwissenschaftlichen akademischen Grade des Landes verliehen wurden. Das Centro de Estudos da Guiné Portuguesa folgte ausdrücklich Balandiers Ansatz.48
In den verbliebenen spanischen Kolonien Äquatorialguinea und Spanisch-Sahara fand nur wenig soziologische Forschung statt. Carmelo Viñas Mey, ein spanischer Soziologe der »dritten Generation« und Spezialist für Kolonialgeschichte, versuchte erfolglos, seine Kolleg:innen für empirische Studien in den Übersee-Kolonien zu interessieren.49
Italien verlor alle seine Kolonien im Zweiten Weltkrieg, erlangte aber von 1950 bis 1960 quasikoloniale Kontrolle in Form einer Treuhandschaft über Somalia zurück. In diesem Jahrzehnt lehrte Corrado Gini weiterhin Kolonialsoziologie und nahm in seinen Corso di Sociologia von 1957 eine hundertseitige Auseinandersetzung mit »Elementen der Kolonialsoziologie« auf. Die neuere soziologische Literatur zum Kolonialismus nahm er darin jedoch nicht zur Kenntnis.50
Ich konzentriere mich in diesem Buch auf die Soziologie in Großfrankreich oder Frankreich plus das »äußere Frankreich«, wie es manchmal genannt wurde.51 Dabei handelte es sich um ein Fachgebiet, das in Universitäten, Forschungsorganisationen und Instituten, auf Konferenzen und in Zeitschriften sowohl in Kolonien als auch in der Metropole präsent war. Soziolog:innen aus Frankreich und seinen Kolonien bewegten sich durch ein imperiales soziologisches Feld vom Zentrum Paris aus zu Außenposten in französischen Städten wie Lille, Aix-en-Provence und Bordeaux, in Kolonialstädte wie Algiers, Tunis, Rabat, Dakar und Brazzaville bis hin zu Stätten überall im Reich, von Gabun bis Tahiti, wo Feldforschung betrieben wurde. Diese Orte gehörten zu einem zunehmend integrierten Zusammenhang von erstens wissenschaftlichen Feldern, die von französischen Institutionen definiert waren, zweitens dem Gebrauch der französischen Sprache und drittens dem Bezug auf einen gemeinsamen Kern an Texten, Begriffen und Debatten. Soziolog:innen, die im Kernland oder als Siedler:innen mit französischer Staatsbürgerschaft geboren waren, konnten sich zwischen Frankreich und Belgien und den Wissenschaftsstätten im Reich relativ ungehindert bewegen. Soziolog:innen, die als sogenannte Kolonialsubjekte geboren waren, unterlagen bei internationalen Reisen selbst noch nach der Dekolonisation deutlich größeren Einschränkungen. Statt durch das gesamte Reich reisten sie gewöhnlich nur zwischen ihrem Heimatland und Frankreich hin- und her (Kapitel 10). Insgesamt existierte ein dichtes Netzwerk intellektueller und wissenschaftlicher Felder und Unterfelder.
Kolonialsoziologie definieren
Der Ausdruck sociologie coloniale (Kolonialsoziologie) ist ein »emischer«, von Soziolog:innen selbst verwendeter Begriff. 1900 fand im Zusammenhang der Weltausstellung in Paris der Congrès international de sociologie coloniale (Internationaler Kongress für Kolonialsoziologie) statt. Sociologie coloniale ist auch der Titel eines dreibändigen Werks des Sorbonne-Professors und lebenslangen Unterstützers des französischen Kolonialismus René Maunier.52 Doch der Zuspruch für die Kennzeichnung als sociologie coloniale schwand nach 1945, als auch Wörter wie »Kolonie« und »kolonial« in den Bezeichnungen und Namen von Kolonialämtern, -organisationen und -publikationen durch Euphemismen ersetzt wurden. Manche sprachen sich dafür aus, sociologie coloniale durch sociologie de la colonisation (Soziologie des Kolonialismus) zu ersetzen.53 Wie Jacques Berque festgehalten hat, war »die Perspektive der Kolonialsoziologie im Allgemeinen die der Kolonisation«, sie war »in erster Linie daran interessiert, die Legitimität der Besatzung anschaulich zu machen mit dem archaischen Charakter« der fremden Kultur.54 Das ist der Grund, weshalb Soziolog:innen, die ihre Karriere während dieser Zeit in den Kolonien begannen, in den Interviews für dieses Buch sich manchmal gegen den Ausdruck sociologie coloniale sträubten.55 Ich werde genauer auf die verschiedenen Umbenennungsversuche eingehen und im Besonderen verfolgen, wie die neuen Etikette mit Kontinuitäten und Veränderungen beim wissenschaftlichen Zugang zum Kolonialthema korrelierten. Ich werde die Begriffe Kolonialsoziologie und Soziologie des Kolonialismus im gesamten Buch als synonyme Analysekategorien verwenden. Beide beziehen sich auf jegliche Formen soziologischer Theoriebildung und Forschung über Übersee-Kolonien und koloniale Phänomene, Reiche und imperiale Phänomene. Mir ist dabei bewusst, dass der erste Ausdruck den Stachel der ursprünglich damit bezeichneten Sache behält: einer weitgehend kolonialistischen Soziologie. Das hat seinen Nutzen: Es erinnern uns daran, dass diese Arbeiten innerhalb von Strukturen entstanden, die auf fremder Souveränität und Herrschaft der Differenz beruhten, selbst wenn ihre Urheber:innen dem Kolonialismus ausdrücklich kritisch gegenüberstanden.56
Das politische Spektrum unter den Kolonialsoziolog:innen nach 1945 reichte von militantem Antikolonialismus bis zu glühender Verfechtung der Kolonialherrschaft, wobei die Mehrzahl dem ersten Pol näherstand. Dasselbe gilt auch für andere Wissenschaften. Auf dem einen Extrem verortete sich der Kolonialbotaniker Pierre Boiteau, der 1948 verlautbarte, dass »ein Forscher, der nicht für die nationale Befreiung des von ihm studierten Volks einsteht, seinen [wissenschaftlichen] Auftrag nicht vollauf erfüllen kann«.57 Auf dem anderen Extrem befand sich der Soziologe Jean Servier, der, finanziert vom Centre national de la recherche scientifique (CNRS), von 1949 bis 1955 in Algerien forschte. Er versuchte durch Gründung eines in der Region Zakkar gelegenen »freien Dorfs« (djema’a libre), dem allerdings kein günstiges Los beschieden war, direkt die französische Aufstandsbekämpfung zu unterstützen.58 Eric de Dampierre trat angeblich für die Erhaltung europäischer Herrschaft zumindest in Äquatorialafrika ein.59 Bourdieu und Sayad verurteilten die französische Algerienpolitik scharf und unterstützten die algerische Revolution von einem liberalen Standpunkt aus. Andrée Michel wurde während des Algerienkriegs zu einer porteuse de valises und im unabhängigen Algerien Professorin an der Universität Algiers.60 Die in Algerien arbeitende Soziologin Claudine Chaulet trat in den 1950er Jahren der Nationalen Befreiungsarmee (FLN) bei. Ihr Ehemann, Dr. Pierre Chaulet, führte Fanon bei der FLN ein. Claudine Chaulet nahm nach der Unabhängigkeitserklärung die algerische Staatsbürgerschaft an und blieb als Professorin im Land.61
Die europäischen Soziolog:innen unterschieden sich auch hinsichtlich ihrer beruflichen und persönlichen Beziehungen von einheimischen Kolleg:innen. Einige reproduzierten die hierarchischen Verhältnisse zwischen Kolonisierenden und Kolonisierten, während andere eng mit arabischen und afrikanischen Forscher:innen zusammenarbeiteten.62 Das erste in Soziologie ausgebildete und beschäftigte französische Kolonialsubjekt war Nguyễn Văn Huyên. Er studierte bei Marcel Mauss, schrieb seine Doktorarbeit 1935 bei Lucien Lévy-Bruhl an der Sorbonne und wurde 1940 bei der französischen École française d’extrême-orient in Hanoi als Forscher eingestellt.63 Georges Balandier arbeitete sowohl im Rahmen des Institut français d’Afrique noire als auch bei seiner Mitwirkung an der Gründung der panafrikanischen Zeitschrift Présence africaine (siehe Kapitel 13) mit einer Reihe von afrikanischen Sozialwissenschaftler:innen, Intellektuellen und politischen Führungsfiguren zusammen. Bourdieu war der erste französische Soziologe, der gemeinsam mit einem als Kolonialsubjekt geborenen Kollegen, Abdelmalek Sayad, eine bedeutende Studie veröffentlichte.64
Schließlich ist noch dreierlei klarzustellen. Erstens waren nicht alle in die Kolonien entsandten Soziolog:innen in ihrer Forschung und Lehre vordringlich mit Kolonialthemen befasst. Der Standardlehrplan für die Metropole wurde auch auf Universitäten in Algerien, Indochina und Senegal übertragen. Zweitens mussten Soziolog:innen nicht unbedingt in den Kolonien arbeiten, um der Kolonialsoziologie zugerechnet zu werden. Das ganze Unterfeld hatte seinen Ursprung als »Schreibtisch«-Forschung, die vorliegende Ethnografien und Reiseberichte zusammenführte.65 Diese synthetisierende Spielart verschwand auch nach 1945 nicht gänzlich.66Als Bourdieu »theoretische Theorie« und »Materialisten ohne Material« kritisierte, spiegelte sich darin eine zu dieser Zeit weitverbreitete Ablehnung »reiner Theorie« wider, die von Forschungsarbeit und Feldforschung getrennt blieb. Diese Kritik steht völlig konträr zum Stereotyp einer vermeintlich hochabstrakten »französischen Theorie«. Drittens bildeten Kolonien und Reiche selten das einzige Thema, dem sich Soziolog:innen im Laufe ihrer Karriere widmeten. Auch wenn Kolonialexpert:innen zu den ersten französischen Soziolog:innen gehörten, die in die Archive gingen und ethnografische Feldforschung betrieben, nahmen nach der Dekolonisation die meisten von ihnen Abstand vom Kolonial-Topos. Manche wurden Afrikanist:innen oder spezialisierten sich auf bestimmte Regionen; andere wurden Spezialist:innen für die Entwicklung der »Dritten Welt«; einige wenige erweiterten ihre Perspektive auf Imperialismus und Reiche. Die Mehrzahl jedoch zog sich wie die französische Bevölkerung insgesamt schlicht ins Kernland zurück.67
Die Identifizierung von Soziolog:innen und Fachgebieten
Auch wenn sich die Geschichte der modernen Wissenschaft nicht auf Fachgebietsgeschichte beschränkt, wäre es irreführend, bestehende Disziplinen zu ignorieren.68 Das gilt besonders für die Nachkriegszeit, als sich Geistesund Sozialwissenschaften deutlicher voneinander abgrenzten. Auf nationaler wie internationaler Ebene wirkten starke Kräfte in Richtung einer Differenzierung und Selbstdefinition der Disziplinen. Das französische CNRS war von Beginn an in separate Abteilungen gegliedert, die sich jeweils um ein Fachgebiet oder einen Fachbereich organisierten. Auf internationaler Ebene trieb die UNESCO die Gründung internationaler und nationaler Fachgebietsorganisationen voran. Amerikanische Stiftungen förderten die Kristallisation von Disziplinen. Dass die sozialwissenschaftlichen Disziplinen im Nachkriegs-Frankreich nicht existiert hätten, ist ebenso falsch, wie dass sie hermetisch abgeschlossene Echokammern gewesen wären.
Wie lässt sich bestimmen, wer in der Vergangenheit einem gegebenen akademischen Gebiet angehörte? Anders gesagt, wer waren die Soziolog:innen? Einer grundlegenden Faustformel folgend umfasst ein spezialisiertes Universum wie die akademische Soziologie all diejenigen, die in ihrer Zeit von anderen Beteiligten als Mitglieder anerkannt wurden. Dieser Ansatz erscheint nur als zirkulär, wenn wir die wesentliche Einheit von Handlungsfähigkeit und sozialer Struktur, von Person und sozialer Umwelt außer Acht lassen. Geistesgeschichte bedarf immer eines expliziten Ansatzes zur Abgrenzung des behandelten Bereichs, sonst läuft sie Gefahr, in zufällige oder einzelfallbezogene Ansätze zu verfallen.
Historiker:innen bedienen sich manchmal zweckdienlichen Arbeitsdefinitionen, beispielsweise rechnen sie dann diejenigen zur Soziologie, die sich selbst als als Soziolog:innen verstanden, in soziologischen Zeitschriften publizierten, an Soziologiekonferenzen teilnahmen oder in ihren Veröffentlichungen soziologische Fachsprache verwendeten.69 Bei diesem Ansatz stellt sich die Frage, welche Zeitschriften der Soziologie zuzurechnen sind, wie verschiedene Autor:innen von zeitgenössischen Soziolog:innen beurteilt wurden und in welcher Hierarchie diese Zeitschriften standen – alles Punkte, die eine Rolle in den Auseinandersetzungen des soziologischen Felds selbst spielen. Am willkürlichsten wäre der Ansatz, diejenigen der Soziologie zuzurechnen, die aus heutiger Sicht als Soziolog:innen erscheinen. Dabei sind Kämpfe um die Grenzen von Feldern und das feldspezifische »herrschende Herrschaftsprinzip« eines der zentralen Charakteristika der Wissenschaftsgeschichte. Man begeht einen Methodenfehler, wenn man die strukturierenden Prinzipien innerwissenschaftlicher Kämpfe für die eigene Klassifikation übernimmt. Viele der in diesem Buch einbezogenen Soziolog:innen würden heute spontan als Anthropolog:innen eingeordnet werden, weil sie über nichtwestliche Gesellschaften forschten.
Bourdieus Feldtheorie bietet eine methodologische Lösung für dieses Problem.70 Eine wissenschaftliche oder akademische Disziplin lässt sich am besten durch historische Rekonstruktion ihrer Genese verstehen, indem man mit ihren Nomotheten, den Begründern des wissenschaftlichen nomos, beginnt und dann dem Feld entlang der zeitlichen Entwicklung seiner struktureller Positionen und Achsen der Polarisierung folgt. Die Genese des Felds muss auch deshalb rekonstruiert werden, um bestimmen zu können, welche Gründer in der Vergangenheit die größte Macht hatten.71 Oft gibt es einen fortlaufenden Prozess der genealogischen Rekonstruktion, durch den neue Akteur:innen anerkannt und mit aufgenommen werden, während andere vergessen oder aus der Geschichte des Felds ausgeschlossen werden. Wissenschaftliche Kanons werden kontinuierlich revidiert. Der einzige sichere Weg zur Bestimmung der Beteiligten eines Fachgebiets zu einem gegebenen Zeitpunkt ist die Rekonstruktion der Urteile anerkannter Mitglieder des Felds zu diesem Zeitpunkt.
Bourdieus Theorie befasst sich nicht nur mit Praxis, Ungleichheit und Herrschaft innerhalb von Feldern. Sie ist auch eine Theorie der Bestimmung der Grenzen zwischen Feldern und eine Theorie nicht feldmäßig strukturierter Handlungen. Bourdieu beobachtete, dass Feldgrenzen oft mehr an Wolkenränder oder Waldsaum erinnern als an die Grenzen zwischen Nationalstaaten.72 Nichtsdestotrotz erhielt die Soziologie in der Nachkriegszeit ein klareres Profil gegenüber Nachbardisziplinen. Die schärfere Abgrenzung wird zum Beispiel am CNRS deutlich, das die Soziologie einer anderen Abteilung als der Ethnologie zuordnete, wenngleich viele in der Disziplin Tätige dazu neigten, beide Fachgebiete gleichzusetzen, oder frei zwischen beiden wechselten.73
Manchmal kann ein Mitglied eines Felds auch mittels anderer Informationen als der Urteile direkt Beteiligter identifiziert werden. Bourdieu schreibt dazu: »Eine der charakteristischen Eigenschaften eines Feldes ist das Ausmaß, in dem seine dynamischen Grenzen […] sich in eine juristische Grenze verwandeln, die ein explizit kodifiziertes Zulassungsrecht etwa in Form des Besitzes von Ausbildungsabschlüssen, des Erfolgs bei einem Wettbewerb usw. schützt, oder auch in Form von Ausschließungs- und Diskriminierungsmaßnahmen wie etwa Bestimmungen, die einen numerusclausus sichern sollen.«74 Sobald ein spezifischer akademischer Grad zum Eintritt erforderlich wird, kann er zur notwendigen, wenngleich üblicherweise nicht hinreichenden Bedingung für Feldzugehörigkeit werden.75 Wissenschaftliche und akademische Felder unterscheiden sich jedoch deutlich im Grad der Spezialisierung und Kodifizierung. Eine strenge Definition auf Grundlage »juristischer Grenzen« würde implizieren, dass es die Soziologie vor den 1960er Jahren nur in den Vereinigten Staaten, Deutschland, Großbritannien, Südafrika und einer Handvoll anderer Länder gegeben hätte. In Frankreich existierte sie bereits als geistige und akademische Disziplin, doch ihre einzige Anerkennung an den Universitäten bestand in einem Zertifikat in morale et sociologie (Ethik und Soziologie), das sich im Rahmen einer Philosophie-licence erwerben ließ.76 Eine eigenständige licence und ein doctorat in Soziologie wurden erst 1958 eingeführt. Die meisten großen französischen Soziolog:innen des 20. Jahrhunderts hatten eine agrégation in Philosophie, aber keinen Abschluss in Soziologie. Es gab noch keine »juristischen« Bestimmungen, die Zugehörigkeit und Ausschluss regelten. Einem soziologischen Mitgliedsabzeichen am nächsten kam in Frankreich ein Lehrstuhl in Soziologie an einer Universität oder einer der grandes écoles oder auch die Anstellung als Soziolog:in bei einer seriösen Forschungsinstitution wie dem CNRS.77 Ein weiteres Kriterium während der Nachkriegszeit war die Mitgliedschaft am Centre d’études sociologiques.78 Mitgliedschaft im Beirat einer der großen Soziologiezeitschriften – L’Année sociologique, Cahiers internationaux de sociologie und (nach 1960) Revue française de sociologie – oder am wieder gegründeten Institut français de sociologie hatte Gewicht, war aber nicht immer entscheidend, da sich diese Institutionen aus Angehörigen ganz unterschiedlicher Disziplinen rekrutierten.
Wo uns solche Informationen fehlen, müssen wir uns auf die fallweise Rekonstruktion der Wissenschaftskarriere und der Wahrnehmung durch andere Angehörige des Felds stützen. Wir können festzustellen versuchen, ob etablierte Mitglieder eines jeweiligen Fachgebiets zu gegebenem Ort und Zeitpunkt eine bestimmte Person als eine der ihren ansahen.79 In manchen Fällen lässt sich einfach keine Zugehörigkeit zu einer akademischen Disziplin bestimmen. Dies gilt vor allem für Personen, die zwischen der Wissenschaft und intellektuellem, kulturellem und politischem Feld hinund herwechselten oder die mit interdisziplinären Institutionen wie dem Collège de France verbunden waren, an denen man eigene Titel und Spezialisierungen erfinden konnte. Einige Wissenschaftler:innen verweigerten sich auch bewusst einer disziplinären Zuordnung.
Ein verbreitetes Muster in unserem Wissenschaftsbereich war die Verbindung von Soziologie und Ethnologie/Anthropologie. Eine gewisse Anzahl der hier dargestellten Soziolog:innen hatten eine Reihe kurzfristiger Anstellungen in der Metropole und veröffentlichten eher in Zeitschriften, die sich spezifisch mit bestimmten Kulturen, Regionen oder Ländern befassten, als in genuin soziologischen Publikationen. Viele von ihnen arbeiteten an Themen, die traditionell der Anthropologie zugehört hatten und mittlerweile auch wieder in die Anthropologie zurückgewandert sind. Dies erschwert die klare Sicht auf die deutlich andere Konstellation um die Jahrhundertmitte. Wo keine Stelle in »Ethnologie« verfügbar war, wurden Wissenschaftler:innen manchmal auch als Soziolog:innen kategorisiert. Beim Wechsel an andere Institutionen wurden sie dann wieder als Ethnolog:innen eingeordnet. Das Office de la recherche scientifique et technique outre-mer beispielsweise subsumierte in ihren Publikationen die Ethnologie unter Soziologie und hatte in der Nachkriegsperiode Soziolog:innen, aber keine Ethnolog:innen unter ihren Beschäftigten.80 Europäische Anthropolog:innen, die von Universitäten in der Metropole an Universitäten in den Kolonien oder ehemaligen Kolonien wechselten, wurden aufgrund feindseliger Einstellungen gegenüber der Anthropologie, die sich aus deren Verstrickung in den Kolonialismus speisten, zu Soziolog:innen umetikettiert.81 In dieser Wendung gegen die Anthropologie spiegelt sich aus heutiger Perspektive die gegenläufige Bewegung, heute nichtwestliche Soziolog:innen, die sich auf ihre eigene (postkoloniale) Gesellschaft spezialisiert haben, als Anthropolog:innen einzuordnen, wenn sie an europäische oder nordamerikanische Universitäten kommen. Das ist eine direkte Anwendung der üblicherweise unausgesprochenen Regel, nach der die Anthropologie in der disziplinären Arbeitsteilung die »Nische der Wilden« besetzt.82
Die Anerkennung der Zugehörigkeit zu einem bestimmten Feld geht Hand in Hand mit anderen Kennzeichen der Disziplin wie einem spezifischen intellektuellen Habitus und der Verwendung des Fachjargons und innerdisziplinärer Bezüge. Das Eintauchen in die illusio (Bourdieu) eines Fachgebiets bringt notwendig Bekenntnis zu ihren scheinbar esoterischen Ideen und eine Bindung an ihre Erfolge und Misserfolge mit sich, die von außen betrachtet bedeutungslos und willkürlich erscheinen. Oft lässt sich das graduelle Eintauchen einer Person in eine Disziplin am Vokabular, an Formulierungen und Verweisen auf bestimmte Autoritäten nachverfolgen.
Wer nun aber sollte nicht zum akademischen Feld der Soziologie gerechnet werden? Gibt es auch methodologische Regeln des Ausschlusses? Welche Kriterien gibt es für eine Verortung am äußersten Rand des soziologischen Felds? Hier richte ich mich wieder nach mehreren methodologischen Faustregeln. Zunächst sollten alle, die zwar als Soziologiedozent:in oder -forscherin arbeiteten, aber nicht publizieren und auch nicht in nationalen oder internationalen Soziologievereinigungen aktiv waren, hinsichtlich des Felds zumindest als äußerst marginal eingestuft werden. Ihnen fehlte Sichtbarkeit über einen lokalen Rahmen hinaus sowie die Anerkennung eines weiter gefassten Felds; bestenfalls lassen sie sich als Beteiligte eines lokalen soziologischen Felds begreifen. Dasselbe gilt im Allgemeinen für Verwaltungsangestellte, Forschungsassistent:innen und Studierende. Natürlich hängt alles davon ab, ob jemand als dem Feld angehörend anerkannt wird oder nicht.83 Eine der Fragen des zehnten Kapitels ist die nach soziologischen Gründen, warum sich manche Personen am Rand des disziplinären Feldes befanden oder aus ihm ausgeschlossen wurden.
Eine neobourdieusche historische Wissenschaftssoziologie
Dieses Buch folgt einer historischen Fassung des bourdieuschen Ansatzes, die ich als neobourdieusche historische Wissenschaftssoziologie bezeichne. Die historische Soziologie der Sozialwissenschaft hat von der praxistheoretischen Perspektive Bourdieus und seiner Schule einen ungeheuren Anschub erhalten. Bourdieu hat argumentiert, dass soziale Praxis bestimmt ist durch das Zusammenspiel (1) des Habitus eines Akteurs, der soziogenetisch über den biografischen Zeitverlauf rekonstruiert werden muss, (2) der Positionen des Akteurs in spezifischen relevanten Feldern sowie der Geschichte dieser Felder, die den Raum der Positionen in einem Feld zu einem gegebenen Zeitpunkt erklärt, und (3) der praktischen und strategischen »Positionierungen« (prises de position) des Akteurs innerhalb dieser Felder.84 Bourdieus Paradigma nimmt die Idee ernst, dass Felder, einschließlich der wissenschaftlichen, relativ autonom sein können, das heißt partiell gegen ihr Außen abgeschirmt und abgegrenzt, auch wenn sie zugleich in umgebende soziale Felder und Räume eingebettet und teilweise deren Bedingungen unterworfen sind.85 Anders als die amerikanische Wissenschaftssoziologie der 1950er und 1960er Jahre mit ihrem Ideal einer »Wissenschaftsgemeinschaft« konzentriert sich dieser Ansatz auf Trennlinien und Konflikte sowie partielle und temporäre Konsense innerhalb der Wissenschaft. Wissenschaftliche Disziplinen sind typischerweise durch ungleiche Verteilung feldspezifischer Macht und Ressourcen geprägt und von inneren Konflikten zerrissen.
Ich arbeite mit der Prämisse, dass die Soziologie der Sozialwissenschaft Denker:innen und ihre Werke sowohl für sich genommen als auch in ihrem Verhältnis zum näheren Wissenschaftskontext wie auch zu entfernteren soziohistorischen Kontexten untersuchen muss. Dieses Verfahren lässt sich vergleichen mit, aber auch abgrenzen von der ursprünglichen Wissenssoziologie, die sich nach Karl Mannheims Definition zwischen zwei Extremen verortet: verallgemeinerten Darstellungen, die individuelle Unterschiede zwischen Wissenschaftler:innen und Werken außer Acht lassen, und Darstellungen, in denen »einzigartige Züge im Denken jedes Einzelnen überbetont werden und die Bedeutung seines sozialen Milieus für die Natur seines Denkens ignoriert wird«.86 Mannheim illustrierte diesen Ansatz in seiner Fallstudie des deutschen Konservatismus. Er diskutierte ihn auch in seiner selbstreflexiven Erklärung der Möglichkeitsbedingungen für seine eigene theoretische Perspektive.87 Die nationalsozialistische Machtergreifung zwang ihn ins Exil und unterbrach sehr unsanft laufende Diskussionen über die Wissenssoziologie.88 Mannheim hat nie eine systematische Theorie gesellschaftlicher Kontexte, kultureller Werke oder des wissenschaftlichen Gegenstands entwickelt. Diejenigen, die die Wissenssoziologie in den Vereinigten Staaten aufgriffen, so etwa Robert K. Merton, Edward Shils oder Alvin Gouldner, bewegten sich in einer Disziplin, die der Beschäftigung mit diesen Fragen entgegenwirkte, weil sie dem Marxismus, der Psychoanalyse und der Literaturkritik näher zu liegen schienen. Mannheims Denken war eingebettet in philosophische Diskussionen, die auf Kant und Hegel beruhten, während die amerikanische Soziologie philosophisch weitgehend unbeleckt war, wenn man vom Neopositivismus absieht.89 Das Verschwinden der Wissenssoziologie in Deutschland und Österreich resultierte aus der aggressiven Feindseligkeit der antisemitischen Rechten gegenüber Mannheim.90 Nach einem verheißungsvollen Start in den Vereinigten Staaten mit Mertons Frühwerk in der Zwischenkriegszeit verengte die Wissenschaftssoziologie ihren Fokus auf die mittlere Ebene der Wissenschaftsgemeinde.91 Nach dem Zweiten Weltkrieg wandte sich Merton gegen die deutsche Wissenssoziologie und ersetzte sie durch eine »amerikanisierte ›sociology of knowledge‹«, die im Kontext des Kalten Kriegs annehmbarer war.92 Merton warnte 1952, dass »die Beziehungen zwischen Wissenschaften und Gesellschaft ein Thema darstellen, das anrüchig geworden ist für akademische Soziologen, die um seine Bedeutung für die marxistische Soziologie wissen.«93 Die neue Soziologie befasste sich nicht mit Wissenschaft per se, aber mit Wissenschaftler:innen, mit »Karrieremustern, Arbeitsorganisation, Förderern und erklärten Werten«. Mit Durchsetzung ihres »starken Programms« in der Wissenschaftssoziologie und der Wissenschafts- und Technikforschung versenkten die Forscher:innen ihren Blick noch tiefer ins Laboratorium, klammerten weitere Rahmenbedingungen aus und legten eine »beflissen deskriptive Haltung« gegenüber den Wissenschaften an den Tag, mit der sie die Botschaft transportierten, dass »Wissenschaft normalerweise funktioniert, wie sie soll«.94
Dieses Buch soll zeigen, dass die Wissenssoziologie unter den ganz andersgearteten Bedingungen des späten französischen Kolonialreichs zu ihrer Entfaltung kommen konnte. Ihre überraschende Wanderbewegung nach Frankreich und dortige Reifung um die Jahrhundertmitte beruhte auch auf der größeren Offenheit der französischen Soziologie – verglichen mit der amerikanischen oder der deutschen nach 1933 oder 1945 – gegenüber Fragen wissenschaftlicher Selbstreflexion. Ein weiterer entscheidender Faktor war ihre größere Nähe zur Philosophie, eine Folge der Ausbildung vieler ihrer zentralen Figuren an der École normale supérieure. Die französische Soziologie konnte sich der Wissenssoziologie auch aufgrund der Durchlässigkeit ihrer Fachgrenzen öffnen, die sie über laufende Diskussionen in der Philosophie, Anthropologie, Linguistik, Psychoanalyse, Geschichtswissenschaft und im (Neo)Marxismus sensibilisierte. Bourdieu brachte einzigartige Voraussetzungen mit, um diese vielfältigen intellektuellen Ressourcen miteinander zu verbinden und eine soziologische Theorie zu entwickeln, die eine Brücke zwischen Sozial- und Geisteswissenschaften schlägt. Dem Anspruch nach ähnelt dies Karl Marx’ Verbindung der junghegelianischen Philosophie mit der britischen politischen Ökonomie und der Lehre des französischen Frühsozialismus. Es erinnert an Gustave Flauberts Erfindung einer beispiellosen Position in einem neu geschaffenen Feld der französischen Literatur, das Bourdieu in Die Regeln der Kunst diskutiert.95 Es ähnelt auch der Begründung neuer Theorien und struktureller Positionen zwischen Philosophie und angrenzenden Feldern durch Jacques Derrida und Michel Foucault. Bourdieus Innovation wurde zugleich ermöglicht durch die intellektuellen, politischen und kolonialen Rahmenbedingungen, die in diesem Buch Thema sein werden.96 Bourdieus Gesellschaftstheorie zeichnet sich dadurch aus, dass sie Felder und Gegenstände jenseits der Wissenschaft behandelt und gleichzeitig die Soziologie des Wissens über diese Objekte diskutiert.
Wie schon in früheren Publikationen vertrete ich hier, dass sich Bourdieus übergreifender Bezugsrahmen als eine Praxis der historischen Sozioanalyse rekonstruieren lässt. Dies ist nicht so sehr eine orthodoxe bourdieusche oder postbourdieusche Perspektive, sondern eine neobourdieusche, da sie auf seinen Grundideen aufbaut, sie in unterschiedlichem Maße aber auch modifiziert. Bourdieus Ansatz richtet die Aufmerksamkeit bei der Analyse geistiger Produktion auf vier Schlüsselkomponenten: Feld, Kontext, Autor:in und Text. Jede dieser Komponenten muss explizit theoretisiert werden. Bourdieu gibt reichlich Orientierung für die ersten beiden, für die dritte beschränkt sich seine Auseinandersetzung auf die Habitus-Theorie. Für die Textanalyse müssen wir auf andere Ressourcen zurückgreifen.
Genauer gesagt, bedarf Bourdieus Theorie in sechs Bereichen einer Revision oder Rekonstruktion: hinsichtlich (1) der Beziehungen zwischen Feldern und umfassenderen gesellschaftlichen oder historischen Rahmenbedingungen; (2) der räumlichen Koordinaten der Feldtheorie; (3) der Theorie des Subjekts, die Bourdieu auf die Begriffe Habitus und Praxis beschränkt; (4) des Erfordernisses expliziterer Analysemethoden für Texte und visuelle Werke; (5) der Kompatibilität der zugrunde liegenden Wissenschaftsphilosophie mit kritischem Realismus und postkolonialer Epistemologie; (6) der Theorie der Reflexivität.
Mit Blick auf den ersten Punkt habe ich hier wie in anderen Veröffentlichungen zu zeigen versucht, dass soziale Felder und soziale Räume in umfassenderen Rahmenverhältnissen verortet werden sollten, die geprägt sind durch Formen gesellschaftlicher Regulierung, vorherrschende kulturelle Diskurse, Denkstile (Karl Mannheim) oder die politischen, ökonomischen und sozialen Kräfte, die manchmal einer ganzen Epoche oder geopolitischen Region ihren Stempel aufdrücken und einen Bezugsrahmen für alle Felder liefern.97 Diese größeren Bezugsrahmen sind nicht supervenient in dem Sinne, dass Felder in einer asymmetrischen Abhängigkeitsbeziehung zu ihnen stünden. Dennoch können sie das Handeln innerhalb dieser Felder prägen, denn deren Autonomie gegenüber ihrer Umwelt ist immer eine relative, nie eine absolute. Der erste Punkt ist entscheidend für eine Bestimmung der Spannbreite der für Wissenschaftsgeschichte relevanten Bezugsrahmen. Bourdieu theoretisiert zwar den sozialen Raum, der alle Felder umgibt und dessen basale Dimensionen den Strukturdimensionen von Feldern entsprechen – verschiedene Arten von Kapitel, Habitusformen, Beziehungen von Autonomie und Heteronomie usw. Doch er hat keine Theorie der Beziehungen zwischen Feldern, sofern sie über die Grundarchitektur des sozialen Raums, das Machtfeld und den Staat hinausgehen, also zwischen verschiedenen Feldern im Allgemeinen. Das soll nicht heißen, dass wir eine allgemeine Gesellschaftstheorie epochenspezifischer Bezugsrahmen bräuchten. Was wir aber brauchen, sind Begriffe, die an spezifische historische Perioden und Räume geknüpft sind und den weitesten gesellschaftlichen Rahmen abstecken – Begriffe wie Entwicklungskolonialismus, Spätkolonialismus, Fordismus, Postfordismus, Faschismus, Totalitarismus usw. Mithilfe dieser Konzepte kann die Geschichtsforschung übergreifende Bezugsrahmen intellektuellen Schaffens identifizieren – Bezugsrahmen, die immer uneinheitlich und im Wandel sind, aber doch die eine oder andere Schlagseite aufweisen mögen.
Damit eng verbunden ist der zweite Punkt: Die Feldtheorie muss in einem geopolitischen statt nur (metaphorischen) sozialen Raum verankert sein. Es kann nie einfach unterstellt werden, dass Felder in ihrer räumlichen Ausdehnung mit dem Nationalstaat zusammenfallen, oft haben sie einen kleineren oder größeren geopolitischen Fußabdruck. Sozialwissenschaftler:innen müssen immer zunächst die Geokoordinaten eines Felds bestimmen, um die Zirkulation von Ideen, Gegenständen und Akteuren innerhalb des sozialen Raums zu verstehen. Eine solche materielle, räumliche Erdung ist entscheidend für die Vermessung von Feldern, mit denen wir es bei der Erforschung von Reichen und Kolonien zu tun haben und die auf einem anderen Maßstab funktionieren als Felder auf nationaler oder globaler Ebene.98 Dieser Ansatz ermöglicht uns, Felder zu denken, die ein Kernland mit spezifischen Kolonien verbinden.99 Die räumliche Verankerung der Feldtheorie kann auch wichtig sein für das Verständnis von Praktiken auf subnationaler oder internationaler Analyseebene, innerhalb von Regionen, die kleiner als das nationale Territorium sind, oder von Zonen, die Regionen in zwei oder mehr Ländern verbinden.
Wie steht es mit der Subjekttheorie? Mit Bourdieus Habitus- und Praxistheorie als Ausgangspunkt sind Ansätze ausgeschlossen, die auf Rationalismus, Voluntarismus oder psychischer Einheit basieren oder andererseits das Subjekt als bloßen Träger sozialer Strukturen fassen. Auch wenn Bourdieu vertritt, dass Praxis nur im Hinblick auf ein ganzes Gefüge sozialer Bezugsrahmen verstanden werden kann, ist er sich durchaus bewusst, dass Personen körperliche Dispositionen (Habitus) verinnerlicht haben, die über ihre Entstehungsbedingungen hinaus fortbestehen und über bewusstes Handeln hinaus wirksam sein können. Seine skizzenhaft gebliebene Subjekttheorie muss rekonstruktiv zu einer vollwertigen Theorie der Psyche und des Subjekts entwickelt werden. Das Konzept des Habitus lässt sich mit Lacans Begriffs des Imaginären neu theoretisieren und auf einer mittleren Ebene zwischen bewusstem und unbewusstem Denken verorten.100 Wir müssen die Einzelnen – Wissenschaftler:innen miteingeschlossen– als mit einem Unbewussten versehen denken. Dieser dritte Punkt ist es auch, weshalb sich mein Ansatz als Sozioanalyse bezeichnen lässt. Dabei folge ich einer Anregung Bourdieus und anderer französischer Soziolog:innen, interpretiere den Ausdruck aber als Verschmelzung von soziologisch mit Psychoanalyse.101
Eine Diskussion von Bourdieus Theorie der Subjektivität muss auch seine Praxistheorie einbeziehen. Praxis ist der zentrale Begriff seiner Sozialtheorie. Von Bourdieu inspirierte Wissenschaftsforschung nimmt daher notwendigerweise zeitliche Veränderungen der Wissenschaftspraxis in den Fokus.102 Bourdieus soziale Ontologie der Praxis bewahrt ihn vor Vorstellungen, dass sich soziale Systeme im Normalfall über die Zeit reproduzieren, auch wenn er oft soziale Reproduktion als möglichen paradoxen Zustand der Verhältnisse thematisiert.103 Wie soziale Strukturen im Allgemeinen sind auch soziale Felder wesentlich instabil und dynamisch; ihre Stabilisierung oder Reproduktion kann daher immer nur vorübergehend sein. Dynamische Prozesshaftigkeit ist auf allen Ebenen in die bourdieusche Theorie eingebaut, einschließlich seiner Feldtheorie. Mit besonderem Nachdruck gilt das für wissenschaftliche Felder, die entstehen und vergehen, sich mit anderen Feldern überschneiden und gegenseitig beeinflussen und sich aufgrund fortwährender Auseinandersetzungen, neuer Generationen von Wissenschaftler:innen und »spezifischen Revolutionen« in einem ständigen Wandel befinden.104 Für Bourdieu hat sich soziale Reproduktion als analytisches Problem in den 1960er Jahren aufgeworfen, als die Dominanz der strukturalistischen Theorie noch zusätzlich durch eine außergewöhnliche Konstellation relativer gesellschaftlicher Stabilität verstärkt wurde, die Theorien des »sozialen Reproduktionismus« plausibler erscheinen ließ. Von Parsons’ Strukturfunktionalismus über die lévi-strausssche Anthropologie bis zu althusserianischem Marxismus hat sich die Gesellschaftstheorie vom Idealtyp der sozialen Reproduktion verführen lassen.105 Denker:innen wie Bourdieu, die vor den 1960er Jahren mit Kolonialschauplätzen konfrontiert waren, waren dagegen gefeit, die Reproduktion der sozialen Verhältnisse für den Normalzustand zu halten. Da der Praxis-Begriff im Mittelpunkt von Bourdieus Sozialtheorie steht, konzentriert sich die davon inspirierte Wissenschaftsforschung notwendigerweise auf zeitliche Veränderungen der Wissenschaftspraxis.106 Bei diesem Punkt geht es weniger um eine Rekonstruktion Bourdieus als um die Hervorhebung eines Sachverhalts.
Was den vierten revisionsbedürftigen Bereich anbelangt, hat Bourdieu selbst anerkannt, dass sozialwissenschaftliche Arbeit in erster Linie textlich und visuell vorliegt, trotz Bemühungen um eine Übersetzung sozialer Praxis in Statistik und Mathematik. Ihm war bewusst, dass die Sozialwissenschaft wie andere Felder der Kulturproduktion nicht nur ein Feld von Akteuren und Institutionen, sondern auch von Werken ist, die in Beziehung zu anderen Werken stehen. Die historische Soziologie der Soziologie (oder jeder anderen primär textbasierten Praxis) sollte Texte in ihrer Positioniertheit innerhalb eines relationalen »Werkraums« analysieren. Bourdieu stand rein formalistischen Ansätzen der Kulturkritik, bei denen Werke ausschließlich immanent und in Beziehung zu anderen Werken analysiert werden, kritisch gegenüber, doch scheute er auch vor stilistischen Fragen nicht zurück, wie beispielsweise in seiner Vorlesung über Manet.107 Allerdings hat er keine Interpretationsmethodik entwickelt, die seiner Analyse von Texten und Bildwerken angemessen wäre. Er hat sich nicht mit dem Nutzen von Theorien narrativer oder Konzepten der Transtextualität auseinandergesetzt, auf die ich mich hier zum besseren Verständnis der Soziologie des Kolonialismus stütze.108 Was wir benötigen, ist ein Zugang zu sozialwissenschaftlichen Texten, der mit formalen Methoden und Begriffen arbeitet, wie sie etwa in Literaturkritik und Kunstgeschichte entwickelt wurden und mit denen wir uns die strukturellen und formalen Aspekte von Texten bewusst machen können, die Beziehungen der Texte untereinander, ihre Bezüge aufeinander, ihre gegenseitige Exegese und Kommentierung (Intertextualität, Paratextualität usw.). Dies nötigt uns, auf Erzählform, Perspektive, Tempus und auktoriale Stimme zu achten. Diese Beziehungen bestehen sowohl zwischen Werken des unmittelbaren Fachs oder des disziplinären Unterfeldes als auch zu Werken anderer Gebiete.109 Ein adäquater Ansatz zur Interpretation von Kulturprodukten ist für das Verstehen soziologischer Texte wesentlich.
Der fünfte Punkt betrifft die Wissenschaftsphilosophie. Nach Bourdieus Verständnis ist »die Soziologie der Soziologie eine grundlegende Dimension der Wissenschaftstheorie der Soziologie«.110 Bourdieus Wissenschaftsphilosophie ist weitgehend mit dem Kritischem Realismus und der Epistemologie des Neohistorismus kompatibel.111 So lässt sie sich, stellt man diese Bezüge her, gut mit einer elaborierteren und expliziteren Kritik des Positivismus verbinden. Dabei geht es weniger um eine Revision Bourdieus als darum, seine Epistemologie in Verbindung mit angloamerikanischen und deutschen Traditionen zu bringen, die sich gegenüber dem Positivismus ähnlich positionieren und einigermaßen gut mit ihr vereinbare Alternativen bieten, auch wenn die Voraussetzungen ihrer Debatten teilweise radikal andere sind.112 Bourdieus Ansatz ist stark antipositivistisch, wenn wir unter Positivismus den Glauben an die Existenz universell geltender, allgemeiner Gesetze menschlichen Verhaltens verstehen. Er lehnt Epistemologien ab, die auf Regeldeterminismus basieren, und ist sehr sensibel für Kontingenz und komplexe Kausalzusammenhänge. Er lehnt auch Szientismus ab: die Idee, die Sozialwissenschaft sollte sich an vermeintlichen Normen der Naturwissenschaft orientieren. Bourdieus Epistemologie des Bruchs mit spontanen Vor-Begriffen beruht auf dem Unterschied zwischen der Ebene unmittelbarer empirischer Erscheinungen und »vorfindlicher Objekte« und einer Ebene zugrunde liegender realer Strukturen und Prozesse. Bourdieu verweist auf Bachelards Aussage »Wissenschaft gibt es nur vom Verborgenen«.113 Diese Auffassung der Wirklichkeit als schichtartig entspricht der stratifizierten Ontologie des Kritischen Realismus. Wie Kritische Realist:innen ist Bourdieu davon überzeugt, dass erklärende Sozialwissenschaft organisch zu Gesellschaftskritik führen kann, indem sie »echte Orte der Freiheit« und Orte tödlichen Zwangs identifiziert und durch die Schichten symbolischer Herrschaft und Verschleierung dringt.114 Soziologie ist immer politisch. Doch der »ethische[…] Gebrauch der reflexiven Soziologie« verbindet sich mit der konsequenten Weigerung, die Soziologie der Politik oder sonst einer Beschränkung ihrer Autonomie unterzuordnen.115 Bourdieus Erklärungsansätze für das Aufkommen neuer Kunst- oder Literaturstile oder Ereignisse wie den Mai 1968 beruhen auf einer Epistemologie der kontingenten Überlagerung verschiedener historischer »Reihen«. Dieser Ansatz lässt sich leicht verbinden mit der kontingentistischen Epistemologie des Kritischen Realismus und dem soziologischen Neohistorismus des 20. Jahrhunderts.116
Der letzte Punkt betrifft Bourdieus Argument, dass in der Sozialwissenschaft eine spezifische Form von Reflexivität erforderlich ist, um die der Praxis zugrunde liegende soziale Logik verstehen zu können. Hier sehe ich nicht so sehr Bedarf an einer Revision seiner Gedanken als vielmehr an deren Klärung und ihrer Übertragung auf die Geschichte der Sozialwissenschaft. Bourdieu vertritt, dass die historische Wissenschaftssoziologie im Zentrum wissenschaftlicher Reflexivität steht. Dabei ist Reflexivität, wie er sie definiert, geradezu das Gegenteil dessen, was in der breiten Öffentlichkeit und im populärsoziologischen Diskurs üblicherweise darunter verstanden wird. Statt positiver Erfassung der eigenen sozialen, politischen und epistemischen Position beinhaltet Reflexivität einen Bruch mit solchen gegebenen Erkenntniskategorien. Am Anfang steht der Bruch des Soziologen oder der Soziologin mit den eigenen spontanen Theorien oder Begriffen des zu erforschenden Gegenstands. Solche wissenschaftlichen »Vor-Begriffe« können die Doxa einer Disziplin widerspiegeln; umgekehrt können sie in heterodoxen Ideen wurzeln, die aufgrund von Hierarchien und Antagonismen in den sozialen Beziehungen eines wissenschaftlichen Felds unbewusst übernommen wurden. Zweitens muss es einen Bruch mit den Kategorien geben, die die Beforschten selbst zum Verständnis ihrer eigenen Praxis verwenden. Im Fall der Wissenschaftssoziologie bedeutet dies einen Bruch damit, wie die Wissenschaftler:innen ihre Praxis spontan selbst deuten. Bourdieus Theorie setzt sich also an die Stelle der älteren Unterscheidung zwischen »etisch« und »emisch«, zwischen wissenschaftlicher Fremdbeschreibung und spontanen Formen der Selbstbeschreibung.117
Sozialwissenschaftler:innen dürfen die Instrumente, Theorien und Begriffe, die sich ihnen unmittelbar anbieten, nicht blind übernehmen. Sie müssen reflektieren, was sie tun, wenn sie Wissenschaft betreiben, mit welchen Vorannahmen sie arbeiten und welche unausgesprochenen Übereinkommen sie unbeabsichtigt reproduzieren könnten. Positiver gesagt: es lässt sich auch erwägen, wie ein reflexiver Bezug auf die Wissenschaftspraxis die Sozialwissenschaft insgesamt fördern und einen Beitrag dazu leisten kann, einen vernünftig begründeten Rahmen für soziale und zivilgesellschaftliche Interventionen durch Sozialwissenschaftler:innen zu schaffen. Um ihre eigene Position zu verstehen, müssen die Forscher:innen die Wissenschafts- und Machtfelder, in denen sie sich zum Zeitpunkt ihrer Forschung selbst befinden, objektivieren.118