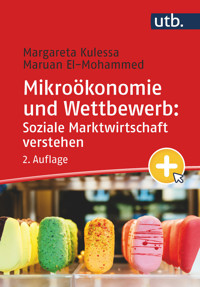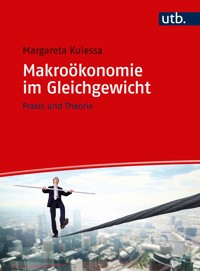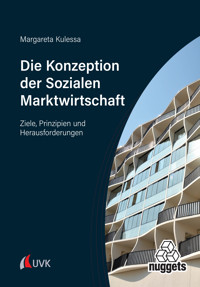
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: UVK
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: nuggets
- Sprache: Deutsch
Vom Merkantilismus über den Ordoliberalismus zur Sozialen Marktwirtschaft Die Wirtschaftsordnung unseres Landes basiert auf dem Leitbild der Sozialen Marktwirtschaft. Margareta Kulessa stellt es in diesem kompakten Nugget-Band vor: Sie beleuchtet die wirtschaftspolitische Konzeption, die geschichtliche Entwicklung, sowie die politischen Anfänge mit Weichenstellungen in z.B. Ordnungs-, Sozial- und Wohnungsbaupolitik. Auch auf ökologisch-soziale Herausforderungen geht sie ein. Das Buch richtet sich an Studierende und Dozierende der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften sowie der Politikwissenschaft.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 112
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Margareta Kulessa
Die Konzeption der Sozialen Marktwirtschaft
Ziele, Prinzipien und Herausforderungen
UVK Verlag · München
Umschlagabbildung: © Heiko Küverling · iStockphoto
DOI: https://doi.org/10.24053/9783381114122
© UVK Verlag 2024— Ein Unternehmen der Narr Francke Attempto Verlag GmbH + Co. KGDischingerweg 5 • D-72070 Tübingen
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Alle Informationen in diesem Buch wurden mit großer Sorgfalt erstellt. Fehler können dennoch nicht völlig ausgeschlossen werden. Weder Verlag noch Autor:innen oder Herausgeber:innen übernehmen deshalb eine Gewährleistung für die Korrektheit des Inhaltes und haften nicht für fehlerhafte Angaben und deren Folgen. Diese Publikation enthält gegebenenfalls Links zu externen Inhalten Dritter, auf die weder Verlag noch Autor:innen oder Herausgeber:innen Einfluss haben. Für die Inhalte der verlinkten Seiten sind stets die jeweiligen Anbieter oder Betreibenden der Seiten verantwortlich.
Internet: www.narr.deeMail: [email protected]
ISSN 2941-2730
ISBN 978-3-381-11411-5 (Print)
ISBN 978-3-381-11413-9 (ePub)
Inhalt
Abkürzungen
Abb. | Abbildung
ALG | Arbeitslosengeld
Alhi | Arbeitslosenhilfe
BDA | Bundesvereinigung deutscher Arbeitgeber
BIP | Bruttoinlandsprodukt
CDU | Christlich Demokratische Union Deutschlands
CSU | Christlich-Soziale Union in Bayern
DDR | Deutsche Demokratische Republik
DGB | Deutscher Gewerkschaftsbund
EU | Europäische Union
FDP | Freie Demokratische Partei
GG | Grundgesetz
GWB | Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen
SGB | Sozialgesetzbuch
SPD | Sozialdemokratische Partei Deutschlands
StabG | Gesetz zur Förderung der Stabilität und des Wachstums der Wirtschaft („Stabilitätsgesetz“)
VWL | Volkswirtschaftslehre
Vorwort
Obgleich die Soziale Marktwirtschaft letztes Jahr ihren bereits 75-jährigen Geburtstag „feierte“, ist sie meines Erachtens hochaktuell.
Im Zuge der jüngeren Krisen sah sich nicht zuletzt die Wirtschaftspolitik gezwungen, kurzfristige Ad-hoc-Entscheidungen zu treffen. Dabei scheint der Blick auf die Konsistenz der Maßnahmen und ihre Vereinbarkeit mit einem ordnungspolitischen Konzept bisweilen verloren gegangen zu sein. Ähnliches könnte bei den langfristig wirkenden Maßnahmen eintreten, die zu ergreifen sind, um den Klimawandel auf ein erträgliches Maß abzubremsen.
Dabei steht meines Erachtens mit der Konzeption der Sozialen Marktwirtschaft ein geeignetes und anpassungsfähiges Leitbild zur Verfügung, das sowohl Orientierung für kurzfristig angelegte Maßnahmen als auch für die Langfristaufgabe der Transformation in eine nachhaltige Volkswirtschaft geben kann.
Ziel des Buches ist es, den Leser:innen rund 100 Seiten ein Grundverständnis für die Konzeption zu vermitteln. Dazu werden ihre theoretischen Grundlagen und ihre wirtschaftshistorischen Wurzeln erklärt. Außerdem wird die Weiterentwicklung der Konzeption zur sozial-ökologischen Marktwirtschaft thematisiert sowie verschiedene Umwälzungen skizziert, welche die deutsche Wirtschaftsordnung seit den 1990er-Jahren durchlaufen hat.
Mein außerordentlicher Dank gilt Carsten Kühl für wertvolle Anregungen. Meinem Sohn David Kulessa danke ich für das kritische Gegenlesen eines älteren Lehrbuchmanuskripts zu Mikroökonomie und Wettbewerb, auf dem der vorliegende Text basiert. Ebenso danke ich Maruan El-Mohammed und Wilhelm Spatz für ihre Unterstützung. Schließlich möchte ich mich bei meinem Lektor Rainer Berger für die sehr angenehme Zusammenarbeit bedanken. Verbliebene Fehler im Buch sind selbstverständlich mir anzulasten.
Ich hoffe auf Verständnis, dass ich aus Gründen der besseren Lesbarkeit auf einen geschlechtergerechten Sprachgebrauch verzichtet habe.
Mainz im April 2023
Margareta Kulessa
Inhalt und Lernziele
Die Wirtschaftsordnung der Bundesrepublik Deutschland basiert auf dem Leitbild der Sozialen Marktwirtschaft. Das Leitbild vereint die Leistungsfähigkeit des wettbewerblichen Marktmechanismus mit einer staatlichen Ordnungs- und Prozesspolitik, die Marktversagen beheben, weitere Funktionsprobleme des Markts mindern und für einen sozialen Ausgleich sorgen soll.
Dieses Buch hat zum Ziel, die Konzeption der Sozialen Marktwirtschaft zu erläutern und über ihren historischen Hintergrund sowie jüngere Entwicklungen zu informieren.
Der/die Leser:in sollte nach der Lektüre
theoretische und historische Hintergründe der Konzeption verstehen,
mit der Umsetzung der Konzeption vertraut sein
und die Marktkonformität wirtschaftspolitischer Eingriffe einschätzen können.
Das Buch ist viergeteilt. Im ersten Teil werden zunächst die Grundidee der Konzeption vorgestellt sowie ihre Ziele erläutert (→ Kap. 1). Anschließend werden die Stärken und Schwächen des Marktmechanismus im Hinblick auf die Erreichung dieser Ziele beleuchtet und es wird aufgezeigt, inwieweit daraus staatlicher Handlungsbedarf abgeleitet werden kann (→ Kap. 2–6). Es schließt sich eine Erläuterung der Prinzipien der Sozialen Marktwirtschaft an (→ Kap. 7–8). Im zweiten Teil folgt ein Überblick über den dogmenhistorischen Hintergrund der Sozialen Marktwirtschaft, der vom Merkantilismus bis zum Ordoliberalismus reicht (→ Kap. 9–13) und dazu beitragen soll, die Konzeption und ihre Besonderheiten besser zu verstehen. Im dritten Teil wird die Umsetzung der Konzeption in den Anfängen der Bundesrepublik Deutschland skizziert (→ Kap. 14–18). Im vierten Teil geht es um die Weiterentwicklung zur ökologisch-sozialen Marktwirtschaft und um Umwälzungen, welche die Soziale Marktwirtschaft seither durchlaufen hat (→ Kap. 19–20). Das Buch schließt mit einer knappen Zusammenfassung.
1Grundidee und Ziele
1.1Vorbemerkung
Die Konzeption der Sozialen Marktwirtschaft ist ca. 75 Jahre alt und gilt nach wie vor als das in der Bundesrepublik vorherrschende Leitbild für die Gestaltung der Volkswirtschaft. Zu ihren Grundlagen zählt die politisch-philosophische Überzeugung, dass allen Menschen unterschiedslos ein eigener Wert (Menschenwürde) zugeschrieben wird (Zimmer 2020, S. 87, Ruckriegel 2020, S. 200 ff.). Die MenschenwürdeMenschenwürde begründet die Menschenrechte, die allen Menschen zustehen. Aus den Menschenrechten ergeben sich zum einen Grenzen für den Markt, von denen nur eine z. B. das Verbot der Sklaverei und des Sklavenhandels ist. Zum anderen wird ein Teil der Sozialpolitik mit der Menschenwürde begründet: Im Sozialgesetzbuch (SGB) steht, dass es Aufgabe der Sozialhilfe sei „die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht“ (§ 1 Satz 1 SGB XII).
1.2Markt und staatlicher Ausgleich
„So viel Markt wie möglich, so viel Staat wie nötig“ (Eigner, 1963). Mit diesem abgewandelten Zitat von Karl Schiller1 (1911–1994) wird die Soziale MarktwirtschaftSoziale Marktwirtschaft oftmals charakterisiert. Die Bezeichnung „Soziale Marktwirtschaft“ stammt von dem Nationalökonomen und späteren Staatssekretär Alfred Müller-ArmackMüller-Armack, Alfred (1901–78) (Müller-Armack, 1947, S. 88). Außerdem geht die inhaltliche Entwicklung des Konzepts in ganz wesentlichen Teilen auf ihn zurück. (Müller-Armack, 1966) Damals erachteten etliche Kritiker den Begriff zunächst als geradezu paradox, denn die Entwicklungen der letzten 150 Jahre hätten gezeigt, dass der Markt höchst unsozial sei. Marktwirtschaft und Soziales schienen sich gegenseitig geradezu auszuschließen.
Die Soziale MarktwirtschaftSoziale Marktwirtschaftwirtschaftspolitische Konzeption ist zunächst eine wirtschaftspolitische Konzeptionwirtschaftspolitische Konzeption, d. h. ein theoretisch fundiertes Leitbild für die Gestaltung des Aufbaus und des Ablaufs einer Volkswirtschaft. Eine Konzeption umfasst Ziele und ordnungspolitische Prinzipien, daraus abgeleitete Regeln für ökonomische Aktivitäten des Staates sowie ggfs. konkrete Maßnahmen. Hinzu kommt i. d. R. eine Situationsanalyse.
Der Begriff der Sozialen Marktwirtschaft wird zugleich als Bezeichnung für die bundesdeutsche Wirtschaftsordnung verwendet (Hampe 2020, S, 138)Wirtschaftsordnung. Unter Wirtschaftsordnung ist die Summe der anzutreffenden Regeln zu verstehen, in die eine Volkswirtschaft in der Praxis eingebettet ist.
Die wirtschaftspolitische Konzeption der Sozialen Marktwirtschaft setzt zum einen auf den Wettbewerb als Koordinationsmechanismus für wirtschaftliche Aktivitäten und sieht Privateigentum an Produktionsmitteln vor. Zum anderen wird wirtschaftspolitisches Engagement des Staates als zwingend notwendig erachtet, um klassisches Marktversagen zu beheben, soziale Verteilungsungerechtigkeiten auszugleichen und für einen funktionierenden Wettbewerb zu sorgen. Außerdem soll eine Stabilitäts- und Wachstumspolitik darauf ausgelegt sein, Wohlstand zu fördern sowie hohe Arbeitslosigkeit und eine hohe oder stark schwankende Inflationsrate zu verhindern.
Die Aufzählung macht deutlich, dass die Formel „Markt und sozialer Ausgleich“ zur Umschreibung der Sozialen MarktwirtschaftSoziale Marktwirtschaft zu kurz greifen würde. Vielmehr sieht die Konzeption einen starken Staat vor, der nicht „nur“ Marktversagen und Marktverteilungsergebnisse korrigiert. Vielmehr erstreckt sich seine wirtschaftspolitische Aktivität auf die Wettbewerbspolitik und eine Vielzahl von anderen Bereichen wie etwa die gesamtwirtschaftlich ausgerichtete Stabilitäts- und Wachstumspolitik oder die Regionalpolitik.
1.3Ziele der Sozialen MarktwirtschaftSoziale MarktwirtschaftZiele
Die Aufgaben, die dem Markt und dem Staat in der Konzeption der Sozialen Marktwirtschaft zukommen, lassen sich aus den vier Zielen
Wohlstand,
Freiheit,
soziale Gerechtigkeit
und soziale Sicherheit
ableiten. Die Stärken des Marktes liegen in seinem Beitrag zu den Zielen Wohlstand und Freiheit, während der Staat gefordert ist, auch die Ziele der sozialen Gerechtigkeit und Sicherheit umzusetzen.
2Stärken des Marktes: Effizienz und formale Freiheit
2.1Allokationseffizienz
Der Markt – sprich die wettbewerbliche Selbststeuerung – wird als der grundsätzlich effizienteste wirtschaftliche Koordinationsmechanismus eingestuft. Er belohnt diejenigen Produzenten, die zu geringstmöglichen Kosten produzieren und die jene Güter herstellen, die mit den verfügbaren Ressourcen bei gegebenem Stand der Technik den höchsten Nutzen für die Nachfragenden stiften. Dies wird als AllokationseffizienzAllokation bezeichnet.
Der marktwirtschaftliche Wettbewerb hat nicht allein die Funktion, als Allokationsmechanismus zu dienen, sondern hinzu kommt die Innovationsfunktion. Der wettbewerbliche Konkurrenzkampf treibt nämlich permanent zu kostensparenden Verfahrensinnovationen und zu Produktinnovationen an, wodurch die Kosten fortdauernd sinken, verbesserte und neue Produkte entstehen, d. h. sich die Güterversorgung verbessert und der Wohlstand steigt.
Begriffe | AllokationAllokation
Allokation.
Allokation geht auf das Lateinische “locare“ bzw. „allocare“ zurück, was in etwa „einen Platz zuweisen“ bedeutet. In den Wirtschaftswissenschaften bezeichnet Allokation die Zuteilung von Produktionsfaktoren (Faktorallokation) und Gütern (Güterallokation) zu Verwendungen.
Faktorallokation.
Bei der FaktorallokationFaktorallokation geht es um die Frage, auf welche Branchen die Produktionsfaktoren in welchen Mengen verteilt werden und wie sie im Produktionsprozess eingesetzt und kombiniert werden. Eine Faktorallokation ist effizient, wenn mit den vorhandenen Produktionsfaktoren die größtmögliche Menge an Gütern erstellt wird. Alternativ wird dieser Zustand als Minimalkostenkombination bezeichnet.
Güterallokation.
Unter GüterallokationGüterallokation ist die Zuteilung der in einer Volkswirtschaft erstellten Güter auf die Wirtschaftssubjekte zu verstehen ebenso wie die Verteilung der Güter auf verschiedene Verwendungen. Die Güterallokation gibt somit Auskunft darüber, wie die Güter den Wirtschaftssubjekten (Haushalte und Unternehmen) zugeteilt werden bzw. in welche Verwendung (z. B. Konsum oder Investition) sie fließen.
Allokationsoptimum.
Das Allokationsoptimum bezeichnet den Zustand, in welchem bei gegebener Faktorausstattung der größte volkswirtschaftliche Nutzen gestiftet wird. Alternativ wird der Begriff des WohlfahrtsoptimumsWohlfahrtsoptimum verwendet.
2.2Freiheit
Es gehört zum Wesen der Marktwirtschaft, dass dem Individuum grundsätzlich die FreiheitFreiheit eingeräumt wird, jegliche wirtschaftliche Entscheidungen zu treffen und entsprechend zu handeln. Somit harmoniert die marktwirtschaftliche Ordnung mit der politischen Ordnung der liberalen Demokratie, in welcher die Freiheit des Einzelnen als eines der höchsten Güter gilt. Freiheit bedeutet, dass der Einzelne das Recht hat, sein Leben selbst zu gestalten. Er kann nach seinem Willen und in frei verantworteter, eigener Entscheidung nach seinen Zielen (z. B. Glück, Erfolg, Zufriedenheit, Reichtum) streben (Schlösser, 2007).
Jedoch sichert die Marktwirtschaft nur formale wirtschaftliche Freiheit im Sinne von „dürfen“, nicht aber automatisch auch materiale Freiheit im Sinne von „können“. Das heißt, dass der Markt zwar keine Ge- oder Verbote für wirtschaftliche Entscheidungen und Handlungen vorgibt. Aber ob das Individuum über die (materiellen) Voraussetzungen verfügt, Entscheidungen frei zu treffen und umzusetzen, ist eine andere Frage. Zum Beispiel darf in einer Marktwirtschaft jeder erwerbstätig sein und Erwerbseinkommen erzielen, aber nicht jeder ist dazu in der Lage (z. B. Kranke). Ebenso dürfen mittellose Menschen zwar alles kaufen, aber mangels Einkommen können sie ggfs. noch nicht einmal genug kaufen, um ihr Überleben zu sichern.
Das marktwirtschaftliche System mit seinem wettbewerblichen Koordinationsmechanismus ist darüber hinaus insoweit mit dem Freiheitsziel äußerst kompatibel, als MachtMacht grundsätzlich dezentralisiert ist. Dies gilt zuvorderst für die wirtschaftliche Macht und indirekt auch für die politische Macht von Unternehmen, die mit der wirtschaftlichen Größe und Bedeutung eines Unternehmens korreliert.
Allerdings sprechen empirische Befunde dafür, dass sich diese Freiheitsfunktion des Wettbewerbs weder von selbst einstellt, noch von selbst erhalten bleibt. Vielmehr kommt es in einer unregulierten Marktwirtschaft häufiger zur Vermachtung von MärktenVermachtung von Märkten. Dafür ursächlich ist nicht zuletzt die Neigung von Unternehmen, den – für sie unangenehmen – Wettbewerbsdruck ausschalten zu wollen. Hierfür eingesetzte Verhaltensweisen sind z. B. Kartelle und Syndikate, unfaire Verdrängungspraktiken und Fusionen.
3Schwächen des Marktes: Soziale Gerechtigkeit und Sicherheit
3.1VerteilungsgerechtigkeitVerteilungsgerechtigkeit
Soziale GerechtigkeitGerechtigkeit ist ein Ziel, über das es sehr unterschiedliche Vorstellungen und Theorien gibt. In Bezug auf die Verteilung von Einkommen auf die Haushalte (personelle Verteilung) existieren eine Reihe von Gerechtigkeitsnormen. Dazu zählen Leistungs-, Bedarfs- und Chancengerechtigkeit.
Begriffe | Gerechtigkeit
LeistungsgerechtigkeitLeistungsgerechtigkeit.