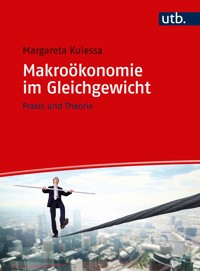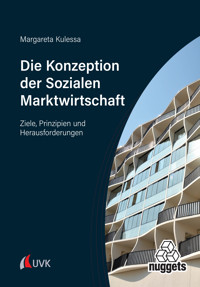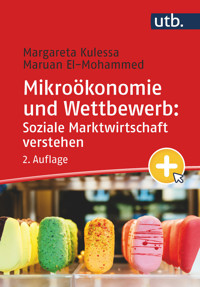
28,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: UTB
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Die Mikro verstehen und anwenden Wer die Funktionsweise von Märkten verstehen möchte, kommt an der Mikroökonomie nicht vorbei. Margareta Kulessa und Maruan El-Mohammed spannen in diesem interessanten Lehrbuch den Bogen zwischen Mikroökonomie, sozialer Marktwirtschaft und Wettbewerbspolitik. Zahlreiche Beispiele und Abbildungen illustrieren den Stoff. Die zweite Auflage wurde vollständig überarbeitet. Sie verfügt nun auch über einen eLearning-Kurs mit rund 50 Fragen, der dabei hilft, den Stoff zu festigen. Ideal für Studierende, die VWL im Nebenfach haben, insbesondere in den Studiengängen Betriebswirtschaftslehre oder Rechtswissenschaften. utb+: Begleitend zum Buch steht ein E-Learning-Kurs mit zahlreichen Single-Choice-Fragen zum Vertiefen des Wissens zur Verfügung. Erhältlich über utb.de.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Margareta Kulessa / Maruan El-Mohammed
Mikroökonomie und Wettbewerb: Soziale Marktwirtschaft verstehen
Mit eLearning-Kurs
Prof. Dr. Margareta Kulessa lehrt Volkswirtschaftslehre an der Hochschule Mainz.
Maruan El-Mohammed, M.Sc. ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Hochschule Mainz.
Umschlagabbildung: © AdrianHancu ∙ iStock
2., vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage 2025
1. Auflage 2021
DOI: https://doi.org/10.36198/9783838563770
© UVK Verlag 2025— Ein Unternehmen der Narr Francke Attempto Verlag GmbH + Co. KGDischingerweg 5 • D-72070 Tübingen
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Alle Informationen in diesem Buch wurden mit großer Sorgfalt erstellt. Fehler können dennoch nicht völlig ausgeschlossen werden. Weder Verlag noch Autor:innen oder Herausgeber:innen übernehmen deshalb eine Gewährleistung für die Korrektheit des Inhaltes und haften nicht für fehlerhafte Angaben und deren Folgen. Diese Publikation enthält gegebenenfalls Links zu externen Inhalten Dritter, auf die weder Verlag noch Autor:innen oder Herausgeber:innen Einfluss haben. Für die Inhalte der verlinkten Seiten sind stets die jeweiligen Anbieter oder Betreibenden der Seiten verantwortlich.
Internet: www.narr.deeMail: [email protected]
Einbandgestaltung: siegel konzeption | gestaltung
utb-Nr. 5702
ISBN 978-3-8252-6377-5 (Print)
ISBN 978-3-8463-6377-5 (ePub)
Inhalt
Vorwort zur 2. Auflage
Die 2. Auflage unseres Lehrbuchs hat uns erlaubt, vereinzelte Fehler und Ungenauigkeiten der 1. Auflage zu korrigieren, verschiedene Ausführungen zu präzisieren sowie die eine oder andere Angabe zu aktualisieren. Außerdem finden sich in der nun vorliegenden Auflage einige neue Absätze, etwa zur Problematik gesellschaftlicher Indifferenzkurven, zu den Herausforderungen an die Soziale Marktwirtschaft und zur 11. Novelle des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen.
Unser Dank gebührt erneut Ali Saif für die Überarbeitung von Abbildungen und für das gewissenhafte Korrekturlesen. Für die sehr hilfreiche Diskussion modelltheoretischer Zusammenhänge danken wir Agnes Sputek. Ebenso möchten wir uns bei Carsten Kühl für seine wertvollen Anregungen zum Teil B des Lehrbuchs bedanken. Schließlich gilt unser Dank unserem Lektor Rainer Berger für die unkomplizierte und freundliche Zusammenarbeit. Es versteht sich von selbst, dass alle – leider nie auszuschließenden – verbleibenden Fehler allein uns anzulasten sind.
Mainz, im April 2025
Margareta Kulessa und Maruan El-Mohammed
Vorwort zur 1. Auflage
„Mikroökonomie und Wettbewerb: Soziale Marktwirtschaft verstehen“ ist der Versuch, unsere Lehrveranstaltungen zur Mikroökonomie und zur Einführung in die Volkswirtschaftslehre an der Hochschule Mainz in ein Buch zu gießen. Es ist speziell für Bachelor-Studierende der Betriebswirtschaftslehre und des Wirtschaftsrechts gedacht, aber auch für Studierende nicht-wirtschaftswissenschaftlicher Disziplinen, die sich mit der Funktionsweise von Gütermärkten bzw. der Wirtschafts- und Wettbewerbsordnung der Bundesrepublik Deutschland vertraut machen möchten.
Das Buch beginnt mit einer Einführung, die zu lesen wir allen empfehlen, bevor sie sich den anschließenden drei Teilen zuwenden.
Teil A erklärt das neoklassische mikroökonomische Grundmodell der „vollständigen Konkurrenz“ und zeigt, dass ein freier Markt unter bestimmten Annahmen zum größtmöglichen Wohlstand führt.
Teil B erläutert die wirtschaftspolitische Konzeption der Sozialen Marktwirtschaft, welche Freiheit und größtmöglichen Wohlstand nur für möglich hält, wenn ein sozialpolitischer Ausgleich herbeigeführt wird und die Märkte durch einen wettbewerbs- und ordnungspolitischen Rahmen eingehegt werden.
Teil C hat die Theorie und Politik des Wettbewerbs zum Gegenstand, die sich vor langem von der neoklassischen Preistheorie emanzipiert haben. Sie befassen sich vorrangig mit der Frage, welche rechtliche Schranken den Unternehmen vorgegeben werden sollten, damit der Wettbewerb seine Funktionen entfalten und zu möglichst großem Wohlstand führen kann.
Grundsätzlich bedarf es zum Verständnis eines Teils nicht des Studiums eines anderen Teils. Wir haben uns mit anderen Worten bemüht, das Buch modular aufzubauen. Gleichwohl finden sich Querverweise im Text, sodass Interessierte die Zusammenhänge verfolgen können.
Für die Unterstützung bei der Erstellung dieses Lehrbuchs danken wir sehr herzlich Ali Saif und David Kulessa. Ali ist Student des Wirtschaftsrechts und gab uns viele wertvolle Hinweise, die in unsere Überarbeitung des Teils A eingeflossen sind. David ist Student der Publizistik und seine hilfreichen Anmerkungen zu Teil B dürften dessen Verständlichkeit spürbar erhöht haben. Außerdem danken wir unserem Lektor Rainer Berger dafür, dass er uns motiviert, mit viel Geduld begleitet und den (kritischen) Überblick behalten hat. Alle im Buch verbliebenen Fehler sind selbstverständlich uns anzulasten.
Wir danken außerdem unseren Familien, die uns stets bestärkt und unterstützt haben, obwohl wir sie während des Entstehens dieses Lehrbuchs gewiss vernachlässigt haben.
Abschließend hoffen wir auf Verständnis, dass wir aus Gründen der besseren Lesbarkeit auf einen geschlechtergerechten Sprachgebrauch („gendern“) in weiten Teilen verzichtet haben. Wir verwenden ausschließlich die männliche Form immer dann, wenn es um Anbieter, Nachfrager, Produzenten und Konsumenten geht.
Mainz im Juli 2021
Margareta Kulessa und Maruan El-Mohammed
Abkürzungen
Abb. | Abbildung
AEUV | Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union
BD | Blu-ray Disc
BIP | Bruttoinlandsprodukt
BKartA | Bundeskartellamt
BNetzA | Bundesnetzagentur
BWL | Betriebswirtschaftslehre
CDU | Christlich Demokratische Union Deutschlands
c. p. | ceteris paribus
CSU | Christlich-Soziale Union in Bayern
DDR | Deutsche Demokratische Republik
DK | Durchschnittskosten
DVD | Digital Versatile (Video) Disc
EU | Europäische Union
EuGH | Europäischer Gerichtshof
F&E | Forschung und Entwicklung
FDP | Freie Demokratische Partei
Fkt. | Funktion
FKVO | EU-Fusionskontrollverordnung
GG | Grundgesetz
GRS | Grenzrate der Substitution
GRT | technische Grenzrate der Transformation
GVO | Gruppenfreistellungsverordnungen
GWB | Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen
HHI | Herfindahl-Hirschman-Index
Pkt. | Punkt
PMK | Produktionsmöglichkeitenkurve
RS | Rate der Substitution
SGB | Sozialgesetzbuch
SIEC | Significant Impediment to Effective Competition
SPD | Sozialdemokratische Partei Deutschlands
SSNIP | Small But Significant Non-Transitory Increase In Price
Std. | Stunden
SVE | Struktur-Verhaltens-Ergebnis
UWG | Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb
VWL | Volkswirtschaftslehre
Einführung | Begriffliche Grundlagen und Wirtschaftssysteme
eLearning-Kurs | Zu diesem Kapitel werden Single- und Multiple-Choice-Fragen angeboten. Der folgende Link oder der QR-Code führen Sie zu den Fragen.
🔗https://narr.kwaest.io/s/1326
1Begriffe und Abgrenzungen
1.1Volkswirtschaftslehre
Die VolkswirtschaftslehreVolkswirtschaftslehre befasst sich mit der Darstellung, Erklärung und Untersuchung wirtschaftlicher Zusammenhänge. Sie wird auch als Nationalökonomie bezeichnet.
WirtschaftenWirtschaften ist der Umgang mit knappen Mitteln zur Erfüllung von Bedürfnissen. Ziel menschlichen Wirtschaftens ist es, das Spannungsverhältnis zwischen begrenzt verfügbaren Gütern und unbegrenzten Bedürfnissen zu verringern.
GüterGüter sind Mittel, die zur Befriedigung menschlicher Bedürfnisse geeignet sind. Man unterscheidet zwischen knappen und freien Gütern, wobei nur erstgenannte der Bewirtschaftung bedürfen, da zweitgenannte per definitionem im Überfluss vorhanden sind. Beispiele für die relativ seltenen freien Güter sind Sand in der Wüste und Salzwasser auf dem Meer. Luft ist hingegen ein Gut, das in früherer Zeit zwar oftmals als Beispiel für ein freies Gut angeführt wurde. Aber heutzutage konkurrieren vielerorts verschiedene Akteure wie z. B. die Luftschadstoffe emittierende Industrie, die Autofahrer und die atmenden Menschen bei der Nutzung des nunmehr knappen Gutes „saubere Luft“.
Effektives Wirtschaften orientiert sich am ökonomischen Prinzipökonomisches Prinzip, d. h. das Verhältnis von Bedürfnisbefriedigung zum Mitteleinsatz soll so groß wie möglich sein. Das Prinzip lässt sich entweder als Maximalprinzip (maximale Zielerreichung mit gegebenen Mitteln erreichen) oder als Minimalprinzip (gegebenes Ziel mit minimalen Mitteln erreichen) operationalisieren. Ein Beispiel aus dem Fitnessbereich wäre, entweder einen höchstmöglichen Muskelanteil mit 4 Std. wöchentlichen Trainings aufzubauen (Maximalprinzip) oder einen bestimmten Muskelanteil mit möglichst wenigen Trainingsstunden zu erzielen (Minimalprinzip).
Bei der VolkswirtschaftslehreVolkswirtschaftslehre (VWL) steht im Unterschied zur Betriebswirtschaftslehre (BWL) nicht die Perspektive eines einzelnen Unternehmens im Mittelpunkt, sondern die VWL betrachtet Märkte von außen. Gelegentlich wird dies so umschrieben, dass die BWL die Froschperspektive einnimmt, während die VWL das wirtschaftliche Geschehen aus der Vogelperspektive betrachtet.
Ein MarktMarkt ist der analytische Ort des Zusammentreffens von Angebot und Nachfrage. Beispiele sind Märkte für Waren, Dienstleistungen, Produktionsfaktoren (Arbeit, Realkapital, Boden) oder Geld. Der Begriff des Orts ist hier nicht im physischen, sondern im abstrakten Sinne gemeint. Freilich existieren Märkte, die tatsächlich an einem geografischen Ort stattfinden, so etwa Floh- und Wochenmärkte. Die meisten Märkte sind jedoch durch geografisch gestreute Anbieter und Nachfrager charakterisiert. Auf virtuellen Märkten findet der Tausch der Leistung an gar keinem geografischen Ort statt; Beispiele sind Online-Finanzdienstleistungen und Datingportale.
Die Volkswirtschaftslehre gliedert sich in die WirtschaftstheorieWirtschaftstheorie und die Wirtschaftspolitik. Die Wirtschaftstheorie versucht, wirtschaftliche Zusammenhänge zu erklären. Beispielsweise widmet sie sich der Frage, welche Wirkungen von einem Preisanstieg für Tabak ausgehen. Somit geht es um die Herleitung von Ursache-Wirkungs-Zusammenhängen. Idealerweise ist die Wirtschaftstheorie werturteilsfrei, weswegen sie auch zur positiven Theorie gezählt wird.
Die Wirtschaftspolitik geht hingegen von einem Ziel (einer Norm) aus und fragt, ob und wie sich dieses Ziel erreichen lässt. Entsprechend gilt sie als normative Theorie. Die Wirtschaftspolitik bedient sich der Kausalaussagen der Wirtschaftstheorie, um Mittel für die Zielerreichung zu identifizieren. Wenn zum Beispiel die Wirtschaftstheorie zeigt, dass ein Anstieg des Tabakpreises zu einem Rückgang des Tabakkonsums führt, dann ergibt sich der wirtschaftspolitische Schluss: Wenn ein Rückgang des Tabakkonsums angestrebt wird, lässt sich dieser durch eine Verteuerung von Tabak erreichen.
Eine gängige Einteilung der VolkswirtschaftslehreVolkswirtschaftslehre und insbesondere der Wirtschaftstheorie ist die in MikroökonomieMikroökonomie und MakroökonomieMakroökonomie. Der wesentliche Unterschied zwischen beiden ist das Aggregationsniveau. In der Mikroökonomie geht es typischerweise um die Analyse eines Marktes für ein Gut wie z. B. Eiskrem. Demgegenüber geht es in der Makroökonomie um die gesamte Volkswirtschaft. Es werden gesamtwirtschaftliche Märkte betrachtet. Ein Beispiel ist der gesamtwirtschaftliche Gütermarkt, auf dem die Nachfrage nach allen Gütern der privaten Haushalte, Unternehmen, des Staates und des Auslandes auf das Güterangebot aller einheimischen Produzenten trifft.
1.2Volkswirtschaft
Eine VolkswirtschaftVolkswirtschaft ist die Summe aller Einzelwirtschaften in einem abgegrenzten Raum. Beispiele für eine Volkswirtschaft sind Deutschland, China und die USA. Der Begriff der Volkswirtschaft ist indes nicht einzig für Staaten reserviert, sondern wird auch für größere Einheiten (z. B. Eurozone oder Europäische Union) und für kleinere Einheiten (z. B. Bayern, Texas) verwendet. Dabei gibt es keine einheitlichen Kriterien dafür, wann von einer Volkswirtschaft, einer Regional- oder von einer Lokalwirtschaft gesprochen wird. Vielmehr erfolgt dies teils „intuitiv“. Beispielsweise erscheint es plausibel, über Grönland als Volkswirtschaft zu sprechen, aber kaum jemand würde Köln als Volkswirtschaft bezeichnen – obwohl Kölns Wertschöpfung und Bevölkerungszahl ein Vielfaches betragen.
Die EinzelwirtschaftenEinzelwirtschaft in einer Volkswirtschaft sind die privaten Haushalte, die Unternehmen und der Staat. Die Abgrenzung von Einzelwirtschaften erfolgt nach funktionalen und nicht nach personellen Gesichtspunkten. Zum Beispiel ist der private Haushalt dadurch definiert, dass er konsumiert und Produktionsfaktoren für den Produktionsprozess zur Verfügung stellt; ein Unternehmen ist aufgrund seiner Funktionen des Produzierens, Investierens und der Nachfrage nach Produktionsfaktoren als solches definiert. Anstelle von Einzelwirtschaften wird auch von Wirtschaftssubjekten gesprochen. Ein WirtschaftssubjektWirtschaftssubjekt ist die kleinste Wirtschaftseinheit, die selbständig wirtschaftliche Pläne aufstellt und ökonomische Entscheidungen trifft. Wirtschaftssubjekte können natürliche oder juristische Personen sein. Sie können aus einer Person (z. B. Singlehaushalt) oder mehreren Personen (z. B. Familie, Mehrpersonenunternehmen) bestehen.
2Das gesellschaftliche Allokationsoptimum (Wohlfahrtsoptimum)
Ausgangspunkt ist eine Volkswirtschaft mit gegebenen Ressourcen. Aus ökonomischer Sicht sollte nun derart gewirtschaftet werden, dass mit gegebenem Input der maximale Output realisiert wird (Maximalprinzip). Die ProduktionsfaktorenProduktionsfaktoren (z. B. Arbeit, Sach- und Naturkapital) stellen den InputInput dar. Der für die Menschen letztlich relevante OutputOutput ist der Nutzen, der aus den erstellten Gütern erwächst. Unter Nutzen wird in der VWL so etwas wie das Wohlergehen bzw. die Zufriedenheit verstanden. Üblicherweise wird unterstellt, dass der Nutzen eines Individuums steigt, wenn sein Konsum um eine Gütereinheit – bei ansonsten unveränderten Bedingungen – zunimmt. Außerdem wird angenommen, dass der Mehrkonsum einer Einheit eines Gutes einen umso geringeren Nutzenzuwachs stiftet, je höher der Konsum dieses Gutes bereits ist (→ Teil A | Kap. 3.1). Da hier eine gesamte Volkswirtschaft und somit eine Gesellschaft betrachtet wird, geht es indes nicht um die Maximierung des Nutzens eines Einzelnen, sondern um eine Maximierung des gesellschaftlichen Nutzens. Der gesellschaftliche Nutzen wird auch als WohlfahrtWohlfahrtbezeichnet. Ziel sollte es also sein, die verfügbaren Produktionsfaktoren so einzusetzen, dass eine höchstmögliche Wohlfahrt erreicht wird.
Die Art und Weise, auf welche Ressourcen und Güter einer Verwendung zugeführt werden, wird AllokationAllokation genannt. Allokation ist eines der wenigen Fremdwörter, auf die in der Volkswirtschaftslehre nur schwer verzichtet werden kann. Allokation geht auf das Lateinische locare bzw. allocare zurück, was in etwa „einen Platz zuweisen“ bedeutet. Es gibt zum einen die „Platzierung“ von Produktionsfaktoren (Faktorallokation) und zum anderen von Gütern (Güterallokation). Dabei kann die Allokation auf unterschiedlichen Wegen erfolgen, etwa im Zuge einer Zuweisung durch eine Person/Organisation oder z. B. auf rein marktwirtschaftliche Weise, sprich durch den Marktpreismechanismus.
Bei der FaktorallokationFaktorallokation geht es um die Frage, auf welche Unternehmen bzw. Branchen die vorhandenen Produktionsfaktoren wie Arbeit und Kapital in welchen Mengen aufgeteilt werden und wie sie im Produktionsprozess eingesetzt und kombiniert werden. Eine Faktorallokation ist effizient, wenn mit den verfügbaren Produktionsfaktoren die größtmögliche Menge an Gütern erstellt wird, also keine Verschwendung stattfindet.
Unter GüterallokationGüterallokation wird hier die „Zuteilung“ der produzierten Güter auf die Konsumenten verstanden. Die Güterallokation einer gegebenen Menge an knappen Gütern ist effizient, wenn sich der durch sie gestiftete Nutzen nicht mehr steigern lässt.
Ein AllokationsoptimumAllokationsoptimum einer Volkswirtschaft bezeichnet entsprechend einen Zustand, in welchem die gesamtwirtschaftliche Allokation der Faktoren und Güter effizient ist. Solch ein gesellschaftliches Allokationsoptimum wird häufig auch als WohlfahrtsoptimumWohlfahrtsoptimum bezeichnet (seltener: Wohlstandsoptimum).
Das Allokationsoptimum
In → Abb. 1 ist solch ein gesellschaftliches AllokationsoptimumAllokationsoptimum grafisch dargestellt. Dabei wird angenommen, dass in der Volkswirtschaft nur zwei Güter bzw. Güterbündel produziert werden können. Die Menge des einen Gutes () ist auf der Abszisse abgetragen und die Menge des anderen Gutes () auf der Ordinate. Darüber hinaus werden weitere, teils äußerst restriktive Annahmen getroffen. Es wird an dieser Stelle jedoch nicht auf alle Annahmen eingegangen, da es hier nicht um die Herleitung der Graphen geht, sondern die Abbildung lediglich als didaktisches Mittel zur Veranschaulichung verwendet wird.
Die ProduktionsmöglichkeitenkurveProduktionsmöglichkeitenkurve (PMK) umschließt die Fläche aller Kombinationen von und , die mit den verfügbaren Ressourcen produziert werden können. Sie wird auch als TransformationskurveTransformationskurve bezeichnet. Alle Güterkombinationen, die auf der PMK liegen, verkörpern eine effiziente Faktorallokation. Es kann z. B. nur das Gut (Pkt. ), nur das Gut (Pkt. ) oder eine Kombination aus beiden Gütern (z. B. Pkt. , oder ) produziert werden. Alle Punkte unterhalb der PMK repräsentieren eine ineffiziente Produktion, denn mit den gegebenen Ressourcen könnten mehr Einheiten des einen Gutes produziert werden, ohne die Produktion des anderen Gutes reduzieren zu müssen. Güterkombinationen oberhalb der PMK wie z. B. sind indes mit den verfügbaren Ressourcen nicht realisierbar.
In → Abb. 1 ist außer der PMK eine Schar von Kurven eingezeichnet, die sich den Achsen asymptotisch annähern. Diese Kurven werden als Indifferenzkurven bezeichnet. Eine IndifferenzkurveIndifferenzkurve ist der geometrische Ort aller Güterkombinationen, deren Konsum den gleichen Nutzen generiert. Der zum Ursprung konvexe Verlauf der Indifferenzkurven resultiert aus der Annahme, dass der zusätzliche Nutzen, den eine weitere Einheit eines Gutes stiftet, umso geringer ist, je mehr von diesem Gut bereits konsumiert wird. Folglich bleibt das Nutzenniveau nur dann konstant, wenn bei steigendem Konsum des einen Gutes () der Rückgang im Konsum des anderen Gutes () immer kleiner wird. Je weiter weg eine Indifferenzkurve vom Ursprung des Koordinatenkreuzes entfernt ist, desto höher ist das Nutzenniveau. Das liegt an der Annahme, dass der Nutzen mit zunehmendem Güterkonsum steigt. Jeder Punkt rechts oder oberhalb einer Indifferenzkurve impliziert ein Mehr des einen Gutes, ohne dass die konsumierte Menge des anderen Gutes weniger wird. Ergo repräsentiert eine Indifferenzkurve ein umso höheres Nutzenniveau, je weiter sie vom Ursprung entfernt liegt. Die Annahme des steigenden Nutzens bei zunehmendem Konsum erklärt auch, warum sich Indifferenzkurven nicht schneiden. Es muss unterschieden werden zwischen individuellen Indifferenzkurven und gesellschaftlichen Indifferenzkurven (auch soziale Indifferenzkurven genannt). Das dargestellte System gesellschaftlicher Indifferenzkurven gilt im Wesentlichen nur, wenn von einer vorgegebenen Einkommensverteilung ausgegangen wird.
Mit diesen Einschränkungen lässt sich das gesellschaftliche Allokationsoptimum in → Abb. 1 zeichnerisch bestimmen. Es liegt im Punkt , dem Tangentialpunkt von PMK und Indifferenzkurve . In ist ein Zustand erreicht, in dem bei gegebener Ausgangsverteilung die größtmögliche Wohlfahrt generiert wird. Das heißt, dass es die Begrenztheit der verfügbaren Ressourcen nicht zulässt, dass allein durch eine Umstrukturierung der Produktion eine höher gelegene Indifferenzkurve erreicht wird. Es ist indes zu beachten, dass dies nur eines von vielen denkbaren Optima darstellt, da es im Wesentlichen nur für eine bestimmte Ausgangsverteilung gilt. Als nächstes soll behandelt werden, wie wahrscheinlich es ist, dass ein Wirtschaftssystem in solch ein Wohlfahrtsoptimum gelangt.
➲ Die Verläufe der Produktionsmöglichkeitenkurven und der individuellen Indifferenzkurven sowie die sich dahinter verbergenden Annahmen werden in Teil A dieses Lehrbuchs hergeleitet (→ Kap. 3.2 u. 4.2).
Exkurs | Zur Problematik gesellschaftlicher Indifferenzkurven
Indifferenzkurven sind ein weithin akzeptiertes Instrument, um den Nutzen eines Individuums in Abhängigkeit seines Konsums zweier Güter(-bündel) abzubilden (→ Teil A | Kap. 3.2). In → Abb. 1 finden sich jedoch keine individuellen, sondern sog. gesellschaftliche Indifferenzkurven (auch soziale Indifferenzkurven genannt). Somit wird hier unterstellt, dass sich jeder Güterkombination ein eindeutiges Niveau gesellschaftlicher Wohlfahrt zuordnen lässt. Das ist zugegebenermaßen eine sehr gewagte Annahme, da u. a. so getan wird, als sei die Verteilung der durch einen Punkt dargestellten Güterkombination auf die einzelnen Gesellschaftsmitglieder irrelevant für das Wohlfahrtsniveau. Das ist jedoch kaum vorstellbar: Angenommen, es gäbe vereinfacht nur zwei Gesellschaftsmitglieder (W und M) und es würde ein Punkt auf einer Indifferenzkurve betrachtet. Dieser Punkt stellt bestimmte Mengen von Gut und Gut dar, von denen sowohl M als auch W einen Teil konsumieren. Dann impliziert solch eine gesellschaftliche Indifferenzkurve, dass es für den Nutzen der Gesellschaft völlig unerheblich sei, wenn W bspw. eine gewisse Menge von genommen und diese an M gegeben wird.
Erstens wäre das ethisch höchst fragwürdig, da das Wohlergehen bzw. „Schlechtergehen“ zweier Personen gegeneinander aufgerechnet würde (Problematik des interpersonellen Nutzenvergleichs).
Zweitens erfordert solch ein Aufrechnen, dass der individuelle Nutzen kardinal messbar ist. Das bedeutet, dass jedes Individuum seinen Nutzen konkret und numerisch beziffern kann. Diese Prämisse war bis vor knapp 100 Jahren zwar üblich, jedoch wird inzwischen von der plausibleren Annahme ausgegangen, dass das Individuum nur einschätzen kann, ob der Nutzen durch den Konsum einer Güterkombination gegenüber einer anderen Kombination höher, geringer oder gleich ist (ordinale Nutzenmessung). Sind die individuellen Präferenzen lediglich ordinal skaliert, lässt sich auf demokratischem Wege wiederum keine eindeutige und konsistente gesellschaftliche Präferenzordnung und somit Wohlfahrtsfunktion herleiten (sog. Arrow-Unmöglichkeitstheorem).
Drittens steht das dargestellte System gesellschaftlicher Indifferenzkurven auch bei kardinaler Nutzenmessung sowie der Durchführung eines interpersonellen Nutzenvergleichs im Widerspruch zu dem angenommenen, gut begründeten Verlauf individueller Indifferenzkurven: Je mehr M von einem Gut konsumiert, umso kleiner ist sein Nutzenzuwachs durch eine zusätzliche Einheit dieses Gutes. Je weniger W des Gutes konsumiert, umso höher ist ihr Nutzenrückgang, wenn ihr zwecks Umverteilung eine Einheit dieses Gutes weggenommen wird. Folglich kann eine bestimmte Güterkombination nicht unabhängig von der Güterverteilung stets das gleiche gesellschaftliche Nutzenniveau erzeugen.* Ein Punkt auf der Indifferenzkurve kann somit je nach Verteilung der Mengen auf die Individuen unterschiedlichste Wohlfahrtsniveaus generieren.
Alles in allem gilt eine Schar von gesellschaftlichen Indifferenzkurven somit nur für eine bestimmte Ausgangsverteilung auf die Individuen.
* Streng genommen lässt sich unter äußerst irrealen Annahmen über die Präferenzen und Nutzenverläufe der Individuen doch eine verteilungsunabhängige gesellschaftliche Indifferenzkurve konstruieren. Dies weiter zu erläutern, führt hier jedoch zu weit.
3Wirtschaftssysteme
Ein WirtschaftssystemWirtschaftssystem ist ein Idealtyp für den organisatorischen Aufbau und Ablauf einer Volkswirtschaft. Wirtschaftssysteme können anhand verschiedener Variablen kategorisiert werden. Die wichtigsten Variablen sind der wirtschaftliche Koordinationsmechanismus (Allokationsmechanismus) und die Eigentumsordnung an Produktionsmitteln.
3.1Koordinationsmechanismus
In jeder Volkswirtschaft muss geklärt werden, auf welche Art und Weise die Produktionsfaktoren und Güter allokiert werden. Grundsätzlich kann die Allokation zentral geplant oder dezentral – d. h. über den Marktmechanismus – erfolgen. Es ergibt sich entsprechend eine planwirtschaftliche oder marktwirtschaftliche Allokation. Werden die einzelwirtschaftlichen Pläne dezentral über den wettbewerblichen Marktmechanismus koordiniert, spricht man von einer MarktwirtschaftMarktwirtschaft. Bei zentraler Koordination und Planung spricht man von einer PlanwirtschaftPlanwirtschaft oder ZentralverwaltungswirtschaftZentralverwaltungswirtschaft. Während in einer Marktwirtschaft die Bildung der Güterpreise und der Entgelte für Produktionsfaktoren (Löhne, Zinsen, Pachten etc.) dem dezentralen Marktmechanismus überlassen wird, werden die Preise – sofern es sie gibt – in einer Planwirtschaft zentral festgelegt.
3.2Eigentum an Produktionsmitteln
Des Weiteren bedarf es in jeder Volkswirtschaft eines Mechanismus zur Distribution des Einkommens, das im Zuge des Produktionsprozesses generiert wird. Unter DistributionDistribution ist die Verteilung der Einkommen auf die Wirtschaftssubjekte (personelle Einkommensverteilung) oder auf die Produktionsfaktoren (funktionale Einkommensverteilung) gemeint.
Bei der personellen EinkommensverteilungEinkommensverteilung wird zwischen der primären und sekundären Einkommensverteilung unterschieden. Die primäre Einkommensverteilung ergibt sich aus der direkten Entlohnung der Arbeit und des im Wirtschaftsprozess eingesetzten Vermögens. Durch die Subtraktion der direkten Steuern (z. B. Einkommensteuer) und die Addition von Transfers (z. B. Kindergeld, Sozialhilfe, BAföG) gelangt man vom Primäreinkommen zum Sekundäreinkommen.
Die Primärverteilung der Einkommen wird ganz wesentlich davon bestimmt, in wessen Eigentum sich die Produktionsfaktoren befinden und wie sie verteilt sind. Der Produktionsfaktor Arbeit ist untrennbar mit dem Menschen verbunden und ist in aller Regel quasi sein „Eigentum“, dessen Erträge ihm zufließen. Die Ausstattung der Haushalte mit dem Produktionsfaktor Arbeit ist eine mehr oder weniger demografisch vorgegebene Größe, die sich politisch nur schwer beeinflussen lässt. Somit ist es vor allem die Ordnung des Eigentums an Kapital und Boden, die variabel gestaltet werden kann. Dabei kann grundsätzlich zwischen privatem und gemeinschaftlichem Eigentum an den Produktionsmitteln unterschieden werden. Im Falle privaten Eigentums an Produktionsmitteln wird von einer kapitalistischen EigentumsordnungEigentumsordnung gesprochen. Demgegenüber gehören die Produktionsmittel in einer sozialistischen Eigentumsordnung der Gemeinschaft bzw. dem Staat.
3.3Übersicht
Je nachdem, welcher Koordinationsmechanismus die Ressourcenallokation steuert und welche EigentumsordnungEigentumsordnung an Produktionsmitteln herrscht, lassen sich vier verschiedene Wirtschaftssysteme ableiten. Diese können der → Abb. 2 entnommen werden.
Wirtschaftssysteme
WirtschaftssystemeWirtschaftssystem sind Idealtypen, die in der Realität nicht eins zu eins umsetzbar sind. Vielmehr handelt es sich in der Praxis stets um Mischsysteme. Daher werden die existierenden Volkswirtschaften einem jeweiligen Wirtschaftssystem danach zugeordnet, welches Prinzip jeweils dominiert.
In Deutschland dominiert z. B. der Wettbewerbsmechanismus den Allokationsprozess und die Produktionsmittel sind mehrheitlich in privater Hand. Somit ist das deutsche Wirtschaftssystem eine kapitalistische MarktwirtschaftMarktwirtschaftkapitalistischkapitalistische Marktwirtschaft.
Historische Beispiele für sozialistische PlanwirtschaftPlanwirtschaftsozialistischeen sind die DDR, die Sowjetunion und andere damalige „Ostblockstaaten“. Zu den verbliebenen Planwirtschaften mit Gemeineigentum an Produktionsmitteln zählen Nordkorea und Kuba. Das heutige Venezuela wird ebenfalls als Beispiel angeführt.
Kapitalistische PlanwirtschaftenPlanwirtschaftkapitalistische Planwirtschaft sind durch private Produktionsmittel und eine zentrale Koordination wirtschaftlicher Aktivitäten gekennzeichnet. Sie sind relativ häufig in Kriegs- oder anderen schweren Krisenzeiten anzutreffen sowie in Phasen der Kriegsvorbereitung. Beispiele sind das Deutsche Reich während des Ersten Weltkriegs sowie das nationalsozialistische Deutschland in den 1930/1940er-Jahren. Es gibt allerdings auch in „Friedenszeiten“ vor allem politisch autoritäre Staaten, in denen sich das Kapital zwar mehrheitlich in Privatbesitz befindet, aber der Staat derart dirigistisch in den wirtschaftlichen Ablauf eingreift, dass die Kategorisierung als Planwirtschaft der Realität näherkommt als die Kategorisierung als Marktwirtschaft.
Ein historisches Beispiel für eine sozialistische MarktwirtschaftMarktwirtschaftsozialistischesozialistische Marktwirtschaft ist das ehemalige Jugoslawien. Die größeren Unternehmen wurden mehrheitlich von den Arbeitnehmern selbst verwaltet bzw. waren Genossenschaften. Zugleich konkurrierten die einzelnen Unternehmen auf den Absatz- und Beschaffungsmärkten. Das heutige China nimmt ebenfalls für sich in Anspruch, eine sozialistische Marktwirtschaft zu sein. Allerdings ist die chinesische Volkswirtschaft ein Beispiel dafür, dass sich eine reale Wirtschaftsordnung nicht immer eindeutig einem der vier Wirtschaftssysteme zuordnen lässt. Je nach den Größen, mit denen man misst, welcher Koordinationsmechanismus bzw. welche Eigentumsordnung dominiert, gelangt man zu einer anderen Kategorisierung.
Die Klassifizierung von Wirtschaftssystemen erschöpft sich keineswegs in der hier vorgenommenen Vierteilung. Vielmehr lassen sich der Koordinationsmechanismus und die Eigentumsordnung weiter unterteilen, z. B. in dezentral, interventionistisch und dirigistisch bzw. in privat, selbstverwaltet und staatlich. Außerdem gibt es neben der Koordinations- und Eigentumsform noch andere Klassifikationskriterien, z. B. gesellschaftliche Strukturen oder die Wirtschaftsstufe.
3.4Allokationseffizienz in Markt- und Planwirtschaft
In diesem Kapitel geht es um die Frage, wie in einem marktwirtschaftlichen bzw. in einem planwirtschaftlichen System das Wohlfahrtsoptimum idealerweise erreicht wird. Anders formuliert: Wie gelangt die Volkswirtschaft in den Punkt (→ Abb. 1)? Diese Frage lässt sich zu analytischen Zwecken zweiteilen:
Wie lässt sich sicherstellen, dass kostenminimal produziert wird, d. h. entlang der Produktionsmöglichkeitenkurve?
Wie lässt sich sicherstellen, dass bei kostenminimaler Produktion die Güterkombination realisiert wird, die den Konsumentenpräferenzen entspricht und die folglich das höchstmögliche Wohlfahrtsniveau generiert?
Zentrale Allokation
In einer PlanwirtschaftPlanwirtschaft bedarf es zur Faktor- und Güterallokation einer zentralen Stelle, z. B. eines Planungskomitees. Zur Vereinfachung wird hier indes von einer Einzelperson ausgegangen, die als „wohlwollender Diktator“ agiert. Das heißt, sie verfolgt keine eigenen Ziele, sondern orientiert ihr Handeln einzig am Ziel des Gemeinwohls.
Der Diktator teilt den Produzenten die Ressourcen zu und bestimmt, welche Güter in welchen Mengen produziert werden (Planvorgaben). Um sicher zu gehen, dass effizient produziert wird, muss er die Produktionsmöglichkeiten kennen, die u. a. von der Produktionstechnologie und der Produktivität der Arbeitskräfte abhängen. Ein Problem besteht in der Praxis darin, dass er beides nicht kennt. Vielmehr ist er darauf angewiesen, dass die Produzenten ihm wahrheitsgemäß darüber Auskunft geben. Ein weiteres Problem besteht darin, die Produzenten dazu zu bewegen, die vorgegebenen Mengen tatsächlich auch herzustellen (Planerfüllung). In den real existierenden Planwirtschaften versuchte man beide Probleme dadurch zu lösen, dass eine Nichterfüllung der Pläne bestraft und eine Übererfüllung belohnt wurde, etwa mit Prämien oder Auszeichnungen. So hoffte man, die Unternehmen zur größtmöglichen Wirtschaftlichkeit zu animieren und aus den Ergebnissen wiederum Schlüsse über das Machbare, also die Produktionsmöglichkeiten ziehen zu können. Allerdings vergrößern diese Belohnungen wiederum die Gefahr, dass die Produzenten ihre Produktionsmöglichkeiten absichtlich als viel zu gering angeben. Dann erhalten sie niedrige Planvorgaben und können diese vergleichsweise leicht übererfüllen und die Belohnungen beanspruchen. Wenn es dem wohlwollenden Diktator aber doch gelingen sollte, dass die maximal möglichen Mengen hergestellt werden, dann hat dies den Nachteil, dass andere, insbesondere schwer messbare Parameter wie z. B. Produktqualität und Service auf der Strecke bleiben. In dem Zusammenhang wird auch von Tonnenideologie gesprochen. Außerdem wird das planwirtschaftliche System dafür kritisiert, dass der zentrale Planungsprozess zu einer erheblichen Inflexibilität der Produktion führt. Schließlich existieren in dem System vergleichsweise geringe Innovationsanreize, da die Unternehmen kaum im Preis- oder Qualitätswettbewerb stehen.
All dessen ungeachtet sei im Weiteren angenommen, dass der wohlwollende Diktator sicherstellen könne, dass effizient produziert wird. Dann muss er immer noch entscheiden, welche der kostenminimal produzierten Güterkombinationen den höchsten gesellschaftlichen Nutzen stiftet. Dazu benötigt er detaillierte Kenntnisse über die Präferenzen der Verbraucher, d. h. welchen Nutzen sie aus dem Konsum der unzähligen Güterkombinationen ziehen. Dies könnte er theoretisch über Haushaltsbefragungen in Erfahrung bringen. Jedoch wäre der Aufwand enorm, und die Befragten wären mit hoher Wahrscheinlichkeit überfordert. Davon abgesehen divergiert der empfundene Nutzen des Konsums eines Güterbündels von Person zu Person. Daher müsste der wohlwollende Diktator die Güter an diejenigen zuteilen, die den größten Nutzen daraus ziehen. Das wiederum wirft enorme Probleme auf: Zum einen bedarf es dazu metrischer und vergleichbarer Nutzenangaben der Individuen. Zum anderen bedeutet dieses Vorgehen, dass der wohlwollende Diktator den Nutzen unterschiedlicher Individuen miteinander vergleicht. Solch ein interpersoneller NutzenvergleichNutzenvergleichinterpersoneller ist indes ethisch umstritten. Letztlich muss der wohlwollende Diktator eine Ausgangsverteilung zwischen den Individuen festlegen, die er als „optimal“ bezeichnet. Kurzum: Es ist dem Diktator in der Praxis schlichtweg unmöglich, die wohlfahrtsmaximierende Güterkombination zu kennen. Stattdessen muss er sich auf mehr oder weniger empirisch fundierte Vermutungen darüber stützen, welche Güter für die Bevölkerung besonders wichtig (z. B. Grundnahrungsmittel, Wohnraum, Gesundheitsdienstleistungen) und welche unwichtig (z. B. Krawatten? Schmuck?) sind. Dies ist auch das Vorgehen, das in real existierenden Planwirtschaften die Regel war bzw. ist.
Schließlich ist der wohlwollende Diktator ein theoretisches Konstrukt. In der Realität muss vielmehr davon ausgegangen werden, dass die zentral Planenden primär eigennützig handeln und von Interessengruppen beeinflusst werden, sodass es allein deshalb höchst unwahrscheinlich ist, dass ihr Handeln zur größtmöglichen Wohlfahrt für die Bevölkerung führt.
Alles in allem scheitert das Erreichen eines Allokationsoptimums in einer Planwirtschaft an Informationsdefiziten, dem Mangel an wirksamen Motivations- und Kontrollmechanismen und der mit einer zentralen Planung verbundenen Inflexibilität.
Dezentrale Allokation: Marktwirtschaft
Eine funktionierende MarktwirtschaftMarktwirtschaft ist durch WettbewerbWettbewerb gekennzeichnet: Die Anbieter konkurrieren um die Gunst der Nachfrager, und Nachfrager konkurrieren um die knappen Güter.
Es ist die Konkurrenz zwischen den Produzenten, die eine Güterkombination auf der Produktionsmöglichkeitenkurve herbeiführt. Dies gilt zumindest unter der üblicherweise getroffenen Annahme, dass die Unternehmen das Ziel der Gewinnmaximierung verfolgen. Die Plausibilität dieser Annahme ist insbesondere in einem kapitalistischen Wirtschaftssystem gegeben, d. h. in einer Volkswirtschaft, in der die Produktionsmittel Privateigentum sind. Private stellen ihr Kapital bevorzugt denen zur Verfügung, die mit dem Kapital die höchste Rendite erwirtschaften und das Kapital entsprechend hoch entlohnen können. Somit zwingt der Wettbewerb um Kapital die Unternehmen zur Gewinnmaximierung. Die Maximierung des Gewinns, sprich der Differenz zwischen Erlösen und Kosten, treibt die Unternehmen dazu an, die Stückkosten (genauer: die Grenzkosten → Teil A | Kap. 4.1) zu minimieren. Die Alternative einer Erhöhung des Stückerlöses, sprich des Preises, kommt unter Konkurrenzbedingungen hingegen kaum in Frage. Erhöht ein einzelnes Unternehmen nämlich den Preis, sodass dieser nach oben vom Marktpreis abweicht, würde die Nachfrage zur Konkurrenz abwandern, und das betrachtete Unternehmen würde über kurz oder lang vom Markt verschwinden. Der Konkurrenzdruck zwingt indes nicht nur zur Wirtschaftlichkeit, sondern forciert auch kostensenkende Innovationen. Außerdem erstreckt sich der Wettbewerb nicht allein auf die Preise, sondern auch auf die Produktqualität, den Service usw.
Der Wettbewerb der Unternehmen um die Nachfrage führt ebenfalls dazu, dass die Güterkombination realisiert wird, die bei gegebener Einkommensverteilung dazu führt, dass die Verbraucher einen höchstmöglichen Nutzen erzielen. Das lässt sich durch die Annahme erklären, dass die Zahlungsbereitschaft der Nachfrager für ein Produkt von dem Nutzen abhängt, der aus dem Konsum einer Produkteinheit gezogen wird (genauer: dem Grenznutzen → Teil A | Kap. 3.1). Je höher der Nutzen ist, desto höher ist die Zahlungsbereitschaft. Ergo können die Unternehmen für jene Güter den höchsten Preis erzielen, die den größten Nutzen stiften. Das wiederum animiert sie, ihre Produktion in eine für die Nachfrager nutzenmaximale Richtung zu lenken. Ändern sich die Präferenzen der Nachfrager und damit die jeweiligen Zahlungsbereitschaften, passen sich die gewinnorientierten Unternehmen an. Nehmen z. B. die Präferenzen für Eiskrem zu, dann steigt die Eiskremnachfrage, womit die Knappheit zunimmt. Das treibt den Marktpreis für Eiskrem in die Höhe, was wiederum die Unternehmen anregt, Eiskrem vermehrt zu produzieren.
Alles in allem führen der wettbewerbliche Gewinn- und Preisdruck in der Marktwirtschaft zum Allokationsoptimum. Der Wettbewerb übernimmt dabei u. a. die Aufgaben der Information, Motivation, Kontrolle und der Anpassung an sich ändernde Bedingungen.
Fortan konzentrieren sich die Ausführungen dieses Lehrbuchs auf die kapitalistische Marktwirtschaft, da dies das Wirtschaftssystem ist, dem sich Deutschland und die anderen Mitglieder der Europäischen Union zuordnen lassen.
4Aufbau und Lernziele
In → Teil A werden sowohl der marktwirtschaftliche Allokationsmechanismus ausführlich dargestellt als auch seine Schwächen erörtert. Eine zentrale Schwäche ist das sog. Marktversagen. Zu den Funktionsproblemen der Marktwirtschaft zählen außerdem konjunkturelle Schwankungen und die Neigung von Unternehmen zu Wettbewerbsbeschränkungen. Ein weiterer Kritikpunkt am marktwirtschaftlichen Allokationsmechanismus besteht darin, dass er Verteilungsprobleme erzeugt und sozial blind sei.
In → Teil B werden das wirtschaftspolitischeLeitbild der Sozialen Marktwirtschaft und seine Entwicklung erörtert. Das Leitbild setzt auf die Stärken des marktwirtschaftlichen Koordinationssystems, versucht aber zugleich dessen Schwächen zu beseitigen und für mehr soziale Gerechtigkeit zu sorgen.
Näher mit der Problematik von Wettbewerbsbeschränkungen befasst sich → Teil C, da diese die Funktionsfähigkeit der kapitalistischen Marktwirtschaft erheblich schmälern können. Er enthält eine Übersicht über die verschiedenen Arten von wettbewerbsbeschränkenden Verhaltensweisen und gibt Auskunft über die Theorie und Praxis der Wettbewerbspolitik.
Das Lehrbuch ist modular aufgebaut. Die → Teile A, B und C stehen in einem engen Zusammenhang zueinander und enthalten Querverweise. Zugleich sind sie jeweils in sich abgeschlossen und können auch einzeln für sich gelesen werden. Es folgt, dass beim Lesen mehrerer Teile von der hier vorgeschlagenen Reihenfolge ohne größere Probleme abgewichen werden kann, wenngleich wir die Reihenfolge durchaus mit Bedacht gewählt haben und sie daher empfehlen. Ein Überblick über die Inhalte und jeweiligen Lernziele findet sich in → Abb. 3.
Teil A | Grundlagen der Mikroökonomie – der idealtypische Markt
vollständige Konkurrenz, vollkommenes Monopol, Oligopol, Marktversagen, Funktionsprobleme der Marktwirtschaft, Markt und Verteilung
Lernziele
Nachfrage- und Angebotsverhalten nachvollziehen
Funktionsweise von Märkten verstehen
Wohlfahrtsvergleiche vornehmen
Notwendigkeit staatlicher Markteingriffe erkennen
elearning
🔗https://narr.kwaest.io/s/1327
Teil B | Soziale Marktwirtschaft
Ziele und Prinzipien, vom Merkantilismus über den Ordoliberalismus zur Sozialen Marktwirtschaft, ökologisch-soziale Marktwirtschaft
Lernziele
Kenntnis über die Wirtschaftsordnung der Bundesrepublik Deutschland erlangen
Theoretische und geschichtliche Hintergründe der Konzeption verstehen
Marktkonformität wirtschaftspolitischer Eingriffe einschätzen
elearning
🔗https://narr.kwaest.io/s/1328
Teil C | Wettbewerbspolitik
Wettbewerbsbeschränkungen, Wettbewerbsfunktionen, wettbewerbspolitische Leitbilder, deutsches und EU-Wettbewerbsrecht
Lernziele
Verhaltensweisen zur Beschränkung des Wettbewerbs erkennen
Verhaltensweisen volkswirtschaftlich bewerten
Vereinbarkeit konkreter Verhaltensweisen mit dem Wettbewerbsrecht einschätzen
elearning
🔗https://narr.kwaest.io/s/1329
Aufbau des Buchs und Lernziele
Lesetipps zu „Begriffliche Grundlagen und Wirtschaftssysteme“
Bartling, H., Luzius, F. & Fichert, F. (2019). Grundzüge der Volkswirtschaftslehre (18. Aufl.). München: Vahlen. A.I, A.III u. B.III.
Thieme, H.J. (2007). Wirtschaftssysteme. In: Vahlens Kompendium der Wirtschaftstheorie und Wirtschaftspolitik (9. Aufl.). München: Vahlen. S. 1–52.
Teil A | Grundlagen der Mikroökonomie | der idealtypische Markt
eLearning-Kurs | Zu diesem Kapitel werden Single- und Multiple-Choice-Fragen angeboten. Der folgende Link oder der QR-Code führen Sie zu den Fragen.
🔗https://narr.kwaest.io/s/1327
Vorbemerkungen
Idealerweise sorgt der Wettbewerbsmechanismus auf einem Markt für eine optimale Allokation. Die Fähigkeit des Marktes, für ein Allokationsoptimum zu sorgen, lässt sich mithilfe des Modells der vollständigen Konkurrenzvollständige Konkurrenz darstellen. Es ist das grundlegende mikroökonomische Standardmodell und steht im Mittelpunkt dieses Teils.
Die Ausführungen dieses Teils des Lehrbuchs haben erstens das Ziel, die Funktionsweise von Gütermärkten zu erläutern. Zweitens soll verdeutlicht werden, dass es verschiedene Gründe dafür gibt, dass es zu Abweichungen vom Allokationsoptimum kommt, sog. Marktversagen. Drittens soll die Notwendigkeit staatlicher Eingriffe aufgezeigt werden. Der/die Leser:in sollte nach dem Studium in der Lage sein
das Nachfrage- und Angebotsverhalten von Wirtschaftssubjekten nachzuvollziehen,
das Zusammenspiel von Angebot und Nachfrage auf einem Markt zu verstehen,
die durch den Marktmechanismus generierte Wohlfahrt zu bestimmen und
zu erkennen, ob eine Marktsituation vorliegt, die staatliche Eingriffe rechtfertigt.
Zu diesem Zweck werden zunächst die Annahmen des Modells der vollständigen Konkurrenz vorgestellt, um daraufhin schrittweise das Nachfrageverhalten und das Angebotsverhalten herzuleiten. Es folgt eine Zusammenführung zu einem Marktmodell für ein Gut und dessen wohlfahrtstheoretische Analyse. Daraufhin werden verschiedene Abweichungen vom Modell der vollständigen Konkurrenz erörtert und Formen des Marktversagens dargestellt. Anschließend werden zwei Funktionsprobleme der Marktwirtschaft skizziert, die ebenfalls zur Begründung staatlicher Wirtschaftspolitik herangezogen werden. Gleiches gilt für Verteilungsfragen, die im letzten Kapitel dieses Teils erörtert werden.
1Modellbildung
Um ökonomische Zusammenhänge darzustellen und zu analysieren, erweist sich ein zentrales ökonomisches Werkzeug als hilfreich: das mathematische Modell. Dabei werden ökonomische Verhaltensweisen (z. B. die Nachfrage nach einem Gut ) als Funktionen modelliert (z. B. die Nachfrage nach Gut ist eine Funktion von den Variablen , und ).
Ein ModellModell ist eine verkürzte und idealtypische Abbildung der Realität, die auf erheblichen Vereinfachungen beruht und daher auch nur die Grundlage für modellhafte Aussagen sein kann. Es werden also zum einen stark vereinfachende Annahmen getroffen und zum anderen haben die aus dem Modell gewonnenen Erkenntnisse zunächst auch nur unter den gemachten Annahmen Gültigkeit. Die Annahmen werden auch als PrämissenPrämissen bezeichnet. Die Erkenntnisse, die auf der Basis von Modellen entwickelt werden, können als grobe Anhaltspunkte für den erwarteten Ablauf tatsächlicher Wirtschaftsprozesse verstanden werden. Um genauere Aussagen herauszuarbeiten, empfiehlt es sich, die Prämissen sukzessive zu lockern und an die spezifischen Gegebenheiten anzupassen, die in der Realität jeweils vorliegen.
Die Überführung der Realität in ein volkswirtschaftstheoretisches Modell umfasst üblicherweise die Mechanisierung menschlichen Verhaltens und die Aggregierung dieses Verhaltens sowie die Abstraktion und Isolation.
MechanisierungMechanisierung. Menschliches Verhalten ist äußerst komplex und wird auf vielfältige Weise getrieben und beeinflusst. In der VWL wird der Mensch i. d. R. auf den Homo oeconomicusHomo oeconomicus reduziert. Von dem Bereich der Verhaltensökonomie – behavioural economics – sei hier ausdrücklich abgesehen. Der Homo oeconomicus ist durch rationales Verhalten charakterisiert: Erstens hat das Wirtschaftssubjekt ein Ziel. Zweitens richtet das Wirtschaftssubjekt sein Verhalten ausnahmslos an diesem Ziel aus.
AggregationAggregation. Das modellierte Verhalten Einzelner wird auf alle übertragen. Das heißt i. d. R., dass alle Wirtschaftssubjekte Homines oeconomici sind.
AbstraktionAbstraktion. Wirtschaftliches Handeln wird von einer schier unüberschaubaren Zahl von Einflussgrößen (Variablen) bestimmt. Das kann man sich leicht verdeutlichen, indem man überlegt, welche Größen z. B. Einfluss auf die Nachfrage nach einem bestimmten Gut, etwa Eiskrem, haben (Eiskrempreis, Eiskremqualität, Außentemperatur usw.). Eine Kunst der Modellbildung besteht darin, die wesentlichen Variablen zu identifizieren und sich fortan auf diese zu konzentrieren. Mithin wird von den weniger wichtigen oder gar unwesentlichen Variablen abstrahiert. Die Auswahl der wesentlichen Variablen basiert zunächst einmal auf Plausibilitätsüberlegungen; idealerweise sollte der tatsächliche Einfluss auf das Verhalten jedoch empirisch überprüft werden.
IsolationIsolation. Bei genauer Betrachtung können kleinste Änderungen einer Einflussgröße Auswirkungen auf eine Reihe anderer Variablen haben. Diese beeinflussten Variablen können sich wiederum auf unterschiedlichste Weise auf weitere Einflussgrößen auswirken. Ein bekanntes Beispiel aus der Physik ist der sog. Schmetterlingseffekt, der nachzeichnet, wie die Bewegung eines Schmetterlingsflügels in einen Tornado münden kann. Wollte man alle denkbaren potenziellen Folgewirkungen berücksichtigen, würde das Modell unübersichtlich und es wären keine Ergebnisse mehr vorhersagbar. Daher werden die (potenziellen) Wirkungsketten ab einem gewissen Punkt nicht weiterverfolgt und der verbleibende Ausschnitt wird isoliert betrachtet.
Abstraktion und Isolation manifestieren sich in der ceteris paribus-Annahmeceteris paribus-Annahme, die streng genommen nahezu allen Aussagen, die auf der Basis eines volkswirtschaftstheoretischen Modells getätigt werden, hinzugefügt werden müsste. Ceteris paribus (c. p.) steht für „unter sonst gleichen Bedingungen“ bzw. „unter der Annahme, dass alle anderen Variablen unverändert sind.“ Beispiel: Wenn die Außentemperatur steigt, nimmt c. p. die Eiskremnachfrage zu.
2Marktmodell der vollständigen Konkurrenzvollständige Konkurrenz
2.1Der Markt
Ein MarktMarkt ist der analytische Ort des Zusammentreffens von AngebotAngebot und NachfrageNachfrage. Die tatsächlichen und potenziellen Verkäufer werden als Anbieter und die tatsächlichen und potenziellen Käufer als Nachfrager bezeichnet. Auf einem Markt werden Waren, Dienstleistungen, immaterielle Vermögensgüter (z. B. Patente, Mobilfunklizenzen), Produktionsfaktoren, Anleihen, Währungen usw. gehandelt.
Die wenigsten Märkte sind Punktmärkte im Sinne eines überschaubaren geografischen Orts, an dem alle Anbieter und Nachfrager zum gleichen Zeitpunkt physisch zusammentreffen. Beispiele für Punktmärkte sind Floh- und Wochenmärkte. Die Regel sind Märkte mit geografisch auseinanderliegenden Anbietern bzw. Nachfragern wie etwa der Wohnungsmarkt oder Online-Verkaufsportale.
2.2Annahmen der vollständigen Konkurrenz
Dieses Lehrbuch beschränkt sich bei der mikroökonomischen Analyse auf das grundlegende neoklassische Marktmodellneoklassisches Marktmodell. Dessen Annahmen muten zwar teils sehr unrealistisch an, aber das Modell erlaubt gerade aufgrund seiner Einfachheit allgemeine Schlussfolgerungen. Die Volkswirtschaftstheorie bietet selbstverständlich zahlreiche komplexere Erklärungsmodelle, auf die im Folgenden indes nicht eingegangen werden kann.
Ausgangspunkt der neoklassischen Preistheorieneoklassische Preistheorie ist das Marktmodell der vollständigen Konkurrenzvollständige Konkurrenz, auch als vollkommenevollkommene Konkurrenz bzw. perfekte Konkurrenz oder als vollkommener bzw. perfekter WettbewerbWettbewerb bezeichnet. Die wichtigsten Annahmen lauten:
Marktform des Angebots- und Nachfragepolypols. Es gibt eine sehr große, theoretisch unendlich hohe Zahl von Anbietern und Nachfragern, deren Marktanteil so winzig ist, dass sie allein den Markt durch Verhaltensänderungen nicht beeinflussen können. Zum Beispiel ist der Preis eines Gutes für den Einzelnen ein Datum, d. h. unveränderlich. Das Gleiche gilt für die Faktorpreise, also etwa den Lohnsatz, der sich auf dem Arbeitsmarkt bildet.
Vollständige Transparenzvollständige Transparenz. Alle Wirtschaftssubjekte sind vollumfänglich informiert, z. B. über den Preis, die Qualität, die Kosten, den Nutzen etc.
Völlig homogene und beliebig teilbare Güter. Die auf dem Markt gehandelten Güter sind stets gleich, d. h. es gibt keine objektiven oder subjektiven Unterschiede (z. B. ist Eiskrem gleich Eiskrem). Außerdem sind sie in beliebig kleine Einheiten teilbar und handelbar (z. B. ein Milliliter Eiskrem).
Völlig homogene und beliebig teilbare Produktionsfaktoren. Arbeit, Kapital etc. sind ebenso wie die Güter jeweils homogen. Das heißt, dass es z. B. keine Unterschiede hinsichtlich der Qualifikation oder sonstiger Eigenschaften zwischen den Arbeitskräften gibt. Produktionsfaktoren können zudem in beliebig großen bzw. kleinen Mengen im Produktionsprozess eingesetzt werden.
Unendlich hohe Anpassungsgeschwindigkeit. Mengen und Preise passen sich unendlich schnell an veränderte Gegebenheiten an.
Völlig flexible Preise für Güter und Produktionsfaktoren.
Keine Raumüberwindungs- und andere TransaktionskostenTransaktionskosten. Es wird ein PunktmarktPunktmarkt unterstellt, auf dem keinerlei Kosten des Geschäftsabschlusses außer dem Preis anfallen (z. B. keine Transport-, Geschäftsanbahnungs- oder Vertragsüberwachungskosten).
Völlig freier Markteintritt und -austritt. Es gibt keine Barrieren, um auf einen Markt zu treten (z. B. Lizenzpflicht) oder auszuscheiden (z. B. extrem hohe irreversible Anfangsinvestitionen).
Steigende GrenzkostenGrenzkosten. Die Produktionstechnologie ist derart beschaffen, dass eine Ausdehnung der Produktionsmenge mit steigenden Kosten einhergeht und die zusätzlichen Kosten je Mengeneinheit (Grenzkosten) mit steigender Menge zunehmen.
Gesetz von der Unterschiedslosigkeit der PreiseGesetz von der Unterschiedslosigkeit der Preise. Auf einem Markt herrscht stets ein einheitlicher Preis. Sobald nämlich zwei unterschiedliche Preise existieren würden, finden sich Wirtschaftssubjekte, die das Gut zum niedrigeren Preis einkaufen, um es zum höheren Preis wieder zu verkaufen. Diese ArbitrageArbitrage – das risikolose Ausnutzen von Preisunterschieden zwecks Realisierung eines sicheren Gewinns – hält an, bis die gestiegene Nachfrage nach dem günstigeren Gut und das gestiegene Angebot des teureren Gutes den „niedrigen“ Preis so weit hat steigen und den „hohen“ Preis so weit hat sinken lassen, dass sie übereinstimmen.
Im Folgenden wird ein Gütermarkt betrachtet. Darüber hinaus wird angenommen, dass alle Anbieter produzierende Unternehmen und dass alle Nachfrager konsumierendeHaushalte sind. Der Markt stellt somit eine Plattform zur Interaktion zwischen KonsumentenKonsumenten und Produzenten dar. Diese Annahme ist eine weitere starke Vereinfachung, denn es wird von (Zwischen-)Händlern und anderen Akteuren abstrahiert. In einem späteren Schritt wird dann der Staat insoweit mit einbezogen, als dass staatliche Markteingriffe thematisiert werden.
Eine weitere Annahme betrifft die Ziele der Marktteilnehmer: Die Konsumenten streben nach NutzenmaximierungNutzenmaximierung und die Produzenten nach GewinnmaximierungGewinnmaximierung.
3Bestimmung der Nachfrage: Haushaltstheorie
3.1Nutzen und Grenznutzen
Die NachfrageNachfrage beschreibt das Verhalten aller Marktteilnehmer, die in Erwägung ziehen, ein bestimmtes Gut zu kaufen. Die Nachfrager tauschen Zahlungsmittel (Geldvermögen) gegen ein Gut, z. B. eine Ware. Auf einem Flohmarkt wären dies die Besucher des Marktes, die für den ihres Erachtens „richtigen“ Preis bereit wären, ein Gut zu erwerben, z. B. eine Kuckucksuhr. Um die Nachfrage und letztlich den Kauf einer solchen Uhr zu verstehen, muss man sich zunächst fragen, warum ein Konsument überhaupt ein Gut erwirbt. Der Konsument wird dann Geld gegen eine Uhr tauschen, wenn sich dies für ihn „lohnt“, wenn also der Tausch sein Wohlbefinden steigert. Der Nachfrager verspricht sich also in irgendeiner Weise eine Verbesserung für sich selbst von dem Erwerb des Gutes. Worin könnte die Verbesserung beim Kauf einer Kuckucksuhr liegen? Zum einen lässt sich die Uhrzeit an ihr ablesen. Zum anderen passt sie möglicherweise sehr gut in das eigene Wohnzimmer. Eventuell hat der Nachfrager auch ein Faible für Kuckuckstöne oder er möchte mit ihnen seine Nachbarn ärgern. In jedem Fall ist ihm die Uhr nützlich. Ökonomen sprechen in diesem Zusammenhang vom NutzenNutzen des Konsums. In der Realität ist dieser Nutzen äußerst vielschichtig und nur eingeschränkt messbar. Zur Vereinfachung wird in unserem Modell davon ausgegangen, dass der Nachfrager in der Lage ist, jedem Gut einen eindeutigen Nutzen zuzuordnen. Der Nutzen spiegelt alle Aspekte wie Funktionalität, Ästhetik etc. wider. Eine Kuckucksuhr hat dabei für den, dem es besonders wichtig ist, die Uhrzeit zu kennen, möglicherweise einen höheren Nutzen als eine Schallplatte, vor allem wenn er über keinen Plattenspieler verfügt. Eventuell wäre aber wiederum der Nutzen einer Armbanduhr für ihn höher als der Nutzen der Kuckucksuhr. Ein anderer Konsument, der wenig Wert auf die Kenntnis der genauen Uhrzeit legt und im Besitz eines Plattenspielers ist, wird hingegen der Schallplatte wahrscheinlich einen nennenswerten Nutzen und der Uhr wenig Nutzen beimessen. Dieses Beispiel verdeutlicht, dass der Nutzen eines Gutes von den individuellen PräferenzenPräferenzenindividuelle und Bedürfnissen abhängt.
Da das Budget des Haushalts begrenzt ist, muss sich der Konsument entscheiden, welche Güter er nachfragt. Außerdem muss er entscheiden, welche Menge er kaufen möchte. So mögen die meisten Haushalte nur den Kauf von maximal einer Kuckucksuhr planen; gleiches gilt z. B. für den Erwerb von Wohneigentum. Bei den meisten Verbrauchsgütern (z. B. Eiskrem) und etlichen Gebrauchsgütern (z. B. Töpfe) ist jedoch weniger das „Ob“, sondern das „Wieviel“ die offene Entscheidung. Dann ist von Interesse, ob eine weitere Mengeneinheit noch den selben Nutzen wie die erste generiert; und wie steht es um den Zusatznutzen der dritten oder vierten Einheit? So ist bei Eiskrem anzunehmen, dass der Nutzenzuwachs durch die erste Packung für viele Konsumenten recht groß ist. Entscheidet man sich nun für eine zweite Packung, hat man noch eine Reserve-Packung vorrätig, falls einen der Heißhunger auf Eis überkommt. Also auch hier gäbe es einen Nutzenzuwachs. Doch vermutlich ist der Nutzen der zweiten Packung nicht so hoch wie jener der ersten Packung. Entscheidet man sich nun noch für eine dritte, vierte oder fünfte Packung ist zwar davon auszugehen, dass der gesamte Nutzen weiter steigt, aber vermutlich wird der Nutzenzuwachs immer geringer werden. Irgendwann wird man – z. B. bei der 19. Packung Eiskrem – nur noch einen sehr kleinen, kaum spürbaren Nutzenzuwachs erfahren.
Mengenabhängiger Nutzen und Grenznutzen
Die → Abb. A-1 stellt diesen Sachverhalt grafisch dar. Die steigende Kurve zeigt den Verlauf des Nutzens (utility) in Abhängigkeit von der konsumierten Menge des Gutes . Mit steigender Menge steigt zwar durchgängig auch der Nutzen , aber die NutzenkurveNutzenkurve flacht immer weiter ab, d. h. die positive Steigung wird geringer. Die Steigung der Nutzenkurve entspricht dem Nutzenzuwachs durch eine zusätzliche Gütereinheit. Dieser Nutzenzuwachs ist der GrenznutzenGrenznutzen (). Die fallende Kurve hat eine negative Steigung und ist hier als Gerade dargestellt: Mit wachsender Menge sinkt der Grenznutzen. Die alles in allem plausible Annahme des positiven, aber abnehmenden GrenznutzenGrenznutzens wird als erstes Gossensches GesetzGossensches Gesetzerstes bezeichnet, benannt nach dem Nationalökonomen Hermann GossenGossen, Hermann (1810–58).
Beispiel | Nutzen und Grenznutzen
für
für
für
für
3.2IndifferenzkurveIndifferenzkurve und Grenzrate der SubstitutionGrenzrate der Substitution
Ein Haushalt konsumiert nicht nur ein einziges Gut, sondern viele verschiedene Güter. Um dem Rechnung zu tragen, wird die Analyse um ein zweites Konsumgut erweitert. Die zwei Güter seien als Gut 1 () und Gut 2 () bezeichnet. Wem die 2-Güter-Annahme zu realitätsfremd erscheint, kann die --Welt auch so interpretieren, dass die Entscheidung für ein Gut 1 () im Verhältnis zu dem zusammengefassten Konsum aller anderen Güter, repräsentiert durch , betrachtet wird.
Die → Abb. A-2 zeigt zwei Beispiele für 2-Güter-Konsumpläne in einem --Diagramm. Der Punkt steht für die Güterkombination bei dem acht Einheiten des Gutes 1 und drei Einheiten des Gutes 2 konsumiert werden. Punkt besagt, dass vier Einheiten des Gutes 1 und acht Einheiten des Gutes 2 konsumiert werden.
Konsumalternativen
Der Nutzen einer Güterkombination wird von den Präferenzen des IndividuumsPräferenzen des Individuums für Gut 1 und Gut 2 bestimmt. Nun sei unterstellt, dass der Haushalt für beide Güterbündel ( und ) den selben Nutzen erfährt. Würde man dem Haushalt das Güterbündel zum Tausch für das Güterbündel anbieten, dann steht er diesem Tausch neutral gegenüber. Folglich ist der Haushalt gegenüber diesem Tausch indifferent.
In → Abb. A-3 sind eine Reihe weiterer Güterkombinationen eingezeichnet (), für die gelten soll, dass sie alle den gleichen Nutzen wie stiften. Würde man alle Güterkombinationen einzeichnen, denen vom Haushalt der gleiche Nutzen zugeordnet wird, erhält man eine Kurve (die Kurve in → Abb. A-3). Sie wird als individuelle IndifferenzkurveIndifferenzkurve bezeichnet.
Individuelle Indifferenzkurve
Der Haushalt könnte jede beliebige Güterkombination entlang der Indifferenzkurve gegen eine andere Kombination auf der Kurve tauschen, ohne sich dabei schlechter oder besser zu stellen. (Dies gilt natürlich nur unter der o. g. Annahme, dass keine Transaktionskosten anfallen, → Kap. 2.2).
Beispiel | Nutzen von zwei Gütern
für und
für und
Die Indifferenzkurve ist linksgekrümmt, d. h. sie verläuft konvex zum Ursprung. Die Steigung der Kurve ist somit negativ und wird mit zunehmendem absolut kleiner. (Die Steigung an einem Punkt einer Kurve entspricht der Steigung der Tangente durch diesen Punkt.) Das bedeutet, dass bei einer Ausdehnung von in gleichgroßen Schritten die Menge von zurückgeht, aber der Rückgang von mit steigendem immer kleiner wird. Wieso aber verläuft die Indifferenzkurve konvex zum Ursprung? Das lässt sich mit der oben begründeten Annahme des abnehmenden Grenznutzens, dem ersten Gossenschen GesetzGossensches Gesetzerstes, erklären:
Angenommen, der Haushalt würde anfangs Güterkombination realisieren und sukzessive den Konsum von um eine Einheit ausdehnen, d. h. von 4 Mengeneinheiten auf 5, von 5 auf 6 usw. Der Nutzen wird gemäß dem Gossenschen Gesetz c. p. jeweils zunehmen, aber der Nutzenzuwachs würde von Schritt zu Schritt kleiner. Damit trotz des mengenbedingten Anstiegs des Nutzens aus Gut das Nutzenniveau gleichbleibt (Indifferenzkurve!), muss zugleich der Nutzen aus dem Konsum von Gut sinken, d. h. es wird weniger konsumiert. Nun gibt es zwei Gründe, warum es bei steigendem -Konsum immer kleinerer Rückgänge der -Menge bedarf, damit der gesamte Nutzen gleichbleibt. Erstens wird der Nutzenanstieg, den es auszugleichen gilt, immer kleiner (abnehmender Grenznutzen des Gut ). Zweitens wird eine Einheit des Gutes bei dessen sinkendem Konsum immer wertvoller, denn bei abnehmendem Konsum steigt der Grenznutzen.
Man nehme beispielsweise an, dass es sich bei Gut 1 um Schokolade und bei Gut 2 um Kekse handelt. Befindet sich nun ein Haushalt im Konsumpunkt (→ Abb. A-3), stehen ihm mit 4 Tafeln vergleichsweise wenig Schokolade und mit ca. 8 Packungen vergleichsweise viele Kekse zur Verfügung. Der Haushalt wäre in Punkt bereit, für eine zusätzliche Tafel der „wertvollen“ Schokolade auf eine relativ große Menge der relativ reichlichen Kekse zu verzichten (Bewegung von nach ), nämlich auf ca. 2 Kekspackungen. Ist Schokolade hingegen relativ reichlich und sind Kekse relativ knapp wie in Punkt , würde der Haushalt nur noch auf relativ wenige der gegenüber Punkt „wertvoller“ gewordenen Kekse im Austausch für eine nun weniger „wert“ gewordene Tafel Schokolade verzichten (Bewegung von nach ), nämlich auf ca. 0,5 Kekspackungen.
Das AustauschverhältnisAustauschverhältnis wird als Rate der SubstitutionRate der Substitution bezeichnet. Die Rate der Substitution des Gutes 1 gibt an, wie viele Einheiten des Gutes 2 ein Haushalt im Austausch dafür hergeben würde (, dass sein Konsum des Gutes 1 um eine bestimmte Menge steigt (. Die Rate der Substitution ist dann . Sprich: Steigt der Konsum von Gut 1 um und sinkt der Konsum um , dann bleibt das Nutzenniveau unverändert. Dieser Zusammenhang ist in → Abb. A-4 grafisch dargestellt. Der grüne Pfeil beschreibt eine Zunahme der Ausstattung mit Gut 1 (). Wenn zugleich die Ausstattung mit Gut 2 um (roter Pfeil) sinkt, verbleibt der Haushalt auf der gleichen Indifferenzkurve, d. h. das Nutzenniveau bleibt gleich. Die Rate der Substitution entspricht mithin dem Tangens des Winkels . (Der Tangens berechnet sich in einem rechtwinkligen Dreieck als der Quotient aus Gegenkathete durch Ankathete.) Je weiter man sich auf der Indifferenzkurve nach rechts bewegt, umso kleiner wird der Winkel; sprich der Tangens sinkt und somit auch die Rate der Substitution.
Beispiel | Rate der Substitution (RS) für bei einem Nutzenniveau von 40
Ein Haushalt konsumiert 64 Schokoriegel () und 25 Tüten Chips (), folglich ist das Nutzenniveau 40. Er spürt keine Nutzenänderung, wenn ihm 36 zusätzliche Schokoriegel () gegeben und im Gegenzug 9 Tüten Chips () genommen würden. Die RS () beträgt somit bzw. .
Der Haushalt konsumiert 80 Schokoriegel () und 20 Tüten Chips . Er ist indifferent gegenüber einem Tausch von zusätzlich 20 Schokoriegeln () gegen 4 Tüten Chips (). Die RS () beträgt somit bzw. .
(Das negative Vorzeichen der RS wird gelegentlich zur Vereinfachung weggelassen.)
Tauschverhältnis
Als nächstes sei die Grenzrate der SubstitutionGrenzrate der Substitution (GRS) eingeführt. Sie stellt das AustauschverhältnisAustauschverhältnis dar, wenn der Konsum des Gutes gedanklich um eine infinitesimal kleine Einheit erhöht wird. Die GRS bei einer Güterkombination auf der Indifferenzkurve entspricht der Steigung der IndifferenzkurveIndifferenzkurve an dem Punkt, also der Steigung der Tangente durch diesen Punkt. Die Tangente wird mit zunehmendem -Konsum immer flacher, d. h. die GRS sinkt. Ursächlich ist, dass bei steigendem Konsum von Gut 1 dessen GrenznutzenGrenznutzen sinkt und bei sinkendem Konsum von Gut 2 dessen Grenznutzen steigt (1. Gossensches Gesetz). Da es schwerfällt, die Vorstellung einer infinitesimal kleinen Mengenänderung auf die ökonomische Praxis zu übertragen, wird die Aussage der GRS für ein Gut oftmals verkürzt auf „die Menge eines anderen Gutes, die ein Haushalt eintauschen würde, wenn er im Gegenzug eine zusätzliche Einheit des Gutes erhalten würde.“
Für jedes denkbare NutzenniveauNutzenniveau () existiert eine IndifferenzkurveIndifferenzkurve. Somit gibt es eine unendliche Anzahl dieser Kurven. Je weiter eine Indifferenzkurve vom Ursprung entfernt ist, desto höher ist das Nutzenniveau, das sie darstellt. Die → Abb. A-5 stellt diesen Zusammenhang dar.
Nutzenniveaus
Der Verlauf der Indifferenzkurven hängt u. a. von der Beziehung zwischen den zwei Gütern ab, z. B. ob und wie gut sie gegeneinander austauschbar sind. Hierbei kann zwischen Substitutions- und Komplementärgütern unterschieden werden.
Als SubstitutionsgüterSubstitutionsgüter werden Güter bezeichnet, die bei der Nutzung bzw. beim Konsum aufgrund ähnlicher Eigenschaften zu einem gewissen Grad austauschbar sind. Beispiele hierfür wären Soja- und Hafermilch, Butter und Margarine, Sahneeis und Joghurteis, Erdnussflips und Kartoffelchips, E-Books und physische Bücher oder Kinobesuch und Video on Demand. Anhand dieser Beispiele wird klar, dass sich der Grad der Substituierbarkeit unterscheidet. Dies kann ganz allgemeine Gründe haben, da beispielsweise physische Bücher immer gelesen werden können, während E-Books eine Stromversorgung voraussetzen. Natürlich können aber auch subjektive Argumente die Austauschbarkeit beeinflussen, da z. B. eine Präferenz für vegane Ernährung gegen Butter und für Margarine spricht.
Man unterscheidet zwischen imperfekten und perfekten Substituten. Imperfekte SubstitutionsgüterSubstitutionsgüterimperfekte wären z. B. Eiskrem und Wassereis, Baumwolle und Viskose, Kekse und Schokolade oder Auto und Fahrrad. Ein (nahezu) perfektes SubstitutionsgutSubstitutionsgüterperfektes zu Superbenzin 95 (E5) wäre z. B. E10-Super-Benzin (E10), wenn es um das Betanken eines E10-fähigen Benziners geht. Auch verschiedene Geldscheine (z. B. 10 Euro und 20 Euro) sind weitestgehend perfekte Substitute.
Perfekte Substitutionsgüter
Die → Abb. A-6 zeigt die grafische Aufbereitung der Indifferenzkurven für perfekte Substitute. könnte also Super 95 (E5) und die entsprechende Menge E10 sein. Die dazugehörigen Nutzenniveaus werden bei perfekter Substituierbarkeit durch Geraden dargestellt, die beide Achsen schneiden. Dabei stehen die Schnittpunkte mit den Achsen für den ausschließlichen Konsum des einen bzw. anderen Gutes. Bei allen anderen Punkten werden sowohl Gut 1 als auch Gut 2 konsumiert. Die gerade (lineare) Form der Indifferenzkurven besagt, dass die Grenzrate der Substitution konstant ist. Dies bedeutet, dass es in jedem Punkt der gleichen Menge des einen Gutes bedarf, um den Nutzenverlust durch den Verzicht auf eine Einheit des anderen Gutes auszugleichen. Sprich das Austauschverhältnis ist konstant. Angewandt auf das Tanken hieße das also, dass man mit 30 Liter Super und 10 Liter E10 genauso weit fahren könnte wie z. B. mit 29 Liter Super und 12 Liter E10 und wie mit 28 Liter Super und 14 Liter E10. Anders formuliert: Egal wieviel Super man in der Ausgangssituation im Tank hat, man braucht als Ersatz für einen Liter Super stets zwei Liter E10, um die gleiche Distanz zurückzulegen (den gleichen Nutzen zu erleben). Die Grenzrate der Substitution ist entsprechend durchgehend -2.
Der Fall perfekter Substitutionsgüter ist in der Praxis indes extrem selten. Die meisten Güter sind vielmehr imperfekte Substitute, d. h. die Indifferenzkurven sind nicht linear, sondern normalerweise links gekrümmt.
Es ist jedoch auch denkbar, dass Güter nicht in einem Substitutionsverhältnis, sondern in einer komplementären Beziehung zueinanderstehen. Entsprechend spricht man von KomplementärgüternKomplementärgüter. Beispiele sind das Auto und Treibstoff, Fahrrad und Luftpumpe, Hardware und Software oder Eiskrem und Eislöffel. Perfekte KomplementärgüterKomplementärgüterperfekte sind dadurch gekennzeichnet, dass ihr Konsum nur in einem festen Mengenverhältnis Nutzen stiftet. Das klassische Beispiel hierzu sind rechte und linke Schuhe, die für die allermeisten Menschen nur gemeinsam und in einem festen Verhältnis (1:1) von Nutzen sind. Andere Beispiele wären Handy und SIM-Karte oder Fahrradgestell und Fahrradreifen.
Die → Abb. A-7 zeigt den Verlauf der Indifferenzkurven für den Fall perfekter Komplementärgüter, etwa für den linken Schuh (Gut 2) und den rechten Schuh (Gut 1). Das Erreichen der nächsthöheren Indifferenzkurve, also eines höheren Nutzens, ist für den Haushalt nur möglich, wenn er parallel zum Konsum des einen Gutes den Konsum des anderen Gutes erhöht. Die Eckpunkte der Indifferenzkurven geben dabei die ökonomisch sinnvollen Konsumpunkte an: Besitzt man z. B. drei linke und drei rechte Schuhe, dann lässt sich der Nutzen c. p. nicht durch einen weiteren linken Schuh erhöhen. Der Nutzen steigt nur dann, wenn zusätzlich ein rechter Schuh konsumiert würde.
Perfekte Komplementärgüter
3.3Die Nutzenfunktion
Der Zusammenhang zwischen Konsummengen und Nutzen lässt sich auch algebraisch darstellen. Die allgemeine Darstellung lautet
Die NutzenfunktionNutzenfunktion