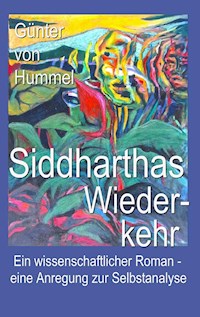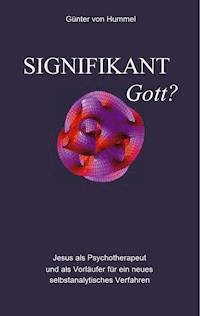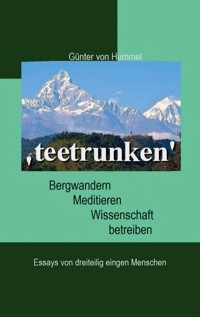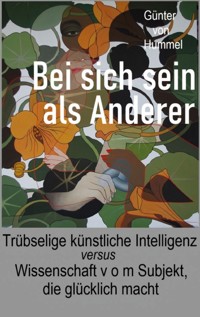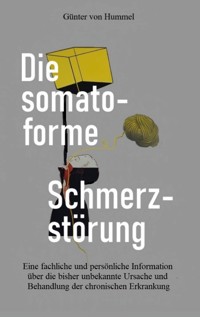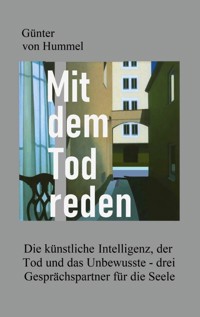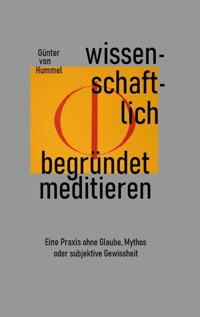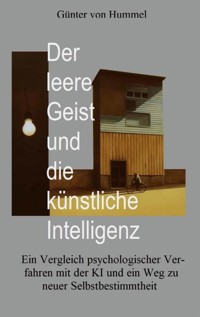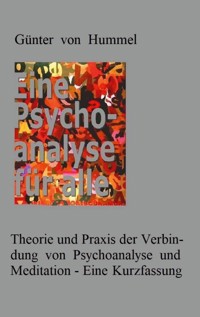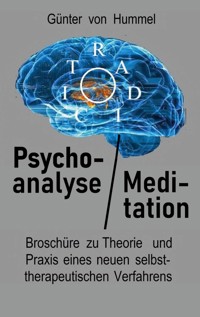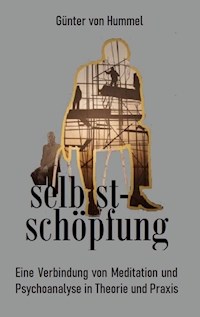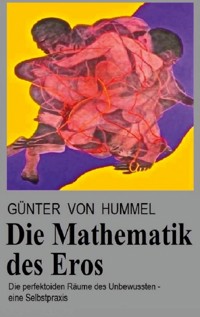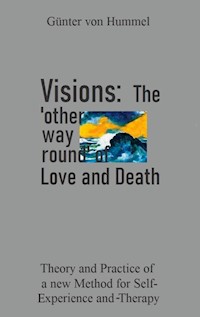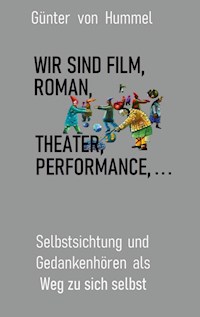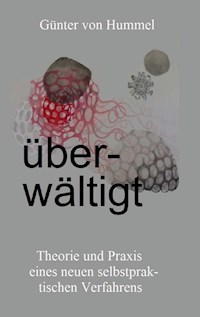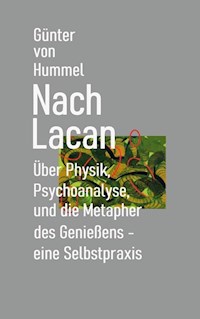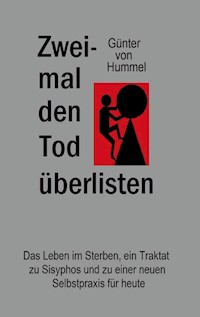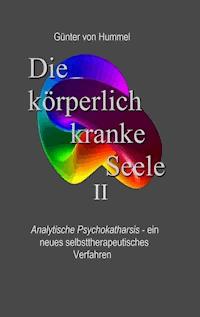
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Körperliche Symptome haben fast immer auch seelische Wurzeln. Sowohl die naturwissenschaftliche Medizin wie auch psychologische Methoden konnten bisher nicht in das Zentrum dieses seelisch-körperlichen Zusammenhangs vordringen. In dieser Broschüre, die eine Fortsetzung der gleichnamigen Broschüre I ist, wird nochmals die einfache Technik erklärt und der wissenschaftliche Hintergrund anhand einer biographischen Entwicklung und sprachphilosophischer Aspekte aufgezeigt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 80
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Das Bild auf der Umschlagseite zeigt ähnlich wie in der Broschüre „Die körperlich kranke Seele“ I ein Tranguloid und vermittelt damit eine mathematisch berechenbare und auch geometrisch (besser topologisch) anschauliche Struktur sich einander durchschlingender Flächen. Ich habe darauf hingewiesen, dass Körper und Seele des Menschen ebenso durchwoben sind und es daher eines ebenso komplex strukturierten Verfahrens bedarf, nämlich die Analytische Psychokatharsis, um diese Vielschichtigkeit zwischen Körper und Seele wissenschaftlich zu behandeln, aufzuschließen und neu zu formen. Damit auch ein Leser, der die Broschüre I nicht gelesen hat, von dem Text profitieren kann, habe ich wichtige Grundlagen hier nochmals erörtert.
Inhaltsverzeichnis
Am Anfang war die Wissenschaft
Psychoanalyse / Meditation
Religion, ‚Spiritualität‘ und Psychosomatik
Formel-Formulierungen
Weiteres zur Analytischen Psychokatharsis
Die
Pass-Worte
Logische Praxis
1. Am Anfang war die Wissenschaft
‚How to do things with words‘, wie man ‚Dinge‘ mit Worten tut, so lautete das Buch des Sprachphilosophen John Austin aus den frühen fünfziger Jahren des letzten Jahrhunderts; und genau dies ist auch das Anliegen meiner beiden Broschüren zum Verfahren der Analytischen Psychokatharsis. Doch während Austin und in seiner Nachfolge J. Searle und andere über das Wesen der Sprache nur abstrakte, akademische Abhandlungen schrieben, stellt die Analytische Psychokatharsis die entscheidende Praxis dar. Das Wesen der Sprache mit der Sprache zu theoretisieren läuft auf das Gleiche heraus, wie wenn man Krieg mit Krieg erklärt oder Mathematik mit Mathematik (man braucht bekanntlich verbal vermittelte Axiome und Algorithmen). Man muss wirklich ‚Dinge‘ zusammenbringen, nicht unbedingt harte, nüchterne Sachen, aber doch Wesentliches, das man spüren kann, ja, das vielleicht sogar glänzt.
Denn wenn man allein mit Worten richtige ‚Dinge‘ fabriziert hat, dann – und das darf ich jetzt im psychoanalytischen Sinne so sagen – strahlen die ‚Dinge‘ auch wieder zurück und befeuern erneut die Worte, mit denen ‚Dinge‘ gemacht werden können. Das geht so lange bis ein befriedigendes Ergebnis erreicht ist oder sich eine Erschöpfung eingestellt hat. Ich sage damit nichts Neues. Bekanntlich wird in der Psychoanalyse hauptsächlich mit Worten gearbeitet, und die Therapeuten sprechen tatsächlich von ‚guten inneren Objekten‘, also seelischen Festigkeiten, wirklichen ‚Dingen‘, die das Ziel der Behandlung darstellen. Auch zu Beginn der Therapie existieren ‚innere Objekte‘, aber sie hießen ‚infantile‘, z. B. ‚orale‘, also an die Mundlust fixierte ‚Objekte‘, und auch die waren schon mit Worten gemacht worden: unbewussten Ansprüchen und Versagungen, Verführungen und Zurückweisungen und vielem anderen mehr.
Nun hat Freud behauptet, das Ziel des Lebenstriebes sei der Tod, das Anorganische sei früher dagewesen als das Organische und so bestehe das Leben nur daraus, den Todesweg zu verlängern; der Todestrieb sei unwiderstehlich. Moderne Autoren halten diese Auffassung für pessimistisch, und dem möchte ich mich gleich anschließen, denn wenn man mit Worten ‚Dinge‘ machen kann und diese wieder zurückstrahlen, befindet man sich nicht mehr im Bereich der Biologie, mit der Freud begonnen hat. Wie gesagt, man kann zum ‚guten inneren Objekt‘ kommen, und dazu muss man nicht vorwiegend die Sprachphilosophen lesen. Ganz neu hat nämlich der Philosoph C. Taylor ein Buch mit dem Titel ‚Das sprachbegabte Tier‘ herausgebracht, in dem er auf über 600 Seiten über den Zusammenhang von Worten und ‚Dingen‘ schreibt. In der Analytischen Psychokatharsis kann man diesen Zusammenhang einfacher und praktischer erfahren.
Vorerst aber etwas Pragmatisches: diese Broschüre lässt sich als eigenständiger Text und nicht nur als Fortsetzung der Broschüre I verstehen. Viele Leser haben sich darüber mokiert, dass der Text im ersten Buch zu schwierig sei, und so will ich einerseits in der Art einer Kurzbiografie über den Weg schreiben, der von der Hypnose über das Autogene Training zur Psychoanalyse und schließlich zur Analytischen Psychokatharsis geführt hat, so wie ich es selbst erfuhr. Andererseits will ich ein paar anschauliche Beispiele zu diesem Verfahren bringen, will neue Erkenntnisse einfügen und die Praxis nochmals gezielt beschreiben. Denn das praktische Vorgehen ist das wichtigste und zugleich auch am einfachsten zu erklärende.
Denn so wie man ‚Dinge‘ mit Worten tut, die ich in der Analytischen Psychokatharsis Formel-Worte nenne, kommen durch praktische Übungen hier auch ‚Dinge‘ zustande, die zurückreflektierend wieder Worte sind: Identitäts- oder Pass-Worte. Wenn ich den Weg beschreibe, wie ich zu dieser selbsttherapeutischen Methode als einem Zugang zum Wesen der Sprache und Psychosomatik gekommen bin, wird es vielleicht für viele leichter zu verstehen sein, um was es geht. Nach wie vor muss ich aber zugeben, dass auch diese Broschüren keine völlig leichte Lektüre im Sinne eines einfachen Ratgebers darstellt. So sehr das Verfahren sich in seiner praktischen Anwendung sehr simpel ausnimmt, muss man auch ein bisschen Theorie und die dazugehörigen Zusammenhänge gut verstanden haben, um das notwenige tiefe Vertrauen dazu zu haben.
Ein gewisses wissenschaftliches Verständnis und intellektuelle Anstrengung soll den blinden Glauben oder mythische Vorstellungen ersetzen, auf die man sich früher gestützt hat. Es soll hier aber um eine Wissenschaft gehen, an der jeder teilnehmen kann, wie es der Neurophilosoph H. Hastedt sagte: „Der Geist in der Teilnehmerperspektive ist als Subjekt der Erkenntnis methodisch vorrangig gegenüber Geist und Körper als Erkenntnis-Objekt in der Beobachterperspektive.“1 Es geht hier also nicht nur darum eine Praxis zu erlernen, sondern – ein bisschen - auch an einer Wissenschaft mitzuarbeiten, was absolut nicht schwierig sein muss. Im Teil I habe ich Goethe mit dem Satz aus seinem Faust zitiert: „Zwei Seelen wohnen, ach! in meiner Brust, die eine will sich von der andern trennen: Die eine hält in derber Liebeslust sich an die Welt mit klammernden Organen; die andre hebt gewaltsam sich vom Dust zu den Gefilden hoher Ahnen.“
Ich habe erwähnt, dass auch die heutige Wissenschaft, insbesondere die Psychoanalyse, von einem derartigen Gespaltensein des Menschen ausgeht, wobei sie die zwei Seelen als Triebkräfte auffasst. Diesen unbewussten Kräften, die der französische Psychoanalytiker J. Lacan der Goethe´schen Reihenfolge nach den Wahrnehmungs- bzw. Schautrieb und den Entäußerungs- bzw. Sprechtrieb nennt, unterliegen wir gezwungenermaßen, auch wenn wir diese Spaltung gar nicht bemerken. Die Kombination der Kräfte und damit ihre Auswirkungen können wir jedoch etwas steuern und zwar eben gerade dadurch, dass wir Dinge mit Worten tun. Neuerdings weiß man ja auch, dass man auf Grund der großen Plastizität des Gehirns und des Unbewussten sogar mit gedanklichen Übungen psychosomatische Beschwerden deutlich verbessern kann.
Die gedankliche Steuerung kann aber nicht einfach nur vom Ich ausgehen, sondern braucht eine Methode, ein Verfahren, wie man an das Unbewusste herankommt und mit ihm konstruktiv und kreativ umgehen kann, damit auch wirklich ‚Dinge‘ passieren und nicht immer nur wieder Wörter. Die Steuerung kann auch nicht vom Über-Ich, einer Art von Pflicht- oder Schulungs-Ich ausgehen, wie es in der Religion und in den Universitätswissenschaften der Fall ist, denn dort werden Überwörter verwendet, die nur sehr starre ‚Dinge‘ tun. Und auch intuitive, mythische, esoterische und spirituelle Methoden können nicht helfen, da sie – psychoanalytisch gesprochen – mehr Ich-Ideal-Bildungen, also Idealisierungen sind, die zwar schön und erhaben sein mögen, aber die Wahrheit nicht als wissenschaftliches ‚Ding‘ vermitteln, sondern eben nur über ein ‚Dinge-Tun‘ mit mythisch-magischen Wörtern
Ende der fünfziger Jahre des letzten Jahrhunderts gab es in der Universitäts-Poliklinik in München den Professor Dr. Seitz, der – für damalige wissenschaftliche Verhältnisse erstaunlich fortschrittlich – Vorlesungen über Psychosomatik hielt. Psychotherapie war vor dem 2. Weltkrieg und auch kurz danach kaum ein Thema. Umso mehr war die Neugierde bei vielen meiner Kommilitonen und mir Anfang der sechziger Jahre des letzten Jahrhunderts geweckt, als wir diese Vorlesungen besuchen konnten. In diesen Vorlesungen von Prof. Seitz trat auch mehrmals ein Dr. Helbig auf, der autogenes Training und Hypnose praktizierte. Er versetzte meist einen der studentischen Zuhörer in Hypnose und stach ihm dann eine Stricknadel durch die Hand. Der Proband berichtete nach der Hypnose, dass er keinen Schmerz verspürt habe. Wir waren beeindruckt und gingen auch in die privaten Veranstaltungen Dr. Helbigs.
Doch nach einiger Zeit bemerkten wir, dass Dr. Helbig keinen so großen Überblick über die Psychosomatik besaß. Viel hatte er nicht drauf. Wir lernten das autogene Training, Unterstufe, und das war´s. Ich schloss mich damals der ärztlichen Gesellschaft für autogenes Training und Hypnose an und besuchte zwei, drei Fortbildungen. Eine fand bei der jährlichen medizinischen Tagung in Karlsruhe unter der Leitung von Prof. Langen statt. Da ich in der ersten Reihe saß, holte er mich aufs Podium, um seine hypnotischen Fähigkeiten zu zeigen. Er legte die Fingerspitzen seiner Hände in Schulterhöhe an meinen Rücken und suggerierte mir etwas, dass er mich auffinge, wenn ich nach hinten sinken würde. Ich sank aber nicht nach hinten, ich spürte zu stark seinen Willen, dass ich ihm mehr oder weniger doch absichtlich folgen sollte. Nach kurzer Zeit gab er auf, ich sei nicht hypnotisierbar.
Mich erinnerte dies an Freuds Erlebnis bei Prof. Charcot in Paris vor wahrscheinlich ca. 140 Jahren. Auch hier ließ sich eine Patientin nicht hypnotisieren und Charcot herrschte sie an: „Vous contre suggestionnez“ (Sie suggerieren dagegen)! Freud war empört. Warum sollte sie nicht eine Gegensuggestion haben, wenn sie irgendetwas am Hypnosevorgang störte. Freud beschloss daher die Patienten ohne Hypnose zu behandeln, und auch ich fing damals an Freud zu lesen. Es sollte noch lange dauern, bis ich selbst 1969 eine psychoanalytische Ausbildung begann. Denn ich beschäftigte mich noch lange mit Hypnose und autogenem Training in Theorie und Praxis, bis ich von Freud endgültig überzeugt war. Freud hatte lange mit der Hypnose praktiziert, und leider hat er sie vielleicht zu radikal aus seinem therapeutischen Repertoire entfernt, weil sie hinderliche Formen annahm. Die Patienten haben den hypnotisierenden Therapeuten zu sehr als einen göttlich agierenden Arzt angesehen, sich einem Abhängigkeitsrausch und intensiven kathartischen Erlebnissen hingegeben und damit nicht mehr so engagiert therapeutisch mitgearbeitet.
Freud ließ die Patienten daher frei und möglichst spontan reden, um aus diesen Assoziationen, Einfällen und Phanta