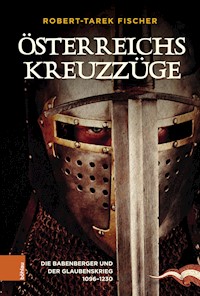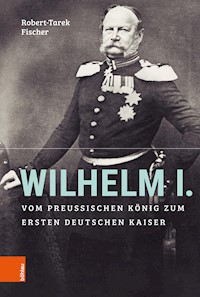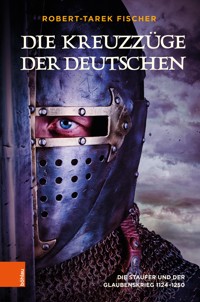
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Böhlau Wien
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Über vier Generationen führten die Staufer riesige Armeen in den Orient. Mit ihren Kreuzzügen schlugen sie tiefe Schneisen in der östlichen Mittelmeerwelt, aber auch in der Heimat. Riefen die Staufer zum Kreuzzug auf, folgten ihnen die Deutschen in enormen Scharen. Für ihren Marsch in den Orient nahmen sie immense Strapazen und Gefahren in Kauf. Mehr als einmal kam es bei den deutschen Kreuzzügen zu einem Massensterben. Dennoch fanden sich in der Ära der Staufer immer wieder Abertausende, die bereit waren, für den Kampf um das Heilige Land alles zu wagen. Der Glaubenskrieg übte auf die Menschen des Hochmittelalters eine Tiefenwirkung aus, von der wir uns heute kaum noch eine Vorstellung machen können. Und die Deutschen standen dabei im Zentrum des Geschehens.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 483
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Robert-Tarek Fischer
Die Kreuzzüge der Deutschen
Die Staufer und der Glaubenskrieg 1124 – 1250
BÖHLAU
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
© 2023 Böhlau, Zeltgasse 1, A-1080 Wien, ein Imprint der Brill-Gruppe
(Koninklijke Brill NV, Leiden, Niederlande; Brill USA Inc., Boston MA, USA; Brill Asia Pte Ltd, Singapore; Brill Deutschland GmbH, Paderborn, Deutschland; Brill Österreich GmbH, Wien, Österreich)
Koninklijke Brill NV umfasst die Imprints Brill, Brill Nijhoff, Brill Hotei, Brill Schöningh, Brill Fink, Brill mentis, Vandenhoeck & Ruprecht, Böhlau, V&R unipress und Wageningen Academic.
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk und seine Teile sind urheberrechtlich geschützt.
Jede Verwertung in anderen als den gesetzlich zugelassenen Fallen bedarf der vorherigen schriftlichen Einwilligung des Verlages.
Umschlagabbildung: © FXQuadro/Shutterstock.com
Korrektorat: Rainer Landvogt, Hanau
Einbandgestaltung: Michael Haderer, Wien
Satz: Michael Rauscher, Wien
EPUB-Erstellung: Lumina Datamatics, Griesheim
Vandenhoeck & Ruprecht Verlage | www.vandenhoeck-ruprecht-verlage.com
ISBN 978-3-205-21820-3
Inhalt
Einleitung
Stammbaum der Staufer-Kreuzritter
Aufbrüche
Der Beginn der Kreuzzugsbewegung | Der Kreuzzug Konrads von Hohenstaufen (1124 – 1125/1127)
Konrad III., Friedrich III. von Schwaben und der Zweite Kreuzzug (1147 – 1149)
Der Ruf Edessas | Von Regensburg ins Byzantinische Reich | Der Weg ins Fiasko | Jerusalem | Vor den Mauern von Damaskus | Trugbild Askalon | Die Konsequenzen des Scheiterns
Friedrich I. Barbarossa, Friedrich VI. von Schwaben und der Dritte Kreuzzug (1189 – 1192)
Der Ruf Jerusalems | Der Mainzer Hoftag Jesu Christi | Barbarossa und der Islam | Der unfreiwillige Kampf gegen Byzanz | Die Schlacht von Ikonion | Tod in Kilikien | Friedrich VI. von Schwaben und die Mauern von Akko | Die Resultate des Dritten Kreuzzuges
Heinrich VI. und der Deutsche Kreuzzug (1197/98)
Der Ruf der Macht | Die Reaktion der Fürsten | Organisation und Aufbruch | Walram von Limburg und der Fall von Jaffa | Heinrich I. von Brabant und der Feldzug nach Beirut | Konrad von Querfurt und die Belagerung von Toron | Deutsche Expansion in den Orient? | Nachwirkungen
Zwischenspiel: Philipp von Schwaben und der Vierte Kreuzzug (1202 – 1204)
Friedrich II. und der Sechste Kreuzzug (1227 – 1229)
Der große Abwesende beim Fünften Kreuzzug (1217 – 1221) | König von Jerusalem | Hermann von Salza und der Aufstieg des Deutschen Ordens | Der Exkommunizierte | Zypern | Der Weg in die Heilige Stadt | Ein eiliger Triumph in der Grabeskirche | Resultate und Konsequenzen
Zusammenbrüche
Der Lombardenkrieg | Friedrichs II. Nachhall in der arabischen Welt | Die Phantomkönige von Jerusalem
Die Deutschen und ihre Kreuzzüge in Skizzen und Schlaglichtern
Die Rolle der Frauen | Otto von Botenlauben und Beatrix von Courtenay | Dichter | Der Wendenkreuzzug von 1147 | Der Barbarossa-Mythos
Anmerkungen
Zeittafel
Quellen- und Literaturverzeichnis
Bildnachweis
Personenregister
Ortsregister
Einleitung
Gerhoch von Reichersberg rang nach Worten, um zu beschreiben, was sich im Frühling 1147 in Süddeutschland abspielte.
Es gab keine Stadt, die nicht eine Vielzahl, kein Dorf oder Landgut, das nicht zumindest wenige entsandte, Bischöfe vereint mit ihren Gemeinden, auch Heerführer samt Gefolge, einzelne Fürsten und Große mit ihren Schwadronen rückten an. Sie führten Schilde, Schwerter und Brustpanzer sowie andere Kriegsgeräte mit sich und waren auch reichlich mit Zelten ausgestattet, die sie mit unzähligen Lastkarren und Pferden transportierten. Zu Lande konnten die Straße und die angrenzenden Felder die Marschierenden, (zu Wasser) der Lauf der Donau die vielen Schiffe kaum fassen.1
Was der altgediente Probst des Stifts Reichersberg nahe der Donau miterlebte, war der Aufbruch der Deutschen zum Zweiten Kreuzzug (1147 – 1149). Es handelte sich um die erste gesamtdeutsche Armee, die sich auf den Weg in den Orient machte, eine kaum überblickbare Masse von Menschen aus allen Gesellschaftsschichten. Neben geistlichen und weltlichen Fürsten, stolzen Ritterverbänden und kampfstarken Fußtruppen gehörten ihr auch mittellose Pilger, Frauen, Abenteurer und Gesetzesbrecher an. Und: An der Spitze dieser kunterbunt gemischten Streitmacht stand ein römisch-deutscher König, nämlich Konrad III. (1138 – 1152), der erste Staufer auf dem Thron.
Das war neu. Und folgenreich.
Bislang waren Kreuzarmeen lediglich von Fürsten angeführt worden. Indem Konrad III. dem päpstlichen Aufruf zum Zweiten Kreuzzug höchstpersönlich folgte, gab er dem 50 Jahre zuvor erstmals entfesselten Glaubenskrieg noch mehr Gewicht, denn die Mitwirkung von gekrönten Häuptern erhöhte die Zugkraft von Kreuzzugszugsappellen und die militärischen Mittel für den Waffengang im Namen Gottes. Zusätzlich gesteigert wurde dieser Effekt durch den Umstand, dass gleichzeitig mit Konrad III. auch der französische König Ludwig VII. (1137 – 1180) dem Kriegsappell des Papstes folgte.
Durch ihren gemeinsamen Aufbruch in den Orient verliehen die zwei Monarchen der Kreuzzugsbewegung auch insofern eine neue Dimension, als sie damit die Epoche der »national geführten Kreuzzüge«2 einleiteten. Denn ohne es konkret geplant zu haben, erlegten Konrad III. und Ludwig VII. späteren europäischen Monarchen mit ihrem Vorbild eine Art moralische Verpflichtung auf, ebenfalls das Kreuz zu nehmen und selbst ins Heilige Land zu ziehen. Nach dem Zweiten Kreuzzug wurden die meisten der großen Orientunternehmen des Hochmittelalters von europäischen Monarchen durchgeführt.
Die Staufer waren in Sachen Kreuzzug besonders aktiv. Nicht weniger als vier Generationen der mythenumrankten Kaiserfamilie nahmen in direkter Abfolge an der Kreuzzugsbewegung teil, und das ausnahmslos mit ihrem jeweiligen Spitzenvertreter. Diese Präsenz beim Glaubenskrieg wurde von keiner europäischen Herrscherdynastie übertroffen.
Wenn die Staufer des 12. Jahrhunderts zum Kreuzzug aufriefen, folgten ihnen riesige Scharen. Konrad III. und seine beiden Nachfolger Friedrich I. Barbarossa (1152 – 1190) und Heinrich VI. (1190 – 1197) geboten über Kreuzarmeen, die jeweils etwa 15.000 Menschen oder mehr umfassten und damit zu den größten Streitmächten des Hochmittelalters gehörten. (Die gewaltige Dimension dieser Heere wird deutlich, wenn man sich vor Augen hält, wie klein die damalige Bevölkerung Europas war. Köln etwa war »mit nahezu 40.000 Einwohnern in der Blütezeit des 13. und 14. Jahrhunderts«3 die größte Stadt im deutschen Sprachraum.)
Für ihren Marsch in den Orient nahmen die deutschen Kreuzfahrer immense Strapazen und Gefahren in Kauf. Ihr Ziel lag am östlichen Ende der damals in Europa bekannten Welt. Um dorthin zu gelangen, hatten sie auf der Landroute, die durch den Balkan und Kleinasien führte, weit über 3000 Kilometer zurückzulegen; die weniger Betuchten unter ihnen mussten die Strecke zu Fuß bewältigen. Auf ihrem langen Weg ins Heilige Land riskierten die Kreuzfahrer, bei Kampfhandlungen ums Leben zu kommen, sich mit tödlichen Krankheiten zu infizieren, zu verhungern, zu verdursten oder vor schierer Erschöpfung zugrunde zu gehen. Mehr als einmal kam es bei den deutschen Kreuzzügen zu einem Massensterben. Dennoch fanden sich in der gesamten, über 100 Jahre dauernden Epoche der Staufer immer wieder Tausende und Abertausende von Menschen, die diesen Weg antraten. Der Glaubenskrieg übte auf die Menschen des Hochmittelalters eine Tiefenwirkung aus, von der wir uns heute kaum noch eine Vorstellung machen können.
Auch die Staufer blieben von den kreuzzugsbedingten Gefahren nicht verschont. Bei den ersten beiden Kreuzzügen, die sie anführten, bezahlten alle drei daran beteiligten Familienmitglieder einen hohen Preis. Zwei von ihnen verloren ihr Leben, einer kehrte mit zerrütteter Gesundheit in die Heimat zurück. Doch obwohl den Staufern die mit dem Marsch in den Orient verbundenen Unwägbarkeiten durchaus bewusst waren, nahmen sie dieses Wagnis immer wieder auf sich. Die Gründe, die sie dazu bewogen, waren durchaus unterschiedlicher Natur. Neben dem religiösen Faktor spielten bei ihrer Entscheidung zum Kreuzzug auch Verpflichtungen und Zwänge mit, denen sie sich nicht entziehen konnten. Nicht selten kamen auch politische Erwägungen und höchst irdisches Machtdenken hinzu, inbesondere die Überlegung, durch ihren Einsatz für Jerusalem die imperiale Stellung zu stärken und auszubauen.
Eine Besonderheit der Kreuzzüge Konrads III. und seiner ersten beiden Nachfolger war, dass sie ihre Kreuzarmeen lange Zeit nur im deutschen Raum rekrutierten. Eigentlich geboten sie als Herrscher des Heiligen Römischen Reiches über eine viel umfangreichere Ländermasse, die bis nach Mittelitalien, ab 1194 sogar bis an die Südspitze Siziliens reichte. Auch machten sie mehrfach deutlich, dass sie ihre Kreuzzüge zur »Ehre des Reichs« (honor imperii) unternahmen. Dennoch betrieben die Staufermonarchen des 12. Jahrhunderts keine großflächigen Anwerbungsaktivitäten südlich der Alpen, sondern ließen das Kreuz auf Reichs- und Hoftagen in deutschen Städten wie Worms, Mainz, Regensburg oder Gelnhausen predigen.
Dieses Vorgehen hatte vor allem praktische Gründe; die Bildung einer gesamtstaatlichen Armee wäre in einem Reich, das eine Nord-Süd-Ausdehnung von über 2000 Kilometern aufwies, mit den begrenzten Mitteln, die den Menschen des Hochmittelalters auf verkehrstechnischer und kommunikativer Ebene zur Verfügung standen, kaum zu machen gewesen. Hinzu kam, dass die beiden ersten Kreuzzüge der Staufer über die Donauroute und damit weit entfernt vom italienischen Reichsteil in Richtung Orient zogen, was die Einbeziehung italienischer Kreuzritter zusätzlich erschwert hätte.
Die quasi notgedrungen auf Deutschland zentrierte Truppenrekrutierung hatte zur Folge, dass die Kreuzzüge der Staufer eine deutsch-»nationale«4 Schlagseite bekamen. Auf innenpolitischer Ebene machte sich dies im späten 12. Jahrhundert brisant bemerkbar, als eine staufische Kreuzarmee erstmals durch Italien zog und gegen dortige Aufständische eingesetzt wurde. Nach außen wurde der »nationale« Faktor noch viel früher spürbar, denn bei den Kreuzzügen kam es immer wieder vor, dass Truppen aus unterschiedlichen europäischen Staaten miteinander kooperieren mussten, was oft zu erheblichen Reibereien führte, die sich um den Anspruch auf kriegerischen Ruhm oder materielle Besitztümer, aber auch um Eigenheiten drehten, die man bei der Gegenseite wahrnahm, als störend empfand und über die man in Streit geriet.
Die Truppen aus dem deutschen Sprachraum wurden bei diesen Gelegenheiten von Anfang an nicht als Krieger des Heiligen Römischen Reiches, sondern eben als Deutsche (alemanni bzw. teutonici) wahrgenommen, und das in konfliktbeladenem Kontext: Der deutsche Chronist Ekkehard von Aura etwa ortete zwischen deutschen und französischen Rittern bereits beim Ersten Kreuzzug eine »Abneigung, die gewissermaßen von Natur aus«5 vorhanden gewesen sei. Der englische Autor des Itinerarium peregrinorum et gesta regis Ricardi berichtete bei seiner Beschreibung des Dritten Kreuzzuges von »einem alten und hartnäckigen Streit der Deutschen mit den Franzosen, den sie um den Primat des Königtums und des Imperiums austrugen.«6 Selbst bei gemeinsam geführten Kämpfen kamen die Reibereien zuweilen nicht zur Ruhe; laut dem byzantinischen Chronisten Johannes Kinnamos verhöhnten die französischen die deutschen Ritter, weil diese bei einem Angriff zu Pferd in die gegnerischen Reihen hineineinsprengten, dann aber zu Fuß weiterzukämpfen pflegten.7
Das spannungsgeladene Miteinander führte auch dazu, dass die Christenvölker einander mit oft wenig schmeichelhaften Charaktereigenschaften bedachten, die sich im Lauf der Zeit zu Stereotypen verfestigten. Als beim Dritten Kreuzzug Truppen des englischen Königs Richard I. Löwenherz führend in Erscheinung traten, schrieben die deutschen Kreuzfahrer ihre eigenen Misserfolge bei der Belagerung von Akko der »englischen Perfidie«8 zu, wie Otto von St. Blasien berichtet. Bei den deutschen Kreuzfahrern ortete man oft ungezügelte Wildheit im Kampf.9 Der berühmte Begriff furor teutonicus wurde in der Zeit der Kreuzzüge von Chronisten des Öfteren aufgegriffen und bekam dadurch geradezu sprichwörtlichen Charakter.10
Die Misshelligkeiten zwischen den aus unterschiedlichen Staaten kommenden Kreuzfahrern führten nicht nur zu Streitereien, sondern auch zur Schärfung der eigenen Identität, aus der ein glühender Patriotismus erwachsen konnte. Der Kleriker und Geschichtsschreiber Johannes von Würzburg etwa, der in den 1160er Jahren eine Pilgerfahrt ins Heilige Land unternahm, beklagte das seiner Meinung nach viel zu geringe Ansehen, das seine Landsleute in der Heiligen Stadt genossen. Die Erstürmung der Stadt am Ende des Ersten Kreuzzuges werde nicht den Deutschen, »die nicht wenig für diesen Feldzug gearbeitet und gerungen haben, sondern allein den Franzosen zugeschrieben«, eine »Geringschätzung gegenüber unseren Männern«11, die den Kleriker fassungslos machte. Höchst bedauernswert fand Johannes von Würzburg außerdem, dass die Heilige Stadt nicht allzu viele deutsche Bewohner hatte – ein Zustand, der auch dem Königreich Jerusalem geschadet habe: »Gewiss hätte dieses Staatsgebiet des Christentums seine Grenzen schon längst südwärts über den Nil und nordwärts über Damaskus hinaus ausgedehnt, wenn es hier so viele Deutsche wie diese da [Anm.: Vertreter anderer christlicher Völker] geben würde.«12
Johannes von Würzburg blieb mit seinem hochpatriotischen Standpunkt nicht alleine. Die Stärkung der deutschen Position im Heiligen Land wurde ab dem späten 12. Jahrhundert immer mehr auch zu einer politischen Zielsetzung. Der Kreuzzug Kaiser Heinrichs VI. 1197/98 war nicht zuletzt vom Bestreben geprägt, vermehrt Menschen aus dem deutschen Raum in Palästina anzusiedeln; mit der Gründung des Deutschen Ritterordens 1198 in Akko wurde außerdem den einflussreichen Ritterorden der Templer und Johanniter, in denen die Deutschen kaum vertreten waren, eine vergleichbare, eindeutig als deutsch deklarierte Institution (Ordo Teutonicus) entgegengesetzt, deren Name Programm war. Friedrich II. (1212 – 1250), der Sohn Heinrichs VI., ging noch weiter und bewirkte nicht nur einen massiven Machtzuwachs des Deutschen Ordens im Heiligen Land, sondern setzte bei seinem Kreuzzug 1228/29 überdies auch einiges daran, das Königreich Jerusalem seiner direkten Herrschaft zu unterstellen, ein Vorhaben, das in der Region einen 15 Jahre dauernden Bürgerkrieg zur Folge hatte.
Die deutschen Kreuzzüge wurden unter sehr unterschiedlichen Rahmenbedingungen unternommen und führten zu sehr unterschiedlichen Resultaten. Konrad III., der erste Staufer auf dem Thron, handelte bei seinem Orient-Unternehmen noch in vollem Einvernehmen mit dem Papsttum, Friedrich II., der letzte staufische Kaiser, unternahm seinen Kreuzzug als Exkommunizierter und führte einen machtpolitischen Überlebenskampf gegen die Kurie. Konrad III. zog ohne erkennbare Expansionsbestrebungen ins Heilige Land, Friedrich II. und sein Vorgänger Heinrich VI. peilten eine Vormachtstellung im östlichen Mittelmeerraum an. Die deutschen Kreuzzüge führten zu katastrophalen Fehlschlägen und zu erstaunlichen Erfolgen. Ihnen allen gemein war jedoch, dass sie zu den absolut erstrangigen Feldzügen zählten, die das Abendland im Hochmittelalter gegen den Orient in Szene setzte. Die Ära der Kreuzzüge ist ohne die Deutschen nicht denkbar. Sie hätte ohne deren ebenso zahlenstarke wie intensive Beteiligung einen anderen Verlauf genommen.
* * *
Dieses Buch handelt von einer Zeit, die heute in mancherlei Hinsicht fremdartig erscheinen mag, von einer Zeit, in der die Geburtsdaten selbst hochrangiger Persönlichkeiten wie Friedrich Barbarossa nicht festgehalten wurden, von einer Zeit, in der Herrscherbildnisse eine Seltenheit waren, von einer Zeit, deren Wertvorstellungen mit dem heutigem Wertekompass kaum nachvollziehbar sind, von einer Zeit aber auch, die sich der heutigen Betrachtung nur sehr unvollständig erschließt: Die Kreuzzüge sind in extrem unterschiedlicher Qualität überliefert. Während etwa der Dritte Kreuzzug von zahlreichen zeitgenössischen Chronisten dokumentiert wurde, von denen manche das Geschehen als Augenzeugen miterlebten, gibt es vom Kreuzzug Kaiser Heinrichs VI. nur lückenhafte zeitgenössische Berichte, die fast zur Gänze nicht aus erster Hand stammen und weiten Raum für Spekulationen darüber lassen, wie sich maßgebliche Handlungsabläufe tatsächlich zutrugen.
Gerade das Orientunternehmen Heinrichs VI. verdeutlicht aber auch, dass die deutschen Kreuzzüge in ihrer Bedeutung unterschätzt werden. Das zeigt sich schon bei der Zählung der Kreuzzüge. Die Geschichtswissenschaft wertet in der Regel sieben von ihnen als offizielle Kreuzzüge, darunter auch den völlig ergebnislosen Feldzug des französischen Königs Ludwig IX. (1226-1270) gegen das von Jerusalem weit entfernte Tunis (1270). Der Kreuzzug Heinrichs VI. hingegen scheint in dieser offiziellen Zählung nicht auf, und das, obwohl er im Herzland der Kreuzzugsepoche, dem Heiligen Land, stattfand und zu bedeutenden Teilerfolgen führte. Auch in allgemeingeschichtlichen Werken über die Kreuzzüge wurde der Kreuzzug Heinrichs VI. mehrfach nur am Rande erwähnt, eine Tendenz, die vor allem bei der britischen Geschichtswissenschaft deutlich wird.13 Hinterfragenswert ist in diesem Kontext ebenso, warum der Kreuzzug von Damiette und der Kreuzzug Kaiser Friedrichs II. in Deutschland oft als Fünfter Kreuzzug subsumiert werden. Nicht nur, dass zwischen den beiden Unternehmungen geschlagene sieben Jahre lagen, sie wurden größtenteils auch in unterschiedlichen Regionen des Orients – erstere hauptsächlich im Nildelta, letztere in Palästina – durchgeführt. Vor allem aber zeitigte der Kreuzzug Friedrichs II. derart bedeutende Ergebnisse, dass dessen Charakterisierung als gänzlich eigenständiger Kreuzzug mehr als naheliegend wäre.
Die Tendenz, den deutschen Kreuzzügen möglichst wenig Bedeutung beizumessen, mag in früheren Zeiten von patriotisch gefärbten Absichten geprägt gewesen sein. Heute kann sie auch als Verharmlosung gelten. Beides ist im Hinblick auf die Orientfeldzüge der Staufer nicht angebracht.
Dafür waren die Schneisen, die sie damit sowohl in der Heimat als auch im Orient schlugen, zu tief.
Stammbaum der Staufer-Kreuzritter
Aufbrüche
Der Beginn der Kreuzzugsbewegung
Urban II. (1088 – 1099) hatte es angekündigt. Am Ende der Synode von Clermont werde er eine bedeutende Rede halten, so der Papst.
Bei der Geistlichkeit und den Laien sorgte die Verlautbarung für viel Aufregung. Der Andrang war so groß, dass der Pontifex seine Rede unter freiem Himmel halten musste.
Was sein Publikum an jenem 27. November 1095 dann zu hören bekam, verdeutlichte rasch, dass der Papst nicht übertrieben hatte: In einer flammenden Ansprache forderte Urban II. die in unzählige Fehden verstrickte Ritterschaft auf, ihren kriegerischen Tatendrang gottgefälligen Zielen zuzuwenden und die Christen im Osten von ihrer angeblich grausamen Unterdrückung durch den Islam zu befreien.
Dem Aufruf des Papstes ging eine im Frühling des Jahres an ihn gerichtete Bitte des byzantinischen Kaisers voran. Alexios I. Komnenos (1081 – 1118) hatte um militärische Unterstützung gegen die Seldschuken gebeten, denen es in den vergangenen Jahrzehnten gelungen war, weite Teile Kleinasiens zu erobern und ihre Macht bis in die Nähe der kaiserlichen Hauptstadt Konstantinopel auszudehnen. Der Kaiser wollte eine Gegenoffensive unternehmen, benötigte dazu aber Truppenhilfe aus dem Abendland.
Beim Papst erzeugte Alexios I. eine viel stärkere Resonanz als erwartet. Denn während der byzantinische Kaiser lediglich an die Entsendung einer Söldnertruppe dachte, um seinen Kampf gegen den seldschukischen Sultan Kilidsch Arslan I. (1092 – 1107) mit größeren Erfolgsaussichten führen zu können, entfesselte Urban II. einen Krieg, der sich gegen die gesamte muslimische Welt im östlichen Mittelmeerraum richtete.
Aus der Sicht Urbans II. gab es für dieses gigantische Unterfangen mehrere Gründe. Zu dem Wunsch, die kriegerischen Energien der fehdefreudigen Ritter in eine andere Richtung zu lenken, kam die Absicht, die Grenzen des Christentums mit Waffengewalt auszudehnen, sowie vielleicht auch die Vorstellung, im Zuge eines großangelegten Glaubenskrieges die Kirchenspaltung des Jahres 1054 rückgängig machen zu können.
In zwei Hinsichten wollte der Papst das Unternehmen aber auch begrenzt wissen: Es sollte von jener Schicht durchgeführt werden, der ein militärischer Erfolg am ehesten zuzutrauen war, eben der Ritterschaft. Außerdem hatte seine Botschaft auch in geographischer Hinsicht klare Adressaten – Urban II. verkündete sie in einer französischen Stadt, bei einer Synode, die hauptsächlich von französischen Bischöfen besucht wurde, und er sprach hauptsächlich die französische Ritterschaft an.
Urban II., der selbst gebürtiger Franzose war, handelte damit nicht unbedingt patriotisch, sondern vor allem hochpolitisch. Denn bei seinen Überlegungen hinsichtlich des Kreuzzuges spielte auch der Investiturstreit geradezu zwangsläufig eine Rolle. 1084 war Papst Gregor VII. (1073 – 1085) im Kampf gegen den römisch-deutschen Monarchen Heinrich IV. (1056 – 1105) aus Rom geflohen; Urban II. hatte sein Pontifikat im Exil beginnen müssen, gegenüber dem von Heinrich IV. installierten Gegenpapst in mühevoller Kleinarbeit wieder an Terrain gewonnen und war erst Ende 1094 imstande gewesen, wieder nach Rom zurückzukehren. Bei dem wenig später proklamierten Kreuzzug schwang der Wunsch mit, auf diese Weise die vom römisch-deutschen Kaiser bedrohte Autorität der Kirche als oberste Institution der Christenheit zu festigen und auszubauen; es war kein Zufall, dass für den vom Papst proklamierten Kreuzzug hauptsächlich in Frankreich geworben wurde. Für sein Vorhaben konnte es nicht zweckmäßig sein, wenn starke deutsche Kräfte oder gar der Kaiser selbst am Kreuzzug teilnahmen und damit die päpstliche Führungsrolle bei dieser Unternehmung in Frage stellten.
Der Papst vermochte sein Vorhaben allerdings von Anfang an nicht so sehr zu begrenzen, wie er sich das vorgestellt hatte. Mit seiner Ansprache und der darauf folgenden Kreuzzugswerbung erzielte Urban II. eine Resonanz, die seine Vorstellungen bei Weitem übertraf. Seine Botschaft des Heiligen Krieges erreichte nicht nur den Ritterstand, dem man einen erfolgreichen Orient-Feldzug am ehesten zutrauen konnte, sondern wurde außerdem von selbsternannten Predigern im Volk verbreitet und stieß dort auf Begeisterung. Die Aufforderung Urbans II., eine bewaffnete Pilgerfahrt zu unternehmen, die ein Akt der Buße sein sollte, also ein Akt, mit dem man sich von den begangenen Sünden befreien konnte, sprach zahllose Menschen in unwiderstehlicher Art und Weise an. Außerdem kristallisierte sich mit Jerusalem sehr rasch ein Marschziel heraus, das für die Zeitgenossen eine magische Anziehungskraft besaß. Die Heilige Stadt, wo Jesus Christus den Kreuzestod erlitten hatte und wiederauferstanden war, beflügelte die Phantasie, ebenso die Vorstellung, die Wiege der Christenheit vom vermeintlichen Joch der Muslime zu befreien. Für viele gab es aber auch höchst weltliche Gründe, den langen Marsch ins Ungewisse anzutreten. So litt das Bauerntum in weiten Teilen des Abendlandes bittere Not, wurde seit Längerem von Seuchen heimgesucht und von Hungersnöten geplagt. Nicht wenige Menschen der ärmeren Bevölkerungsschichten dürften den Kreuzzug auch als Chance begriffen zu haben, ihrer Not zu entkommen.
Binnen weniger Monate nahm ein vom Papst keineswegs geplanter Volkskreuzzug Gestalt an. Insbesondere in Frankreich und im Nordwesten des Heiligen Römischen Reiches verließen Zigtausende von Menschen – Bauern, Städter, Abenteurer, Verbrecher, Frauen, Kinder und vereinzelte Ritter – ihre Heimstätten. Im Frühling 1096, als sich die von Urban II. anvisierten Ritterheere erst formierten, marschierten bereits fünf große Pilgerhorden los nach Südosten. Mitte April zog der französische Ritter Walter ohne Habe mit einigen Tausend Franzosen los, unmittelbar darauf machte sich Peter der Einsiedler in Köln mit einer noch größeren Menschenmasse auf den Weg. Ihnen folgten wenig später drei weitere Pilgerschübe, unter ihnen auch die wilde Horde des Adeligen Emicho von Leiningen, die im Rheintal mit mehreren Massakern an Juden Angst und Schrecken verbreitete, ehe sie im Juni 1096 ebenfalls in Richtung Orient abmarschierte.
Die ungeordneten Horden des Volkskreuzzuges kamen nicht einmal in die Nähe ihres fernen Ziels. Manche, unter ihnen auch Emichos blutrünstiger Haufen, wurden nach Plünderungen bereits im Königreich Ungarn von Regierungstruppen niedergemacht. Andere erreichten zwar Kleinasien, gingen dort aber im Kampf gegen die Truppen des seldschukischen Sultans Kilidsch Arslan I. unter.
Während der Volkskreuzzug unterging, brachen die von Urban II. anvisierten Ritterheere auf. Sie zogen auf unterschiedlichen Wegen an den Bosporus und vereinigten sich zu einer gewaltigen Streitmacht. Auch deren Zusammensetzung sah anders aus als vom Papst gewünscht. An der Spitze der Ritterarmeen standen nicht nur Fürsten aus dem französischen Raum, sondern mit Bohemund von Tarent auch ein mächtiger Feudalherr aus Süditalien. Überdies machte sich ein namhafter Untertan des römisch-deutschen Kaisers auf den Weg: Gottfried von Bouillon, der Herzog von Niederlothringen.
In späteren Jahrhunderten wurde Gottfried von Bouillon nicht selten als ultimative Heldengestalt des Ersten Kreuzzuges oder gar der gesamten Kreuzzugsepoche dargestellt.14 Manche priesen ihn auch als deutschen Helden, so etwa der eingangs erwähnte im 12. Jahrhundert lebende Kleriker und Geschichtsschreiber Johannes von Würzburg, der Gottfried von Bouillon vollmundig als »Haupt und Leiter«15 des Ersten Kreuzzuges bezeichnete, der eine nur aus Deutschen bestehende Armee angeführt habe.
Mit der historischen Realität passten derartige Aussagen, die später oft wiederholt wurden, wenig bis gar nicht zusammen. In Wahrheit machte sich der Umstand, dass Niederlothringen eine Grenz- und Übergangsregion zwischen Frankreich und dem deutschen Teil des Heiligen Römischen Reiches war, bei der Kreuzarmee Gottfrieds von Bouillon deutlich bemerkbar. Ihr gehörten sowohl Deutsche als auch Franzosen an,16 und es war kein konfliktfreies Miteinander. Vielmehr kam es zwischen ihnen immer wieder zu erheblichen Spannungen, die dem Herzog einige Probleme bereiteten. Wie aus dem Bericht des zeitgenössischen Chronisten Ekkehard von Aura hervorgeht, musste Gottfried von Bouillon mehrfach schlichtend eingreifen und die Eifersüchteleien zwischen deutschen und französischen Rittern »mit seinem angenehmen Witz« und »der ihm eigenen Kenntnis beider Sprachen«17 besänftigen.
Bei Johannes von Würzburg wird von solchen Dingen nichts erwähnt, und er leistete sich zudem auch noch eine vielsagende Unschärfe. In seinem Bericht beschwerte sich der Kleriker, nach dem Ersten Kreuzzug hätten »andere Völker« der Christenheit ganz Jerusalem in Beschlag genommen und den Deutschen keinen Platz in der Heiligen Stadt gelassen. Zu diesen anderen Völkern zählte er Franzosen, Italiener, Spanier – und auch Lothringer.18 Dass diese dem Heiligen Römischen Reich angehörten, ließ Johannes von Würzburg ebenso unter den Tisch fallen wie den Umstand, dass Gottfried von Bouillon selbst aus Lothringen stammte.
Stark übertrieben war auch die oftmalige Aussage, Gottfried von Bouillon habe den Ersten Kreuzzug angeführt. Beim ungeheuer strapaziösen und verlustreichen Vormarsch der vereinigten Kreuzarmee durch Kleinasien hatten in Wahrheit andere das Sagen, vor allem Graf Raimund IV. von Toulouse und Bohemund von Tarent. Unter ihrer Führung bereiteten die Kreuzritter dem auf die christliche Invasion nicht vorbereiteten Kilidsch Arslan I. schwere Niederlagen und stießen unter massiven Verlusten nach Syrien vor. Dort blieben sie weiter siegreich, wobei ihnen die staatliche Zersplitterung der Muslime sehr zugutekam. Gottfrieds jüngerer Bruder Balduin von Boulogne schuf 1098 mit der Grafschaft Edessa den ersten Kreuzfahrerstaat im Orient. Bohemund von Tarent setzte sich im selben Jahr nach der mehrmonatigen Belagerung von Antiochia als neuer Herrscher der großen nordsyrischen Metropole durch und gründete mit dem Fürstentum Antiochia den zweiten Kreuzfahrerstaat.
Die historische Stunde des Gottfried von Bouillon schlug erst am 15. Juli 1099, als ihm zusammen mit Raimund IV. von Toulouse die Eroberung Jerusalems glückte, die ein Massaker an den Bewohnern der Heiligen Stadt zur Folge hatte. Gottfried von Bouillon setzte sich gegenüber dem ungeschickt taktierenden Raimund IV. als neuer Herr der Stadt durch, lehnte es aus Demut vor Gott jedoch ab, sich in der Heiligen Stadt zum König erheben zu lassen. Vorläufig sicherte er das neue Staatswesen durch einen Sieg über die ägyptischen Fatimiden und die Eroberung mehrerer Küstenstädte ab, musste dann aber zusehen, wie die meisten Krieger des Ersten Kreuzzuges bald nach diesen Anfangserfolgen wieder die Heimreise antraten. Binnen weniger Monate schrumpfte seine Streitmacht auf etwa 300 Ritter und 2000 Fußsoldaten zusammen.
Gottfried von Bouillon starb nach nur einjähriger Herrschaft über Jerusalem im Juli 1100. Zu diesem Zeitpunkt war die neu errichtete Herrschaft der Franken, wie man die westlichen Invasoren in der muslimischen Welt nannte, noch keineswegs gesichert.19
Unterdessen baute sich in Europa aber schon eine neue Kreuzzugswelle auf. Urban II. hatte im Bewusstsein, dass es viele weitere Soldaten und vor allem Siedler brauchte, um die Position der westlichen Christen im Orient zu festigen, nach dem Abmarsch des Ersten Kreuzzuges weiter den Glaubenskrieg gepredigt, und sein Nachfolger Paschalis II. (1099 – 1118) war in seine Fußstapfen getreten. Die Eroberung Jerusalems begünstigte ihre Bemühungen. Dass die Heilige Stadt nach mehr als vier Jahrhunderten muslimischer Herrschaft nun wieder christlicher Kontrolle unterstand, sorgte im Abendland für Begeisterung und verlieh der kriegerischen Botschaft des Papsttums abermals starke Schubkraft.
Vier neue Armeen formierten sich. Im Herbst 1100 zogen Streitkräfte aus der Lombardei ins Byzantinische Reich. Im Frühling 1101 folgten ein Heer unter der Führung des ostfranzösischen Grafen Wilhelm II. von Nevers sowie eine südfranzösische Armee unter Herzog Wilhelm IX. von Aquitanien. Und auch diesmal machte sich wieder ein deutscher Reichsfürst auf den Weg: Herzog Welf IV. von Bayern (1070 – 1077, 1096 – 1101). Er blickte auf eine lange, turbulente Karriere zurück, hatte im Investiturstreit gegen Heinrich IV. Partei ergriffen, seine Herzogswürde für fast zwei Jahrzehnte verloren, sich aber schließlich mit dem Monarchen ausgesöhnt und Bayern wiedererlangt. Nach mittelalterlichen Maßstäben hochbetagt – Welf IV. stand in seinem siebenten Lebensjahrzehnt –, gedachte der Herzog am Ende seines Lebens eine fromme Tat zu tun und sich dem Kampf um das Heilige Land anzuschließen.20
Welf IV. setzte auf Zusammenarbeit. Als Wilhelm IX. von Aquitanien mit seiner Streitmacht durch Süddeutschland zog, kam der Bayer mit ihm überein, den Marsch in den Orient zusammen zu unternehmen. Laut dem Chronisten Ekkehard von Aura, der sich im Gefolge Welfs IV. befand, umfasste die Doppelarmee 100.000 Menschen;21 ein anderer Chronist, Albert von Aachen, spricht sogar von 160.000 Kreuzfahrern.22 Zweifelsohne handelte es sich dabei um weit übertriebene Zahlen; die hochmittelalterlichen Chronisten waren in der Regel kaum um Präzision bemüht, wenn es darum ging, den Umfang von Kreuzarmeen zu beziffern. Ekkehard von Aura und Albert von Aachen waren diesbezüglich keine Ausnahmen.23 Es ist allerdings davon auszugehen, dass Welf IV. und Wilhelm IX. die stärkste Streitmacht des neuen Kreuzzuges anführten.
Auf byzantinischem Gebiet begannen die Kreuzfahrer zu plündern, was zu mehreren Zusammenstößen mit Einheimischen führte. Als Kaiser Alexios I. ihnen mit starken Streitkräften Einhalt zu gebieten versuchte, eskalierte die Lage. Geht es nach den deutschen Chronisten, waren dafür allein die Aquitanier verantwortlich. Ekkehard von Aura berichtet, bei ihnen sei, als ihnen der Durchmarsch durch Adrianopel verwehrt wurde, »der ihnen angeborene Stolz aufgewallt«24, sie hätten die Stadt daraufhin angegriffen und deren Umgebung mit Feuer verwüstet. Ebenfalls auf diesen Vorfall Bezug nehmend, nennt Albert von Aachen die Untertanen Wilhelms IX. ein »ungezügeltes und unverbesserliches Volk«, das an der Blockade von Adrianopel selbst schuld gewesen sei, weil es zuvor dem Anführer der Bulgaren »mannigfaltiges Unrecht«25 zugefügt habe. Nach hastigen Verhandlungen erzielten die Streitparteien eine Einigung, und die Herzöge setzten ihren Marsch nach Konstantinopel fort, von Streitkräften des Kaisers nun freilich scharf bewacht. Anfang Juni trafen sie am Bosporus ein und lagerten dort mehrere Wochen.
Die Armeen des Kreuzzuges von 1101 waren in Summe von stattlicher Dimension und kamen in dieser Hinsicht ihren Vorgängern durchaus nahe. Im Gegensatz zu den Rittern des Ersten Kreuzzuges begingen sie jedoch den Fehler, in Anatolien getrennt voneinander vorzurücken, außerdem fehlten ihnen herausragende Feldherren vom Schlage eines Bohemund von Tarent oder Balduin von Boulogne. Hinzu kam, dass Sultan Kilidsch Arslan I. aus seinen Niederlagen von 1097 gelernt, sich auf die westliche Kampfweise eingestellt und seine militärische Strategie entsprechend modifiziert hatte. Sie zielte nunmehr verstärkt darauf ab, die Gegner tief ins hitzestarrende Anatolien zu locken, sie durch Entzug von Nahrungsmittel- und Wasserressourcen sowie mit regelmäßigen Reiterattacken zu schwächen und erst dann die volle Schlagkraft seiner Truppen einzusetzen.
Die Taktik des Sultans ging voll und ganz auf. Im Juli 1101 schlug er die von Hunger, Durst und ständigen muslimischen Kavallerieangriffen gepeinigten Lombarden in Nordanatolien vernichtend, wenig später die ebenso zermürbten Streitkräfte Wilhelms II. von Nevers bei Herakleia im Süden Anatoliens. Und auch die aquitanisch-bayerische Doppelarmee marschierte schnurstracks ins Verderben. Kaum in seldschukisches Gebiet eingerückt, wurden sie permanent unter Druck gesetzt. Wieder und wieder attackierten Kilidsch Arslan I. und seine Verbündeten die Nachhut der Doppelarmee, deckten die Christen aus sicherer Entfernung mit Pfeilhageln ein, unternahmen nächtliche Überfälle auf ihr Lager, verstopften Quellen und Zisternen und legten Feuer, wenn die Kreuzarmee durch ausgetrocknetes Grasland zog. Die Kreuzfahrer verwüsteten im Gegenzug zahlreiche Orte entlang ihrer Marschroute, doch gegen die wendigen gegnerischen Berittenen fanden die schwer gepanzerten Ritter kein Mittel. Mühselig schleppte sich die aquitanisch-bayerische Streitmacht weiter nach Südosten. Anfang September wurde sie bei Herakleia in einen Hinterhalt gelockt und ebenfalls vernichtend geschlagen. Nur Wilhelm IX. und Welf IV. gelang es mit einigen wenigen Gefolgsleuten, dem Inferno zu entkommen.
Das Fiasko der aquitanisch-bayerischen Streitmacht machte den Kreuzzug von 1101 vollends zu einem Fehlschlag. Lediglich ein paar versprengte Gruppen der vier besiegten Kreuzarmeen trafen schließlich in Palästina ein. Sie waren bei Weitem nicht groß genug, um dem Kreuzfahrerstaat nennenswerte militärische Unterstützung zu geben. Und auch der mit dem Kreuzzug von 1101 zu erwartende Zuwanderungsschub unterblieb weitgehend. Statt Tausenden kamen nur wenige Ansiedler ins Heilige Land, die noch kleine fränkische Bevölkerung in der Region erfuhr keine echte Vergrößerung.
In Europa wirkte der desaströse Fehlschlag von 1101 wie eine kalte Dusche. Die Kreuzzugsbewegung, die nach Urbans II. epochaler Ansprache von Clermont so wild aufgeflammt war, verlor an Durchschlagskraft. Von einem weiteren großen Feldzug des Abendlands in den Orient konnte jahrzehntelang keine Rede mehr sein.
Im süd- und mitteldeutschen Raum wirkte der Kreuzzug Welfs IV. als abschreckendes Ereignis nach. Fast alle bayerischen Kreuzfahrer waren in Kleinasien umgekommen, und auch ihr Anführer hatte das Fiasko nicht lange überlebt; Herzog Welf IV. war bei der Heimfahrt von Palästina auf Zypern gestorben.26 Um manche der prominentesten Gefolgsleute Welfs IV., die vom Kreuzzug nicht zurückkehrten, begannen sich düstere Mythen zu ranken. Über die österreichische Markgräfin Ida aus dem Geschlecht der Babenberger erzählte man sich, sie sei auf dem Schlachtfeld von Herakleia entführt und von einem muslimischen Fürsten geschwängert worden.27 Von Erzbischof Thiemo von Salzburg hieß es, er sei während der Schlacht von Herakleia in muslimische Gefangenschaft geraten, habe ein Götzenbild reparieren müssen, es in religiös bedingter Empörung zerstört und daraufhin ein grausames Martyrium erlitten.28
Den Kreuzfahrerstaaten gelang es trotz des Fehlschlags von 1101, ihre Positionen im Orient zu behaupten. Insbesondere die anfänglich noch sehr fragile fränkische Herrschaft über Jerusalem und Umgebung kräftigte sich erheblich. Nicht unwesentlich ging diese Entwicklung auf Balduin von Boulogne zurück, den jüngeren Bruder und Nachfolger des im Juli 1100 verstorbenen Gottfried von Bouillon, der im Gegensatz zu diesem keine Skrupel hatte, sich in der Heiligen Stadt unverzüglich krönen zu lassen. König Balduin I. (1100 – 1118) lenkte die Geschicke des jungen Kreuzfahrerstaates fortan mit offensiver Energie, Bedenkenlosigkeit und scharf kalkulierendem politischem Sachverstand. Binnen weniger Jahre warf er trotz zahlenmäßiger Unterlegenheit mehrere Angriffe der ägyptischen Fatimiden zurück – wobei ihm zumindest einmal auch schieres Glück zu Hilfe kam –, wandelte sein kleines Reich in ein funktionstüchtiges Staatswesen um und erweiterte es mit der Eroberung mehrerer Hafenstädte wie Akko und Jaffa entscheidend.
Die dünne Personaldecke blieb für Balduin I. und seine Nachfolger allerdings weiterhin ein Problem. Es war dermaßen ausgeprägt, dass man selbst Pilger, die eigentlich nur aus Glaubensgründen in die Heilige Stadt kamen, zu militärischen Aufgaben heranzog. Besonders gerne griffen die Könige von Jerusalem auf so genannte milites ad terminum zurück, europäische Ritter, die ihre Frömmigkeit demonstrierten, indem sie sich temporär als Krieger für das Königreich Jerusalem betätigten.29
Unter diesen Kämpfern auf Zeit befand sich auch ein deutscher Fürstensohn, der später als erster Staufer auf dem Thron Geschichte schreiben sollte.
Der Kreuzzug Konrads von Hohenstaufen (1124 – 1125/1127)
Konrad von Hohenstaufen machte in den 1120er und 1130er Jahren mehrfach mit ungewöhnlich großem Ehrgeiz von sich reden.
Das war durchaus eine Leistung, denn hochfahrende Ambition zählte im Hochmittelalter gewissermaßen zur Grundausstattung der Aristokratie. Konkurrenzkämpfe um Macht, Besitz und Ehre standen im 12. Jahrhundert auf der Tagesordnung des politischen Lebens, Ehrgeiz gehörte »untrennbar zum Habitus des Adels«30. Konrad aber fiel mit seinen Ambitionen selbst in diesem alles andere als zurückhaltenden Umfeld auf. 1127 sorgte er erstmals für einen weithin hörbaren Paukenschlag, als er sich zum König ausrufen ließ und damit den regierenden Monarchen Lothar III. (1125 – 1137) herausforderte. Sein Vorstoß war umso aufsehenerregender, als er lediglich ein Zweitgeborener war und die Rolle als Gegenkönig eigentlich seinem höherrangigen Bruder zugestanden hätte.
Ehrgeiz war Konrad in besonders starkem Ausmaß in die Wiege gelegt worden. Er entstammte einer schwäbischen Adelsfamilie, die seit dem späten 11. Jahrhundert energisch nach oben strebte. Einen entscheidenden Karriereschritt erlebten die Staufer, wie man sie später nannte,31 als der römisch-deutsche König und spätere Kaiser Heinrich IV. im Jahr 1079 Konrads Vater die Herzogswürde in Schwaben übertrug. Der Staufer konnte seine Autorität zwar nicht im ganzen Land durchsetzen, da die beim Investiturstreit gegen Heinrich IV. auftretende päpstliche Partei ein Gegenherzogtum etablierte, aber die Basis für den weiteren Aufstieg seiner Familie war gelegt. Einige Jahre später verbuchte Herzog Friedrich I. von Schwaben einen weiteren wichtigen Erfolg, indem er die Kaisertochter Agnes von Waiblingen heiratete und so in ein enges Verwandtschaftsverhältnis mit der Herrscherdynastie der Salier kam. Als er 1105 starb, hinterließ er seinen beiden Söhnen Friedrich und Konrad ein reiches Erbe: eine beachtliche Machtstellung im Südwesten des deutschen Reichsteils, die politisch kostbare Verwandtschaft mit der salischen Kaiserdynastie und die Zugehörigkeit zum Kreis der wichtigsten deutschen Adelsfamilien.
Konrad stand lange im Schatten seines älteren Bruders. Herzog Friedrich II. von Schwaben (1105 – 1147) war als Erstgeborener nicht nur der Haupterbe des Vaters, sondern spielte auch in der Reichspolitik eine sehr aktive Rolle. Den zweitgeborenen Staufer beachteten die zeitgenössischen Chronisten hingegen nur am Rande. Sie definierten ihn fast nie über seine Funktion oder seinen Rang, sondern bezeichneten ihn oft lediglich als Bruder Friedrichs II. von Schwaben oder als Neffen Kaiser Heinrichs V. (1105 – 1125).
Im Jahr 1116 schien sich das zu ändern. Bevor Heinrich V. zu einem ausgedehnten Zug in den italienischen Teil des Heiligen Römischen Reiches aufbrach, betraute er die beiden Staufer mit der Wahrung seiner Interessen im deutschen Reichsteil. Dem Jüngeren von ihnen übertrug er außerdem, gegen die Interessen des Bischofs von Würzburg handelnd, die herzoglichen Rechte in Ostfranken. Konrad konnte sich an dieser beträchtlichen Aufwertung allerdings nicht lange erfreuen. Als Heinrich V. 1120 eine Aussöhnung mit dem Bischof von Würzburg herbeiführte, verlor der jüngere Staufer seine herzoglichen Rechte größtenteils wieder. Ihm blieb lediglich ein weitgehend inhaltsleeres Titularherzogtum, für ihn zweifelsohne ein herber Schlag.32
Und dann, zu Beginn des Jahres 1124, kündigte Konrad von Hohenstaufen plötzlich an, eine Pilgerfahrt ins ferne Jerusalem unternehmen zu wollen. Und nicht nur das: Er gelobte, wie der Chronist Ekkehard von Aura berichtet, im Heiligen Land »für Christus Kriegsdienst zu leisten«33.
Die Ankündigung des Staufers fiel in jenen Jahren aus dem Rahmen. Die Bereitschaft, sich auf einen Kreuzzug einzulassen, war auch 23 Jahre nach dem Fiasko von 1101 in Deutschland nicht sonderlich groß. Nach wie vor standen für viele vor allem die Gründe im Vordergrund, die gegen ein derartiges Unterfangen sprachen – die extreme Marschdistanz, die enormen Strapazen, tödliche Krankheiten, die vor allem in Kleinasien lauernden Gefahren und auch der Umstand, dass man für einen Kreuzzug ungemein hohe Kosten einzukalkulieren hatte. Statt als Glaubenskrieger in den Orient aufzubrechen, wählten die meisten Menschen des frühen 12. Jahrhunderts ungefährlichere Wege, Gott wohlgefällig zu sein, blieben in der Heimat, verteilten Almosen oder reisten zu heiligen Stätten in der näheren Umgebung. Und jene, die trotzdem eine Fahrt ins ferne Jerusalem wagten, taten dies zumeist lieber als friedliche Pilger.34
Der unmittelbare Auslöser für Konrads Entschluss soll laut Ekkehard von Aura eine Mondfinsternis gewesen sein. Es war ein Naturereignis von der Art, die Menschen des Mittelalters in Angst und Schrecken versetzte, und es fand ausgerechnet an einem wichtigen kirchlichen Festtag statt, dem Fest der Darstellung des Herrn (Mariä Reinigung). Als sich der Mond am 2. Februar 1124 verdunkelte, kam unter den Menschen, die dieses Schauspiel miterlebten, prompt die Furcht auf, Gott werde ihnen wegen moralischer Verfehlungen zürnen, wenn sie nicht Buße täten. Konrad war »ebenfalls sehr erschrocken«, so Ekkehard von Aura. Er »versprach eine Besserung seines Verhaltens und gelobte, nach Jerusalem zu ziehen«35.
Die Entscheidung des Staufers könnte außer von der abergläubischen Furcht vor Naturereignissen und dem Drang zur Buße aber auch von weltlicheren Überlegungen beeinflusst gewesen sein. Es ist gut vorstellbar, dass ihn Missmut und Frustration über seinen Status in der Heimat plagten. Der Verlust seiner herzoglichen Herrschaftsrechte, den er 1120 erlebt hatte, war mehr als ausreichend, um das Ehrgefühl eines mittelalterlichen Fürsten ernsthaft zu verletzen. Dass er nun wieder vermehrt im Schatten seines Bruders stand, dem als Erstgeborenen und langjährigen Herzog von Schwaben ungleich mehr politisches Gewicht zufiel als ihm, dürfte für einen so ehrgeizigen Mann höchst unbefriedigend gewesen sein.
Als Konrad von Hohenstaufen sein Kreuzzugsgelübde ablegte, war er etwa 30 Jahre alt, unverheiratet und stand in der Blüte seiner Jahre. Offenkundig fühlte er die Kraft und Energie in sich, nun etwas Außergewöhnliches zu unternehmen. Seiner Entscheidung, als Krieger ins Heilige Land zu ziehen, lag eine realistische Selbsteinschätzung zugrunde. Im Lauf seines Lebens wurde ihm mehrmals auffallende Tapferkeit im Kampf bescheinigt. An der kriegerischen Courage, die es brauchte, um als Gastritter in den Kreuzfahrerstaaten aktiv zu werden, fehlte es ihm nicht,36 ebenso wenig an den dafür nötigen physischen Voraussetzungen. Mehrere zeitgenössische Quellen schrieben ihm beträchtliche Körperkraft und eine dazu passende Statur zu.37
Mit seinem Vorhaben war Konrad fast in der ganzen ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts eine Ausnahmeerscheinung. Außer ihm gab es nur sehr wenige deutsche Hochadelige, die zwischen dem Kreuzzug von 1101 und dem Zweiten Kreuzzug ins Heilige Land zogen und lebend von dort zurückkehrten. Noch seltener kam es vor, dass einer von ihnen mit der erklärten Absicht aufbrach, dort als Glaubenskrieger in Erscheinung zu treten.38 Das machte Aufsehen. Ekkehard von Aura schrieb über die Reaktionen, die Konrads Ankündigung nach sich zog: »Und seitdem gewann er nicht wenig Anerkennung von all jenen, die davon gehört hatten. Einige, welche vorher der Verdorbenheit ergeben gewesen waren, versprachen auch, dass sie sich demselben [Anm.: Konrads Kreuzzug] anschließen würden.«39
1 Konrad von Hohenstaufen in seinen spä- teren Jahren als König Konrad III., Miniatur aus der Chronica regia Coloniensis (13. Jahrhundert)
Wie der Kreuzzug des Staufers verlief, wurde von zeitgenössischen Geschichtsschreibern leider nicht geschildert. Informationen über die Größe seines Unternehmens fehlen ebenfalls. Konrad von Hohenstaufen fand in jenen Jahren bei deutschen Chronisten noch wenig Beachtung, und führende Chronisten in den Kreuzfahrerstaaten hielten es selten für geboten, Gastritter aus Europa namentlich zu erwähnen. Anhand einiger historischer Fakten der 1120er Jahre und der generellen Rahmenbedingungen, an denen sich Kreuzzüge in jener Zeit orientierten, lässt sich aber doch zumindest in Umrissen darstellen, wie Konrads Vorhaben ablief.
Was die Größe seines Unternehmens betrifft, so ist davon auszugehen, dass Konrad diese schon allein aus Gründen der Reputation nicht übertrieben gering veranschlagt haben wird. Fürsten mussten beim Umgang miteinander, bei Begrüßungszeremoniellen und öffentlichen Auftritten stets darauf achten, die eigene Stellung durch eine große Gefolgschaft eindrucksvoll erscheinen zu lassen.40 Das persönliche Ansehen war für einen Fürsten von unersetzbarem Wert. Es musste um jeden Preis gewahrt und verteidigt werden, und es wurde niemals leichtfertig aufs Spiel gesetzt. All das konnte Konrad auch bei seinem Aufbruch nach Palästina nicht außer Acht lassen. Er gehörte einer der mächtigsten deutschen Familien an, war mit dem Kaiser eng verwandt und führte immer noch, wenn auch mehr theoretisch als praktisch, den Titel eines Herzogs. Für einen Mann seines Ranges verbot es sich von selbst, zuerst mit einem Kreuzzugsgelübde weithin Beachtung zu erlangen und dann mit einer lächerlich kleinen Gefolgschaft in den Orient aufzubrechen. Um seiner Stellung Genüge zu tun, musste er sich an der Spitze eines respektablen Kampfkontingents auf den Weg machen. Viel weniger als zumindest eine Hundertschaft kampferprobter Männer samt entsprechendem Begleitpersonal dürfte es kaum umfasst haben.
Konrad hielt sich ungewöhnlich lange im Orient auf. Palästina-Reisende aus Europa traten ihre Reise nach Jerusalem üblicherweise zu Frühlingsbeginn und ihre Heimfahrt im Herbst desselben Jahres an.41 Konrad hingegen blieb zumindest zwei Saisons in Outremer, wie man das orientalische Territorium der westlichen Christen damals oft nannte, vielleicht sogar länger – von seinem Anfang 1124 abgelegten Kreuzzugsgelübde bis ins Jahr 1127 gibt es von ihm kein gesichertes Lebenszeichen im Heiligen Römischen Reich. Hinter einer dritten Saison als Gastkrieger für das Königreich Jerusalem steht allerdings ein Fragezeichen, denn am 25. Mai 1125 starb Kaiser Heinrich V., und mit ihm erlosch die salische Herrscherdynastie in männlicher Linie. Für die Staufer hatte dies beträchtliche Auswirkungen; der sterbende Monarch hatte seine Gemahlin und seine Besitztümer dem Schutz Friedrichs II. von Schwaben überantwortet, was dessen Chancen bei der nun anstehenden Königswahl am 24. August 1125 in Mainz erhöhte. Jedoch stieß Konrads älterer Bruder die Reichsfürsten mit allzu siegesgewissem Auftreten vor den Kopf und zog bei der Abstimmung gegen Herzog Lothar von Sachsen den Kürzeren. Konrad fehlte bei der Wahlversammlung, weil ihn die Nachricht vom Tod des Kaisers mit Gewissheit zu spät erreicht hatte, um es rechtzeitig zur Königswahl nach Mainz zu schaffen. Der Antritt seiner Rückreise erfolgte frühestens im Herbst 1125. Allerdings schweigen sich die Quellen über Konrad auch während der Frühphase des Konflikts seines Bruders mit dem neuen König Lothar III. aus, was angesichts der zentralen Rolle, die der jüngere Staufer später in diesem Konflikt spielen sollte, doch auffallend erscheint.42
Konrads Aufenthalt in Outremer dauerte vermutlich auch deshalb vergleichsweise lange, weil er in eine stürmische Zeit fiel. Friedlich ging es rund um die fränkischen Staaten im Orient selten zu, doch die Jahre 1124 bis 1126 verliefen besonders kriegerisch und waren von zwei militärisch und machtpolitisch erstrangigen Ereignissen geprägt.
Zu Beginn des Jahres 1124, als Konrad sein Gelübde ablegte, holten die Franken im Orient zu einem großen Schlag aus. Sie begannen Tyrus zu belagern, neben Askalon die einzige bedeutende Hafenstadt an der östlichen Mittelmeerküste, die noch unter muslimischer Herrschaft stand. Ihre Siegchancen wurden durch eine venezianische Flotte erhöht, welche die Belagerung von See her unterstützte. Wie Fulcher von Chartres berichtet, befanden sich an Bord der Schiffe aus der Markusrepublik nicht nur Söldner, sondern auch Pilger, die wahrscheinlich größtenteils aus Deutschland nach Venedig gekommen waren und sich dort eingeschifft hatten. Diesen Weg dürfte auch Konrad von Hohenstaufen eingeschlagen haben. Es ist davon auszugehen, dass er die mittlerweile berüchtigte Landroute durch Kleinasien, wo schon große Armeen untergegangen waren, mit seinem vergleichsweise kleinen Kampfkontingent gemieden hatte.43
Die Belagerung von Tyrus zog sich trotz der starken venezianischen Flottenunterstützung lange hin und dauerte letztlich fast ein halbes Jahr. Erst im Juli 1124 kapitulierten die muslimischen Verteidiger von Tyrus und räumten die Stadt gegen freien Abzug.
2 Die Halbinsel von Tyrus, die eine effiziente Verteidigung der Stadt ermöglichte, dargestellt vom schottischen Vedutenmaler David Roberts (1839).
Es war ein großer Triumph für die Christen. Ruhe kehrte in der Region danach jedoch keineswegs ein. Für Krieger aus dem Abendland gab es auch in weiterer Folge im Orient viel zu tun, und das nahezu pausenlos. Dies war zum Teil auf die schwankenden Machtverhältnisse in Nordsyrien, insbesondere auf die prekäre Lage der Grafschaft Edessa zurückzuführen, die über den Euphrat hinaus weit in den Osten hineinragte und aufgrund ihrer exponierten Lage besonders gefährdet war. Außerdem kannte die kriegerische Energie des Königs Balduin II. von Jerusalem (1118 – 1131) kaum Grenzen. Die Eroberung von Tyrus lag gerade ein Vierteljahr zurück, da setzte Balduin II. seine Truppen schon wieder in Marsch, stieß nach Aleppo vor und belagerte die zentrale syrische Binnenmetropole mehrere Monate lang. Um die Wende zum Jahr 1125 gab er das Unternehmen auf, da der seldschukische Atabeg von Mossul, Aq Sunqur al-Bursuqi, mit einer starken Entsatzarmee heranrückte. Balduin II. kehrte daraufhin nach Jerusalem zurück. Kaum dort angekommen, erfuhr er, dass Aq Sunqur seinerseits offensiv geworden und in die christlichen Territorien in Nordsyrien eingedrungen war. Das Fürstentum Antiochia vermochte dem mächtigen Herrn von Mossul nicht ausreichend Paroli zu bieten und rief Balduin II. zu Hilfe. Für den König gab es kein Zögern. Er beanspruchte eine Führungsrolle unter den Kreuzritterstaaten, was freilich auch die Bereitschaft einschloss, den nördlichen Staaten militärisch beizustehen, wenn es die Situation erforderte.44 Diesmal war die Situation besonders dramatisch. Balduin II. sah den gesamten fränkischen Norden bedroht. Er »sammelte so viele Ritter wie er konnte«45, wie der fränkische Chronist Wilhelm von Tyrus berichtet, unter ihnen vermutlich auch Konrad von Hohenstaufen mit den Seinen, und machte sich eilig wieder auf den Weg. Am 11. Juni 1125 kam es bei Azaz im Westen der Grafschaft Edessa zu einer der blutigsten Schlachten der Kreuzzugsgeschichte. Nach einem stundenlangen Gemetzel behielt der König trotz Unterzahl die Oberhand, Aq Sunqur zog sich aus der Grafschaft Edessa zurück.
Auch nach dem durchschlagenden Sieg von Azaz hielt Balduin II. nicht inne. Er schaltete rasch wieder auf Offensive um, unternahm zwei Vorstöße Richtung Damaskus und eroberte im Frühjahr 1126 die strategisch bedeutende Festung Rafania zur Sicherung der Grafschaft Tripolis. Im Herbst des Jahres trat er noch einmal Aq Sunqur entgegen, der abermals in die Grafschaft Edessa eingerückt war, und zwang ihn, diesmal ohne größeres Blutvergießen, zum Rückzug. Erst als Aq Sunqur bei seiner Rückkehr nach Mossul einem Messerattentat zum Opfer fiel, sah Balduin II. die Gelegenheit gekommen, sich eine ausgiebige Ruhepause zu gönnen. Das Jahr 1127 sollte fast zur Gänze friedlich verlaufen. Gastritter aus Europa wurden vorübergehend weniger benötigt. Spätestens jetzt war der geeignete Zeitpunkt für Konrad von Hohenstaufen gekommen, sein Engagement im Orient zu beenden.
Als der junge Staufer in die Heimat zurückkehrte, hatte er als so ziemlich einziger namhafter deutscher Fürst die Phase des christlichen Vormarsches im Orient intensiv und aus nächster Nähe miterlebt. Das Ende der militärisch erfolgreichsten Phase der Kreuzritterstaaten dämmerte jedoch schon am Horizont herauf, denn Aq Sunqur al-Bursuqi fand in Imad ad-Din Zengi (1127 – 1146) einen mehr als ebenbürtigen Nachfolger. Der neue Herr von Mossul sollte sich als noch gefährlicherer Kontrahent der Franken erweisen. Die Auswirkungen seiner spektakulärsten Tat, der Eroberung von Edessa, sollten auch für Konrad von Hohenstaufen zwei Jahrzehnte später massive Konsequenzen haben.46
Von all dem ahnte der Staufer freilich noch nichts, als er nach Europa heimreiste. Zurück in der Heimat, schlug Konrad ein neues Kapitel seiner Laufbahn auf. Mit seiner Präsenz in Deutschland verschärfte sich der Konflikt zwischen dem staufischen Lager und König Lothar III. erheblich. Im Dezember 1127 erhoben die Staufer Anspruch auf die Krone und vollzogen dabei einen Rollentausch: Nicht Friedrich II. von Schwaben wurde zum Gegenkönig ausgerufen, sondern Konrad. Dass statt des älteren und höherrangigen Bruders nun der Jüngere und wohl auch Ehrgeizigere der beiden an der Spitze der schwäbischen Aufsteigerfamilie stand, hatte er möglicherweise seinem Kreuzzug zu verdanken; da es ihm aufgrund seiner langen Abwesenheit unmöglich gewesen war, Lothar III. formell zu huldigen, konnte er nicht des Eidbruchs bezichtigt werden, wenn er sich gegen den König erhob.
Konrad trug seinen Kampf gegen Lothar III. mit unermüdlicher Verbissenheit aus. Er hielt an seinem Gegenkönigtum ganze acht Jahre fest, obwohl es nach anfänglichen Teilerfolgen bald zusehends unwahrscheinlich wurde, seinen Machtanspruch gegenüber dem König durchsetzen zu können. Erst 1135, als er längst schon hoffnungslos in die Defensive gedrängt war, gab Konrad auf und unterwarf sich dem Monarchen. Dieser zeigte sich großmütig. Lothar III., seit 1133 auch Kaiser, verzichtete auf harte Bestrafungen, übertrug dem gescheiterten Gegenkönig sogar die ehrenvolle Aufgabe, bei einem bevorstehenden Italienzug als Bannerträger zu fungieren. Konrad war klug genug, sich der neuen Situation geschmeidig anzupassen. Während des Italienzuges 1136/37 bestätigte er den Vertrauensvorschuss, den Lothar III. ihm gegeben hatte, agierte diszipliniert in der engen Umgebung des Kaisers, bedeckte sich im Kampf mit Ruhm und knüpfte unter den Großen des Reichs wertvolle Kontakte. All das machte sich für Konrad rasch bezahlt. Lothar III. starb am 4. Dezember 1137 bei der Rückreise aus Italien. Und, für den Staufer noch bedeutsamer: Der Kaiser hatte keinen männlichen Nachkommen. Damit bekam Konrad zum zweiten Mal die Gelegenheit, nach den Sternen zu greifen. Und diesmal gingen seine Pläne auf.
Die Absicht Lothars III. war es eigentlich gewesen, den Welfen Heinrich den Stolzen als seinen Nachfolger auf dem Thron aufzubauen. Zu diesem Zweck hatte er dem ohnehin schon einflussreichen Herzog von Bayern seine einzige Tochter zur Frau gegeben, ihm außerdem das Herzogtum Sachsen sowie die Markgrafschaft Tuszien übertragen und schließlich auch noch die Reichsinsignien ausgehändigt. Doch der gewaltige Machtzuwachs stieg Heinrich dem Stolzen zu Kopf. Während des Italienzuges machte er sich bei den Fürsten mit Hochmut unbeliebt und steigerte damit ihre ohnehin vorhandene Furcht, einen derart mächtigen Mann auch noch zum König zu ernennen.
Konrad machte sich die sich daraus ergebenden Chancen zielstrebig zunutze. Er kam der für Pfingsten 1138 anberaumten Königswahl kurzerhand zuvor, ließ sich bereits im März von einigen ihm besonders wohlgesonnenen Fürsten zum König erheben und wenig später von einem päpstlichen Legaten salben und krönen. In weiterer Folge gewann Konrad in der Auseinandersetzung mit Heinrich dem Stolzen rasch Oberwasser. Die während des Italienzuges geknüpften Kontakte machten sich bezahlt, außerdem genoss er die Unterstützung der Kirche. Gewiss zum Vorteil gereichte ihm auch die Gottesfurcht, die er mit seinem Kreuzzug unter Beweis gestellt hatte.
Von einer Woge wachsender Zustimmung unter den Reichsfürsten getragen, erreichte der ehrgeizige Staufer schließlich sein großes Ziel. Er entschied die am 22. Mai 1138 in Bamberg abgehaltene Königswahl für sich.47
Aus Konrad von Hohenstaufen wurde Konrad III., römisch-deutscher König und erster Staufer auf dem Thron.
Konrad III., Friedrich III. von Schwaben und der Zweite Kreuzzug (1147 – 1149)
Der Ruf Edessas
Konrad von Hohenstaufen hatte die Führung des Heiligen Römischen Reiches mit Entschlossenheit und einigem politischem Geschick an sich gezogen. Bei der Ausübung seiner Führungsrolle agierte er weniger glanzvoll.
Zu Beginn seiner Herrschaft hatte es noch den Anschein, als würde dem Reich unter Konrad III. mehr Harmonie vergönnt sein, als dies unter seinen Vorgängern der Fall gewesen war. Das Einvernehmen des Staufers mit dem Heiligen Stuhl, das seinen Aufstieg auf den Thron begünstigt hatte, setzte sich nach 1138 nahtlos fort. Machtkämpfe mit dem Papsttum, die unter den letzten Saliernherrschern im Kontext des Investiturstreits jahrzehntelang getobt hatten, gab es unter Konrad III. nicht. Sein konsequenter Verzicht auf ein Kräftemessen mit Rom war unter den Reichsoberhäuptern jener Zeit eine Ausnahme und dazu angetan, den Frieden im Reich zu fördern.
Diesen Frieden gab es jedoch nicht, im Gegenteil. Tiefgreifende, teils hausgemachte innenpolitische Konflikte sollten den König bis zum Ende seiner Tage beschäftigen. Sein größtes Problem waren die Welfen. Um seine Herrschaft flächendeckend zu etablieren, versuchte Konrad III. zunächst, deren Macht vollends zu brechen. Bald nach seiner Krönung nahm er Heinrich dem Stolzen zuerst das Herzogtum Sachsen, dann auch das Herzogtum Bayern ab und setzte dort enge Gefolgsleute an die Spitze, in Sachsen den Askanier Albrecht den Bären und in Bayern den österreichischen Markgrafen Leopold IV., einen seiner babenbergischen Halbbrüder. Doch die Welfen wehrten sich gegen ihre Entmachtung, und das mit Erfolg. In Sachsen stritten ihre Anhänger mit derartiger Durchschlagskraft, dass Konrad III. sich 1142 genötigt sah, Albrecht den Bären von dort wieder abzuziehen und doch den noch minderjährigen Sohn Heinrichs des Stolzen, Heinrich den Löwen, mit dem Herzogtum zu belehnen. In Bayern stemmte sich Welf VI., der jüngere Bruder von Heinrich dem Stolzen, der 1139 verstorben war, den Babenbergern – zunächst Leopold IV., ab 1143 dessen Bruder Heinrich Jasomirgott – mit einer militärischen Kraft und Vehemenz entgegen, die diese jahrelang nicht überwinden konnten.1
Während Konrad III. darum rang, seine königliche Autorität gegen die Welfen durchzusetzen, kam es im Orient zu einer nachhaltigen Machtverschiebung zuungunsten der Christen. Imad ad-Din Zengi, der Herr von Mossul und Aleppo, hatte sich schon seit Jahren als strikter Gegner der Kreuzritter positioniert und den Heiligen Krieg gegen die Invasoren aus dem Westen gepredigt. Im Herbst 1144 machte er schließlich in großem Stil gegen die Franken mobil. Wie sein Vorgänger Aq Sunqur al-Bursuqi nahm er sich den schwächsten der vier Kreuzritterstaaten vor. Er marschierte in die Grafschaft Edessa ein und begann die gleichnamige Hauptstadt zu belagern. Nach einigen Wochen gelang ihm der Durchbruch. Er eroberte Edessa am Weihnachtsabend des Jahres 1144. Die Zitadelle der Stadt konnte sich noch zwei Tage länger halten, musste sich dann aber ebenfalls ergeben. Die einheimischen Christen von Edessa verschonte Zengi, unter der fränkischen Bevölkerung der Stadt richtete er ein Blutbad an. Der Westen der Grafschaft konnte von den Christen vorderhand zwar noch behauptet werden, doch mit der Eroberung der Hauptstadt Edessa hatten die Muslime den ersten wirklich nachhaltigen Schlag gegen die Kreuzritter gelandet.
Im Abendland sorgte Zengis Erfolg zunächst nur für verhaltene Reaktionen. Die Nachricht vom Fall Edessas wurde zwar weithin mit Bestürzung aufgenommen, aber ein von Papst Eugen III. (1145 – 1153) erlassener Kreuzzugsaufruf, der sich in erster Linie an die Adresse Frankreichs richtete, blieb ohne nennenswertes Echo. Außer König Ludwig VII. verspürte kaum einer der französischen Großen die Neigung, wegen Edessa die Strapazen, Kosten und Gefahren eines Kreuzzuges in Kauf zu nehmen.
Den Umschwung brachte die Entscheidung Eugens III., Bernhard von Clairvaux mit der Kreuzzugspredigt zu betrauen.
Bernhard von Clairvaux war um die Mitte des 12. Jahrhunderts die führende geistliche Autorität Europas, verantwortlich für die Ausbreitung des Zisterzienserordens über weite Teile des Kontinents. Er war der Lehrmeister Eugens III. und der überragende Prediger seiner Zeit, ausgestattet mit einer Rednergabe, der sich kaum jemand entziehen konnte. Und der berühmte Zisterzienserabt erfüllte die in ihn gesetzten Erwartungen.
Zuerst bewirkte Bernhard von Clairvaux einen Stimmungsumschwung in Frankreich.2 Am 31. März 1146 trug er bei einer großen Versammlung in Vézelay in Anwesenheit des Königs zunächst die päpstliche Bulle vor, die zum Kreuzzug aufrief; dann hielt er seine erste große Predigt für den Glaubenskrieg und versetzte seine Zuhörer in Begeisterung. Nach dem erfolgreichen Auftakt von Vézelay setzte Bernhard von Clairvaux mit Schriften und weiteren Predigten eine flächendeckende Werbung für den Kreuzzug in Szene. Darin stellte er den Glaubenskrieg in mitreißender Manier als eine von Gott geschenkte Möglichkeit dar, sich von seiner Sündenlast zu befreien und Erlösung zu erlangen.3 Das Heilige Land beschrieb Bernhard von Clairvaux als rechtmäßiges Eigentum Christi, die Eroberung von Edessa durch die Muslime als Warnsignal, dem unbedingt Taten der Christenheit folgen müssten. Denn die Erde werde erbeben und erzittern, »weil der Herr des Himmels sein Land zu verlieren beginnt«, verkündete der Prediger. Der Fall des Heiligen Landes stünde bald bevor, »wenn nicht einer sich findet, der Widerstand leistet, wenn sie in die Stadt des lebenden Gottes einbrechen, wenn sie die Werkstätten unserer Erlösung umstürzen, wenn sie die heiligen, vom Blut der unbefleckten Lämmer geröteten Orte beschmutzen.«4
Es war eine Botschaft, die im Kern der im 20. Jahrhundert aufgestellten Domino-Theorie ähnelte: Fällt ein Land, fallen auch die anderen, wenn dagegen nicht beizeiten etwas unternommen wird.
In Frankreich initiierte Bernhard von Clairvaux mit seinen fulminanten Bemühungen quasi im Alleingang die Bildung einer Kreuzarmee, an deren Spitze König Ludwig VII. trat. Danach begab sich Bernhard ins Heilige Römische Reich, um hier Ähnliches zu erreichen.
König Konrad III. sah den berühmten Geistlichen mit Unbehagen heranziehen. Aus dem jungen feurigen Kreuzritter von einst war ein etwa 53 Jahre alter und damit nach mittelalterlicher Vorstellung schon recht betagter Mann geworden, dessen Kräfte von der Reichspolitik zusehends aufgezehrt wurden. Die innenpolitischen Konflikte, die ihn von Beginn seiner Herrschaft an begleitet hatten, harrten nach wie vor einer Lösung. In Sachsen war ihm die Errichtung einer wirklich stabilen Königsherrschaft noch immer nicht gelungen; in Bayern übte Welf VI. weiterhin massiven Druck aus, um das Herzogtum an sich zu ziehen; andere politisch brisante Fehden sorgten für zusätzliche Turbulenzen. Angesichts all dieser Probleme schreckte den König die Vorstellung ab, dem unruhigen Reich lange fernzubleiben. Als er im November 1146 mit Bernhard von Clairvaux in Frankfurt am Main zusammentraf, reagierte er auf dessen Kriegsappell ausweichend und tat recht deutlich seine geringe Begeisterung für einen aufwändigen und zeitintensiven Kreuzzug kund.
Bernhard von Clairvaux geriet durch die äußerst reservierte Reaktion Konrads III. in eine schwierige Lage, denn massiv unter Druck setzen konnte er den König nicht. Da dieser eine konsensorientierte Kirchenpolitik betrieb und außerdem ein unersetzbarer Bündnispartner für den Papst war, der sich sowohl von der rebellischen Bevölkerung Roms als auch vom Expansionsdrang König Rogers II. von Sizilien bedroht sah, kam die Androhung von Strafen wie der Exkommunikation beim Staufer nicht in Frage. Jedoch registrierte Bernhard von Clairvaux während der Begegnung in Frankfurt, dass der König schwankte. Konrad III. sagte zwar keinen Kreuzzug zu, doch eine klare Absage kam ihm auch nicht über die Lippen. Außerdem erklärte er sich bereit, zu Weihnachten bei einem Reichstag in Speyer abermals mit dem Zisterzienserabt zusammenzutreffen.