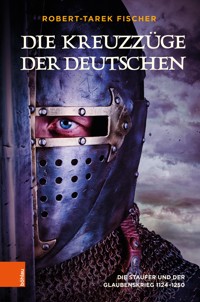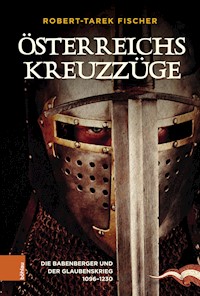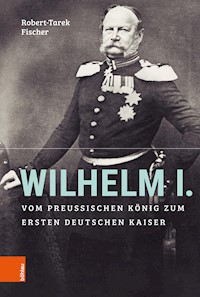Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Böhlau Verlag Wien
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Richard I. Löwenherz (1157–1199) zählt zu den bekanntesten Akteuren des Mittelalters. Sein Kreuzzug gegen Sultan Saladin und sein Image als Idealgestalt des Rittertums machten ihn zu einem Mythos. Seine Gefangennahme in Österreich wuchs sich zur größten Erpressungsaffäre des Mittelalters aus. Die nachträgliche Verbindung zur Robin Hood-Sage steigerte seinen Bekanntheitsgrad noch mehr. Abseits der Legenden war Richard I. vor allem eines: vielschichtig. Als Herrscher des Angevinischen Reiches, das von Schottland bis zu den Pyrenäen reichte, verfolgte er eine komplexe Politik und stieg zum mächtigsten Herrscher Westeuropas auf. Er war ein bedeutender Förderer der Troubadourkunst und betätigte sich selbst als Poet. Er setzte neue Maßstäbe im europäischen Festungsbau, betrieb intensive Eigen-PR und schuf die berühmten Three Lions, die noch heute das englische Wappen zieren. Diese Biografie zeigt eine charismatische und rätselhafte, hoch begabte und abgründige Schlüsselfigur des Hochmittelalters. Es ist kein Zufall, dass sich gerade um Richard I. Löwenherz so viele Legenden ranken.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 499
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Robert-Tarek Fischer
RICHARD I. LÖWENHERZ1157–1199
Ikone des Mittelalters
2. überarbeitete Auflage
Böhlau Verlag Wien · Köln · Weimar
1. Auflage 2006
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der
Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Umschlagabbildung:
König Richard I., Richard Löwenherz (1157–1199), König von England.
Richard Löwenherz von Wassili Dmitrijewitsch Polenow ; © GL Archive/Alamy Stock Foto
© 2019 by Böhlau Verlag Ges.m.b.H & Co. KG, Wien, Kölblgasse 8–10, A-1030 Wien Alle Rechte vorbehalten. Das Werk und seine Teile sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung in anderen als den gesetzlich zugelassenen Fällen bedarf der vorherigen schriftlichen Einwilligung des Verlages.
Einbandgestaltung: Michael Haderer, Wien
Satz: Michael Rauscher, WienEPUB-Produktion: Lumina Datamatics, Griesheim
Vandenhoeck & Ruprecht Verlage | www.vandenhoeck-ruprecht-verlage.com
ISBN 978-3-205-21004-7
Für Viktoria und Nicolas
Inhalt
Vorwort
Anmerkungen zu den Quellen
Zweiter Sohn eines Reichsgründers (1157–1183)
1. Ein schillerndes Elternpaar
2. Die Welt des jungen Richard
3. Erste Schritte in die Politik
4. Nebenakteur einer folgenschweren Revolte
5. Im Kampf um Aquitanien
6. Taillebourg, 10. Mai 1179
7. Angriff des älteren Bruders
8. General und Politiker, Kunstmäzen und Dichter
Thronfolger auf schwankendem Boden (1183–1189)
1. Konflikt mit Heinrich II.
2. Normannischer Vexin und Alice – ein Gordischer Knoten
3. Angriff der jüngeren Brüder
4. Waffenstillstandsvermittler am Rand des Abgrundes
5. Ein Warnsignal an den Vater
6. Jerusalem – ein fernes Wetterleuchten
7. Bruch mit Heinrich II.
8. Entscheidungskampf um die Macht
Herrschaftsantritt im Angevinischen Reich (1189–1190)
1. „Ich vergebe Euch“
2. Eleonore – ein Phönix aus der Asche
3. Krönung in Westminster
4. Die Finanzierung des Kreuzzuges
5. Machtsicherung
6. Herrscherkult und Selbststilisierung
7. Geheimdiplomatie
Der lange Weg in den Orient (1190–1191)
1. Truppenstärke
2. Die Lage im Orient
3. Von Vézelay nach Süditalien
4. Messina im Handstreich
5. Überwinterung in Sizilien
6. Krisenmanagement und Machtpolitik
7. Die Preisgabe von Excalibur
8. Die Eroberung Zyperns
Kreuzritter im Heiligen Land (1191–1192)
1. Die Einnahme Akkos
2. Die Abreise Philipps II.
3. Verzögerte Intervention in England
4. Das Massaker von Akko
5. Die Schlacht von Arsuf
6. Vor den Toren Jerusalems
7. Ein mysteriöses Attentat
8. Die Errichtung des Zweiten Königreiches
9. Der Gesang der Sirenen
10. Der „unvergleichliche König“
11. Waffenstillstandsvertrag mit Saladin
In deutscher Haft (1192–1194)
1. Odyssee nach Wien
2. Die Gefangennahme
3. Isolationshaft in Dürnstein
4. Teilerfolg in Speyer, Fiasko in Gisors
5. Der Vertrag von Worms
6. Ein Lied aus der Haft
7. Die Freilassung
Rückkehr (1194)
1. Bündnispolitik am Niederrhein
2. Ankunft in England
3. Ein Tag im Sherwood Forest
4. Weichenstellungen in Nottingham und Winchester
5. Landung in der Normandie
Im Kampf um Frankreich (1194–1196)
1. Fréteval
2. Im Zeichen der militärischen Konsolidierung
3. Verwaltungs- und Turnierreformen in England
4. Intervention Heinrichs VI.
5. Ein Lied an die Auvergne
6. Issoudun
7. Rückschläge und Strategiewandel
Dem Zenit der Macht entgegen (1196–1199)
1. Friede mit Toulouse
2. Bündnis mit Flandern
3. Château Gaillard
4. Die Nachfolgefrage
5. Macht- und Kulturexport in den deutschen Raum
6. Konflikt mit Hugo von Lincoln
7. Der König und sein Umfeld
8. Sieg vor Gisors
9. Die Geburt der Drei Löwen
10. Waffenstillstand unter päpstlicher Vermittlung
11. Der Pfeil von Châlus Chabrol
12. „Grausames habe ich zu berichten“
Nachwort
Lieder von Richard Löwenherz
Zeittafel
Landkarten
Quellen- und Literaturverzeichnis
Bildnachweis
Personenindex
Vorwort
Um die Tagesmitte des 5. August 1192 setzte König Richard I. Löwenherz alles auf eine Karte. Seit den Morgenstunden hatte er sich mit rund einem Dutzend Rittern und einigen hundert Fußsoldaten den Angriffen der ungleich größeren Streitmacht Sultan Saladins entgegengestemmt, um Jaffa für das Kreuzfahrerkönigreich Jerusalem zu behaupten. Nachdem es mit letztem Einsatz gelungen war, mehrere Attacken der muslimischen Kavallerie abzuwehren, beschloss Richard, die Initiative an sich zu reißen. Auf seinen Befehl hin ließen die Armbrustschützen einen Pfeilhagel auf Saladins Truppen niedergehen, während seine übrigen Soldaten sich zur Offensive formierten. Dann ging das kleine Kreuzfahreraufgebot, mit Löwenherz zu Pferd an der Spitze, zum Gegenangriff über und stieß frontal in die übermächtigen gegnerischen Reihen hinein.
Das Bild des Königs von England, der in der letzten Schlacht des dritten Kreuzzuges alles wagte, um der vermeintlich guten Sache zum Sieg zu verhelfen, wurde von zahlreichen christlichen Chronisten gezeichnet.1 Es trug maßgeblich zu einem Legendenbildungsprozess bei, der durch weitere Aufsehen erregende Geschehnisse wie Richards Haft im Heiligen Römischen Reich oder seine Rückkehr nach England zusätzliche Dynamik gewann und den als Inbegriff des verwegenen Kriegers und Paradekreuzritters idealisierten König in die Sagenwelt entrückte. Der daraus resultierende Mythos überdauerte die Jahrhunderte, wurde in zahllosen Romanen, Musikstücken und Filmen thematisiert und hob den zweiten Monarchen aus dem Haus Plantagenet zum kleinen Kreis vormoderner Herrschergestalten empor, deren Namen heute noch allgemein geläufig sind.
Die beispiellose Mythenbildung machte aus Richard Löwenherz jedoch nicht nur eine historische Gestalt von immensem Bekanntheitsgrad, sondern leistete ebenso einer eindimensionalen Beurteilung der realen Person Vorschub. Selbst die Geschichtswissenschaft vermochte nicht immer Distanz zu dem überlieferten Bild des Kriegers zu wahren und bewertete seine Herrschaft des Öfteren nahezu ausschließlich anhand seiner militärischen Taten. Im Gegensatz zu anderen Monarchen seiner Zeit, die man trotz zahlreicher Feldzüge stets vorrangig als politische Akteure wahrnahm, wurde Löwenherz nicht selten auf die Heldenlegende reduziert und als ein Herrscher beschrieben, dem bei allem heroisch-ritterlichen Glanz staatsmännisches Verantwortungsgefühl und jeglicher Sinn für das Politische fehlte.2 Die Quellen jener Zeit verdeutlichen indessen, dass diese Einschätzung zu kurz greift. Sie geben Richard I. keineswegs nur als gleichsam apolitischen Abenteurer, sondern vielmehr als oftmals hintergründig vorgehenden Monarchen zu erkennen, der nicht zuletzt aufgrund seines individuellen politischen Handelns eine Schlüsselfigur seiner Epoche darstellte. Und auch auf anderen Ebenen erwies sich Löwenherz als komplexe Persönlichkeit, die in vielen Bereichen – nämlich Organisation, Diplomatie, Strategie, Selbststilisierung, Dichtung, Mäzenatentum, ja selbst Architektur –, ihre Wirksamkeit entfaltete und sich daher eindimensionalen Erklärungsmodellen entzieht.
Für weitere Verzerrungen in der historischen Rückschau sorgten die Hindernisse, die einer Einordnung Richards I. in nationale Zusammenhänge entgegenstehen. Während Zeitgenossen wie Kaiser Friedrich I. Barbarossa oder König Philipp II. August zuweilen als Vorläufer der Nationswerdung Deutschlands bzw. Frankreichs wiedergegeben wurden, lässt sich eine ähnliche Funktion Löwenherz’ im Hinblick auf England kaum feststellen. Neben seiner familiär bedingten, nichtenglischen Prägung ist dies insbesondere auf die Rahmenbedingungen sowie die Chronologie seiner Herrschaft zurückzuführen. In den ersten Jahren nach seiner Krönung befand er sich als Kreuzfahrer in weiter Ferne. Danach agierte er als Herrscher des Angevinischen Reiches, das sich über England und große Teile Frankreichs erstreckte – zwei Länder also, die im Lauf der Zeit ausgeprägte eigenstaatliche Identitäten entwickelten. Die sich daraus ableitenden Grundkomponenten seines Wirkens führten seitens der ab dem 19. Jahrhundert zunehmend nationalstaatlich geprägten Geschichtsschreibung zu manch plakativem Urteil. Dazu gehört beispielsweise der häufige Vorwurf, Richard hätte während seiner knapp zehn Jahre dauernden Herrschaft lediglich sechs Monate in England zugebracht, wobei nur zu oft die nötige Ergänzung fehlte, dass er sich nach dem Kreuzzug zumeist in der Normandie aufhielt und infolgedessen durchaus innerhalb des Angevinischen Reiches präsent und aktiv war.
Verkürzte und einseitige Bewertungen im Hinblick auf Richard I. Löwenherz sind zudem eine Konsequenz der unruhigen und bewegten Zeit, in der er lebte. Nur wenige Phasen in der vormodernen Geschichte Europas bieten derart breiten Raum für gegensätzliche Interpretationen wie das konfliktbeladene späte 12. Jahrhundert, eine Epoche, in der die höfische Ritterkultur und das Troubadourwesen in voller Blüte standen, in der sich allerdings auch die machtpolitische Situation auf mehreren Ebenen zuspitzte. Die Eroberung Jerusalems durch Saladin führte zu einer jähen Intensivierung der Kreuzzugsbewegung; der Gegensatz zwischen Frankreich und dem Angevinischen Reich eskalierte; das Heilige Römische Reich stürzte durch den Tod Kaiser Heinrichs VI. in eine tiefe Krise. Das aufgeheizte Klima dieser Konfliktsituationen führte zu vermehrter Propaganda seitens der zeitgenössischen Chronisten, deren Berichte wiederum die Grundlage des heutigen Urteils bilden. Eine Verstärkung erfuhr das tendenziöse Element der zeitgenössischen Überlieferungen noch durch den Umstand, dass das späte 12. Jahrhundert eine außerordentliche Dichte an herausragenden Monarchen aufweist, deren Taten vielfach in großem Stil Platz griffen und von Chronisten eine zusätzliche Überhöhung und Glorifizierung erfuhren. Zu den Monarchen, die ähnlich Richard Legendenbildungsprozesse auslösten, zählen Kaiser Friedrich I. Barbarossa und Sultan Saladin, darüber hinaus Löwenherz’ Vater Heinrich II., der Gründer des Angevinischen Reiches, sowie Philipp II. August, der als einer der bedeutendsten Könige der frühen französischen Geschichte gilt.
Bei keinem führenden Akteur des späten 12. Jahrhunderts tritt das Spannungsverhältnis zwischen realem Handeln und Mythisierung jedoch so stark zutage wie bei Richard I. Obwohl seine Herrschaftszeit mit knapp zehn Jahren verhältnismäßig kurz währte, nahm er auf alle zuvor genannten Entwicklungen direkt oder indirekt Einfluss. Im Lauf weniger Jahre, in denen sich buchstäblich ein folgenschweres Ereignis an das andere reihte, trat er in weiten Teilen der damals bekannten Welt in Erscheinung, veränderte die machtpolitische Landkarte in West- und Mitteleuropa, im östlichen Mittelmeerraum sowie im Orient und hinterließ darüber hinaus sowohl auf gesellschaftspolitischer als auch auf kultureller Ebene so manche Spur.
Im Lauf der Zeit wurden Richard I. Löwenherz viele Attribute zugeschrieben, die das ganze Spektrum zwischen positivem und negativem Extrem abdecken. Fraglos war er einer der markantesten Akteure des Hochmittelalters, eine schillernde und hoch begabte, gleichzeitig eine zuweilen widersprüchliche und rätselhafte, manchmal abgründige Persönlichkeit. Mit seinem an dramatischen Wendungen, spektakulären Erfolgen und fatalen Fehlern überreichen Leben repräsentiert er Licht- und Schattenseiten der im späten 12. Jahrhundert weit verbreiteten Kombination von machtpolitischem Vorgehen und ritterlicher Selbstdarstellung wie kein anderer Herrscher seiner Zeit und wurde zu einer Symbolgestalt des Hochmittelalters. Nicht zuletzt infolge seiner vielfältigen Wirkung – auf militärischer, aber eben auch auf politischer und kultureller Ebene – ist die Verflechtung zwischen Mythos und Realität gerade bei ihm in derartiger Intensität gegeben.
* * *
Die vorliegende Biografie unternimmt den Versuch, die Mannigfaltigkeit im Wirken Richards I. Löwenherz darzustellen. Neben der Behandlung seiner bekanntesten Lebensstationen – etwa des Dritten Kreuzzuges oder der Gefangenschaft im Heiligen Römischen Reich – werden daher zudem unbekanntere Aspekte seines Daseins beleuchtet, so zum Beispiel die Themenbereiche Herrscherkult, Imagebildung und Propaganda. Teil der Betrachtung bildet überdies die Rolle, welche Richard auf kultureller Ebene zukam, wobei seinem lyrischen Schaffen besondere Aufmerksamkeit gilt. Ferner wird ein Fokus auf die gemeinhin weniger geläufige zweite Hälfte seiner Herrschaftszeit gelegt, die den vielschichtigen Akteur Richard I. am deutlichsten erkennen lässt.
Um bei der Übersetzung zeitgenössischer Textstellen größtmögliche Verständlichkeit zu gewährleisten, wurden gelegentlich behutsame Anpassungen an den heutigen Sprachgebrauch vorgenommen.
* * *
Bei der ersten, im Jahr 2006 erschienenen Auflage dieses Buches bekam ich wertvolle Unterstützung von Dr. Gisela Fischer, Claudia Strafner, Mag. Marianne Kirchmayr und Mag. Wolfgang Riedl, ebenso von Dr. Peter Rauch, Dr. Eva Reinhold-Weisz und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Böhlau Verlages. Ihnen allen gilt mein Dank auch weiterhin.
Für die Umsetzung der zweiten Auflage dieses Buches traf ich beim Böhlau Verlag neuerlich auf hochprofessionelle Ansprechpartner. Diesmal – 13 Jahre später – handelte es sich dabei um Mag. Eva Buchberger und Mag. Waltraud Moritz sowie um Michael Rauscher, mit dem ich bereits 2006 zusammenarbeitete.
Darüber hinaus richtet sich mein Dank an Thomas Matzek, Dr. Stephan Hönigmann, Mag. Isabella Lesiak und Fritz Kalteis.
_________________
1Quellenbelege zu den Ereignissen des 5. August 1192 finden sich in den Anmerkungen 193 bis 201 bzw. 218.
2„Er war ein schlechter Sohn, ein schlechter Gatte und ein schlechter König gewesen, aber ein kühner und großartiger Krieger“, schrieb beispielsweise der viel gelesene Kreuzzugshistoriker Steven Runciman bilanzierend über Richard I. (Geschichte der Kreuzzüge, München 2001, S. 849), während der britische Quelleneditor William Stubbs so weit ging, dem König jeglichen politischen Instinkt – „the veriest tyro in politics“ – abzusprechen (Itinerarium peregrinorum et gesta regis Ricardi, London 1864, herausgegeben von William Stubbs, S. XXV). Generell schien Löwenherz Formulierungen, die das Kriegerische in den Vordergrund rücken und fehlendes politisches Bewusstsein implizieren, regelrecht anzuziehen, so etwa: „ein Haudegen ohnegleichen“ (Mayer, Hans Eberhard: Geschichte der Kreuzzüge, Stuttgart/Berlin/Köln 1989, S. 132), „Wirrkopf“ (Le Goff, Jacques: Das Hochmittelalter, Frankfurt am Main 1965, S. 140) oder – in positiver Akzentuierung – „this proudest of English kings“ (Barlow, Frank: The Feudal Kingdom of England 1042–1216, London/New York 1988, S. 366).
Anmerkungen zu den Quellen
In wesentlichen Teilen ist das Leben Richards I. Löwenherz für einen Herrscher des Mittelalters exzellent dokumentiert. Zahlreiche europäische und arabische Zeitzeugenberichte reflektieren sein Wirken in unterschiedlichen Akzentuierungen und Schwerpunktsetzungen. Angesichts ihrer Vielzahl können die folgenden Anmerkungen lediglich einen skizzenhaften Überblick über die Quellen vermitteln und einige Anhaltspunkte geben, welche Stärken und Schwächen ihnen in Bezug auf den Protagonisten innewohnen.
Die zentrale Wissensgrundlage zum Thema stellt die englische Geschichtsschreibung dar, die zur Zeit Richards I. in voller Blüte stand. Die letzten zwei Jahrzehnte des 12. Jahrhunderts, von Antonia Gransden, einer der wohl besten Kennerinnen auf diesem Gebiet, nicht zu Unrecht als „goldenes Zeitalter der Historiografie in England“3 bezeichnet, brachten eine Reihe von versierten Chronisten hervor, die ihren Blick auf die Welt jenseits ihres regionalen Umfeldes richteten, das gesamte Angevinische Reich in ihre Schilderungen miteinzubeziehen suchten, die Politik des Hauses Plantagenet in einen europäischen Gesamtkontext stellten und selbst Vorkommnisse im Orient in ihre Werke einfließen ließen. Manche von ihnen befanden sich in Positionen, um umfassende Informationen auf direktem Weg zu erlangen, so etwa der in königlichen Diensten befindliche Beamte Roger von Howden, der gleichfalls in einem Naheverhältnis zur Krone stehende Autor des Werkes Gesta regis Henrici Secundi Benedicti Abbatis oder Ralph von Diceto, der als Dekan der St. Paul’s Kathedrale in London eine einflussreiche Stellung einnahm und somit unmittelbar in das politische Geschehen eingebunden war. Andere Geschichtsschreiber befanden sich zwar nicht in unmittelbarer Nähe zum Machtzentrum und konnten über maßgebliche Ereignisse nicht aus erster Hand berichten, verfügten aber über erstrangige Informanten und vermochten so ebenfalls aufschlussreiche Darstellungen über das politische Geschehen des späten 12. Jahrhunderts zu verfassen. Zu ihnen ist beispielsweise der aus Yorkshire stammende Geistliche Wilhelm von Newburgh zu zählen, desgleichen der im Kloster St. Swithun in Winchester lebende Richard von Devizes sowie der einem Haus des Zisterzienserordens in Essex angehörende Mönch Ralph von Coggeshall, welcher den Hergang der eingangs erwähnten Schlacht von Jaffa von einem der wenigen Ritter erfuhr, der erwiesenermaßen daran teilnahm.
Vergleichsweise glänzend belegt liegt auch Richards Anteil am Dritten Kreuzzug vor. An erster Stelle zu nennen sind das Werk Itinerarium peregrinorum et gesta regis Ricardi, verfasst von einem uns unbekannten, dennoch unverkennbar der Krone nahe stehenden Chronisten, sowie die in Gedichtform angelegte Erzählung L’Estoire de la Guerre Sainte des in der Normandie geborenen Poeten Ambroise, den raren Glücksfall einer mittelalterlichen Kriegsberichterstattung, die Richards Aktivitäten in Palästina aus der Sicht des einfachen Soldaten schildert. Ergänzt werden die angevinischen Darstellungen des Dritten Kreuzzuges durch die christlich-orientalischen Quellen Ernoul und Eracles. Die Texte muslimischer Geschichtsschreiber wie Baha al-Din, Ibn al-Atir, Imad ad-Din oder Abu Schama bieten zudem die Gelegenheit, Richards Taten in Palästina aus der Sicht der islamischen Welt zu beleuchten.
Weitere wertvolle Ergänzungen zur Ära Löwenherz bieten die Niederschriften der französischen Chronisten Wilhelm der Bretone und Rigord sowie des vermutlich aus dem österreichischen Raum stammenden Ansbert, diverse Urkundensammlungen, ebenso die Lebensgeschichten prominenter Zeigenossen wie Wilhelm der Marschall oder Erzbischof Hugo von Lincoln, um nur einige zu nennen.
Trotz ihrer Reichhaltigkeit und ihrer teils hohen Qualität weisen die Zeitzeugenberichte im Hinblick auf Richard Löwenherz doch beträchtliche Unschärfen auf: So ist sein Wirken als Herzog von Aquitanien (1172/74–1189) lediglich in Bruchstücken überliefert, da die genannten englischen Chronisten mit überregionalem Anspruch zwar ein in Summe dichtes Bild über die Vorgänge in England erstellten, allerdings nur sehr begrenzte Informationen über die Vorgänge im fernen äußersten Süden des Angevinischen Reiches gelegenen Herzogtum Aquitanien besaßen. In ihren Berichten schien Richards erster Herrschaftsraum daher zumeist allein dann auf, wenn sich dort kriegerische Auseinandersetzungen zutrugen oder Geschehnisse eintraten, welche die Interessen des Gesamtreiches berührten. Da die Geschichtsschreibung in Aquitanien nicht annähernd das Niveau englischer Chroniken erreichte und die Gedichte der Troubadoure ebenfalls keinen kongenialen Informationsersatz darstellen – das von politischen Inhalten geprägte Genre des Sirventes diente mehr der polemischen Meinungsäußerung denn der Schilderung größerer politischer Zusammenhänge – beschränkt sich unser Wissen über Richards Unternehmungen in Aquitanien im Wesentlichen auf militärische Aktivitäten. Seine Regierungstätigkeit jenseits der Kampfschauplätze liegt dagegen weitgehend im Dunkeln, so dass der heutigen Wissenschaft kaum Aufschlüsse über administrative Maßnahmen oder den Einfluss politischer Protagonisten an Richards Hof in Poitiers vorliegen.
Eine weitere Informationslücke zeigt sich in der zeitgenössischen Berichterstattung, betreffend Richards Heimreise vom Kreuzzug, die mit seiner folgenschweren Gefangennahme in Österreich endete. Von seiner Abreise aus Palästina am 9. Oktober 1192 bis zu seiner über zwei Monate später erfolgten Inhaftierung bei Wien erlauben die Quellen lediglich begrenzte Einsicht auf die Umstände seiner Abfahrt von Akko sowie seiner Routenwahl, was hauptsächlich auf die Tatsache zurückzuführen ist, dass der König ab Korfu mit kleinem Gefolge reiste, das während der Odyssee nach Österreich auf nur zwei Personen zusammenschmolz. Die Kette von Ereignissen, die zu seiner Festnahme und damit zu der größten Krise seines politischen Lebens führte, ist uns daher nur in Umrissen bekannt.
Ferner gilt es zu berücksichtigen, dass die englischen Geschichtsschreiber insbesondere in ihrer Beschreibung von Richards langjährigen Auseinandersetzungen mit König Philipp II. von Frankreich naturgemäß eine proangevinische Tendenz erkennen lassen. Dies betrifft nicht nur hofnahe Chronisten wie Roger von Howden, sondern auch Geistliche wie Wilhelm von Newburgh oder Richard von Devizes, die ungeachtet fehlender materieller Interessen in positiver Akzentuierung über Richard berichteten. Die sich auf diese Weise ergebende Schieflage lässt sich in der historischen Darstellung allerdings nicht zur Gänze ausbalancieren, da die Sichtweise Philipps II. lediglich durch zwei ergiebige französische Quellen – Wilhelm den Bretonen und Rigord – dargestellt wird und die französische Reflexion der politischen Abläufe deswegen in Summe ungleich weniger deutlich und detailliert zutage tritt.
Abschließend seien noch zwei generelle Probleme genannt, die hinsichtlich des Handelns und des Umfeldes mittelalterlicher Herrscherpersönlichkeiten stets zu vergegenwärtigen sind.
Zum Ersten scheinen Frauengestalten in mittelalterlichen Quellen zumeist nur spärlich auf, weshalb sich unser Wissen selbst über Königinnen in der Regel in engen Grenzen hält. Dies gilt größtenteils ebenso für die Ära Löwenherz. Auch hochgeborene weibliche Persönlichkeiten wie Richards Gemahlin Berengaria von Navarra oder seine langjährige Verlobte, die dem französischen Herrscherhaus entstammende Alice, wurden in den zeitgenössischen Berichten nur in seltenen Randbemerkungen erwähnt, weshalb sie für uns lediglich in äußerst vagen Konturen fassbar sind. Eine immerhin bedeutende Ausnahme stellt indessen Richards Mutter Eleonore von Aquitanien dar, deren politische Aktivitäten seitens der Chronisten erhebliche Aufmerksamkeit erfuhr.
Zum Zweiten wird die individuelle Persönlichkeit mittelalterlicher Monarchen weitgehend durch das Prinzip des Herrschertums verdeckt. Ähnlich wie die Bildnisse jener Zeit, die nicht der realitätsnahen Visualisierung des Porträtierten, sondern vornehmlich der Darstellung symbolischer Handlungen dienten, treten uns Kaiser, Könige oder Fürsten auch in schriftlichen Überlieferungen gemeinhin als politisch Ausführende und Gebieter, kaum jedoch als individuelle Charaktere oder gar als Privatpersonen gegenüber. Das Informationsdefizit in Bezug auf persönlich bestimmter Motivationen zwingt die Wissenschaft zur Erstellung entsprechender Erklärungsmodelle, um bestimmte Ereignisketten plausibel zu machen, was jedoch die Notwendigkeit entsprechender Anmerkungen inkludiert, an welchen Stellen sich der Autor nicht mehr auf entsprechende Quellenberichte stützen kann und zu reflektieren beginnt.
Trotz der genannten Einschränkungen sind die Zeitzeugenberichte zu Löwenherz vergleichsweise außerordentlich reichhaltig. Ihre Qualität und Fülle ermöglichen es dem Historiker bzw. der Historikerin, einzelne Ereignisse aus verschiedenen zeitgenössischen Sichtweisen zu betrachten, gleichzeitig weitgehende Distanz von der Zuordnung bestimmter Wesensmerkmale durch Chronisten zu wahren und die Darstellung Richards I. Löwenherz in erster Linie anhand seiner Taten zu rekonstruieren. In Summe bieten die Quellen zum Thema die im Hinblick auf das Hochmittelalter keineswegs selbstverständliche Gelegenheit, eine Biografie zu verfassen, die manche Einblicke in die Persönlichkeit des porträtierten Herrschers zu geben vermag.
_________________
3Gransden, Antonia: Historical Writing in England, 2 Bände, London 1974–1982, hier: Band I: Historical Writing in England c. 550 to c. 1307, S. 219
I.
Zweiter Sohn eines Reichsgründers (1157–1183)
1. EIN SCHILLERNDES ELTERNPAAR
Am 18. Mai 1152 wurde in der Kathedrale von Poitiers ein Paar getraut, dem binnen weniger Jahre eine Machtexpansion der Superlative glückte: Heinrich Plantagenet und Eleonore von Aquitanien.
Allein durch ihre Heirat ergab sich eine beträchtliche Machtzusammenballung. Heinrich war trotz seiner erst 19 Jahre der bestimmende Fürst im Nordwesten Frankreichs. Seine Vorfahren hatten von ihrem Stammland Anjou aus die Touraine und Maine an sich gebracht, sein Vater Gottfried Plantagenet – der Beiname bezog sich auf dessen Helmzier, einen Ginsterzweig – darüber hinaus das Herzogtum Normandie. Die 30-jährige Eleonore war ihrerseits die maßgeblichste weltliche Persönlichkeit im Südwesten Frankreichs. Als Herzogin von Aquitanien gebot sie über die Länder Poitou, Saintonge, Angoumois, Marche, Périgord, Limousin sowie Gascogne und kontrollierte damit ein Gebiet, das mehr als ein Viertel des heutigen Frankreich umfasste. Somit führte die Eheschließung Heinrichs und Eleonores mit einem Schlag zur Entstehung eines geographisch in sich geschlossenen Territorialkomplexes, der vom Ärmelkanal bis zu den Pyrenäen reichte.
Doch all diese Besitzungen, so weitläufig sie auch waren, dienten dem Paar lediglich als Sprungbrett zu einer noch größeren Machtausweitung, denn Heinrich verfügte über den Anspruch auf die Herrschaftsnachfolge in England. Seine Mutter Mathilde hatte, obwohl von ihrem Vater, König Heinrich I. von England (1100–1135), zur Thronerbin erklärt, nach dessen Tod im Streit um die Krone gegen ihren Cousin Stephan von Blois (135–1154) den Kürzeren gezogen, diesem in wechselvollen bewaffneten Auseinandersetzungen zwar schwer zugesetzt, allerdings keinen dauerhaften Erfolg erzielt und die Insel 1148 verlassen. Heinrich Plantagenet setzte den Kampf der Mutter fort. Bald nach seiner Hochzeit mit Eleonore, die seine Position erheblich verstärkte, gelang ihm der entscheidende Durchbruch. Im November 1153 stimmte der alternde Stephan, von dem fast zwanzig Jahre währenden Bürgerkrieg und dem Tod seines eigenen Sohnes zermürbt, einem Kompromiss zu, der ihm zwar die Krone über England beließ, Heinrich jedoch die Herrschaftsnachfolge garantierte. Als Stephan ein Jahr später starb, trat die vereinbarte Regelung in Kraft: Am 19. Dezember 1154 wurden Heinrich und seine Gemahlin in Westminster zum neuen Herrscherpaar des Königreiches England gekrönt.
Damit hatte sich der junge Plantagenet, nunmehr König Heinrich II. (1154–1189), kometengleich zum mächtigsten Monarchen Westeuropas emporgeschwungen. Sein Gebiet erstreckte sich von der Grenze Schottlands bis zur Grenze der Iberischen Halbinsel. Keiner seiner Vorgänger auf dem englischen Thron hatte auch nur annähernd über einen derartig weitläufigen Territorialbesitz verfügt.
Freilich: Es erforderte ungeheure Anstrengungen, diesen Schwindel erregend steilen Aufstieg zu konsolidieren, denn der Herrschaftsraum des Plantagenet war ein noch äußerst heterogenes Gebilde. In England hatte die königliche Regierungsgewalt infolge der fast zwei Jahrzehnte dauernden Thronkämpfe einen Tiefpunkt erreicht, die Grenzen gegen Schottland und Wales waren unsicher. Überdies musste zwischen den zahlreichen Ländern Heinrichs und Eleonores in Frankreich ein wirklicher Zusammenhalt erst geschaffen werden.
Heinrich II., ein mittelgroßer, kräftig gebauter, rothaariger Mann, verfügte über die notwendige Energie, um den ungeheuren Aufgaben annähernd gerecht zu werden. Erfüllt von eisernem Machtwillen, reiste er fortan rastlos durch seine Länder, um seiner Autorität immer und überall Geltung zu verschaffen. Im Lauf seiner 35 Jahre dauernden Herrschaft verbrachte er Weihnachten an 24 verschiedenen Orten und überquerte nicht weniger als 28-Mal den Ärmelkanal. Desinteressiert an Statussymbolen und prunkvollem Auftreten – Heinrich II. bevorzugte einfache, praktische Kleidung und wurde deshalb zuweilen Kurzmantel genannt –, demonstrierte er seine Führungsposition vor allem durch unbändige Tatkraft und außerordentliches politisches Geschick. In den ersten Jahren nach ihrer gemeinsamen Krönung spielte zudem die selbstbewusste Eleonore eine nicht unwesentliche Rolle in der Führung des Reiches. Anders als viele Monarchinnen jener Zeit brachte sie sich aktiv in die Politik ein und agierte während Heinrichs Aufenthalten in den kontinentalen Besitzungen als Regentin von England.
Die außerordentliche Leistung des dynamischen Paares zeitigte bemerkenswerte Resultate. In England festigte Heinrich II. seine Stellung, indem er den Einfluss der Barone energisch zurückdrängte, einschneidende juristische, finanz- sowie sicherheitspolitische Maßnahmen setzte und eine effiziente zentrale Administration installierte. In weiten Teilen seiner festländischen Territorien gewann der unermüdliche König durch seine permanenten Reisen ein derart hohes Maß an Autorität, dass seine Herrschaft bald weitgehend als unbestritten galt; wie wir noch sehen werden, traf dies allerdings nur in bedingtem Ausmaß auf Aquitanien zu. Darüber hinaus gelang es Heinrich II., seine Macht sogar noch weiter auszudehnen. 1155 verschaffte er sich die Kontrolle über die Bretagne im äußersten Westen Frankreichs. 1156 zwang er seinen jüngeren Bruder Gottfried, dem nach dem Willen des Vaters nach Heinrichs Inthronisierung in England die Grafschaft Anjou zugestanden wäre, zum Verzicht auf das Erbe und sah sich der innerfamiliären Konkurrenz endgültig entledigt, als Gottfried 1158 starb. In späteren Jahren konnte der Plantagenet obendrein in Irland Fuß fassen und sich die Lehnsherrschaft über Wales sowie Schottland aneignen.
Die moderne Geschichtsforschung bezeichnet den weitläufigen Territorialkomplex Heinrichs II. gemeinhin als Angevinisches Reich, benannt nach dessen Keimzelle, der Grafschaft Anjou. Auch im vorliegenden Buch wird dieser Name mangels eines besseren Terminus verwendet. Es sei jedoch darauf verwiesen, dass der Begriff Reich irreführend ist, denn bei dem angevinischen Herrschaftsraum handelte es sich mitnichten um einen monolithischen Gesamtstaat, sondern um ein Gebilde, das eines eindeutigen Machtzentrums sowie einer administrativen Gesamtstruktur ermangelte. So behielten beispielsweise die Verwaltungsapparate Englands und Aquitaniens ihre Ausrichtung auf die Machtzentren London und Poitiers bei und agierten weitgehend unabhängig voneinander. Mochte das Angevinische Reich zwar nach außen machtvoll wirken, bildete es im Grunde genommen lediglich eine in einer Hand vereinte Ansammlung von Herrschaftsrechten über eine Reihe von Ländern, als deren verbindendes Element der König fungierte.
Und noch eine entscheidende Achillesferse wies dieses Konstrukt auf: Sowohl Heinrichs als auch Eleonores kontinentale Besitzungen unterstanden seit jeher der Lehnsherrschaft des französischen Königshauses der Kapetinger. Die Errichtung des Angevinischen Reiches hatte an diesem Zustand nichts geändert. Das hieß, dass gut die Hälfte der neuen europäischen Großmacht keinen souveränen Status genoss, sondern theoretisch dem Gutdünken eines anderen Monarchen unterstand, nämlich König Ludwig VII. von Frankreich (1137–1180).
Diese Konstellation entbehrte insofern nicht einer gewissen Pikanterie, als Eleonore bis wenige Wochen vor ihrer Eheschließung mit Heinrich noch die Gemahlin Ludwigs VII. gewesen war. Und, für manche Zeitgenossen besonders empörend: Die Scheidung vom französischen Monarchen kam nicht zuletzt auf ihr Betreiben zustande. Die von unbändiger Vitalität erfüllte Aquitanierin empfand generell wenig Neigung, dem damaligen Rollenbild einer duldsamen Ehegattin und Mutter zu entsprechen. Vielmehr zeigte sie Unabhängigkeit und Tatendrang, galt wegen ihres lebenslustigen Auftretens vielen gar als skandalumwitterte Femme fatale. Eleonore focht das wenig an. Sie nahm sich das Recht, mit ihrem Dasein neben dem tief religiösen Ludwig schlicht unzufrieden zu sein und daraus die Konsequenz zu ziehen. Einen Mönch hätte sie geheiratet – so lautete angeblich ihre Bilanz über diese Ehe. Der Kapetinger willigte schließlich in die Scheidung ein, weil der 15 Jahre dauernden Verbindung nur zwei Töchter entsprungen waren und er sich von einer neuerlichen Vermählung den ersehnten männlichen Thronerben erhoffte. Dass Eleonore allerdings in Windeseile mit dem mächtigen Heinrich vor den Traualtar trat, traf ihn völlig unvorbereitet. Da Ludwig als oberstem Lehnsherrn von Aquitanien das Recht oblag, diese Vermählung zu unterbinden, hatte Eleonore ihm ihr Vorhaben kurzerhand verschwiegen.
Auf den französischen König wirkte die Hochzeit in Poitiers denn auch wie ein Schlag ins Gesicht. Über Eleonores Verhalten hochgradig irritiert und von Heinrichs Machtzuwachs alarmiert, eröffnete der Kapetinger 1152 unverzüglich einen Krieg, errang gegen den Plantagenet jedoch kein greifbares Ergebnis und sah sich bald zu einem Waffenstillstand genötigt. Die Krönung seines Rivalen zum neuen König von England verschob das militärische Kräfteverhältnis vollends zu Ludwigs Ungunsten, dessen unmittelbarer Landbesitz wenig mehr als die Île de France, Orléans sowie Teile des Berry umfasste. Mit den Ressourcen, die diese recht bescheidene Krondomäne bot, ließ sich kein Krieg gegen Heinrich II. gewinnen. Das einzige wirkliche Druckmittel, das Ludwig VII. gegen seinen Kontrahenten zu Gebot stand, war die rechtliche und moralische Macht, die seiner eigenen Stellung als oberster Lehnsherr über die angevinischen Länder in Frankreich zukam. Und dieses Instrument verblieb in seiner Hand, denn für Heinrich kam eine Beseitigung des Vasallenstatus gegenüber dem französischen König nicht in Frage, da er damit einen allzu gefährlichen Präzedenzfall für Revolten eigener Lehnsleute geschaffen hätte. Ausgestattet mit der Autorität eines Oberherrn über Frankreich, gelang es Ludwig im Jahr 1159, einer Offensive Heinrichs auf die Grafschaft Toulouse wirksam entgegenzutreten. Er musste zwar einige Gebietsgewinne seines Widersachers in der Region zulassen, die bis 1196 immer wieder für kriegerische Eskalationen zwischen den Grafen von Toulouse und den Plantagenets sorgen sollten, konnte jedoch die vollständige Eroberung der Grafschaft durch Heinrich und so dessen Positionierung an der Mittelmeerküste auf Dauer unterbinden. Dieser Erfolg änderte dennoch wenig an der Tatsache, dass sich der Kapetinger mit der imponierenden angevinischen Machtentfaltung nicht annähernd messen konnte.
Abb. 1: Richards Geburtshaus – ein bei Oxford errichteter, ab dem 14. Jahrhundert verfallender Palast König Heinrichs I. (1100–1135)
Und noch ein Umstand dürfte Ludwig VII. zu schaffen gemacht haben: Während er in seiner Ehe mit Eleonore nie die Geburt eines männlichen Stammhalters feiern konnte, schenkte die Aquitanierin ihrem zweiten Gemahl buchstäblich einen Sohn nach dem anderen. Bereits im August 1153, kaum mehr als ein Jahr nach ihrer Heirat, konnte sich das englische Königspaar über die Geburt Wilhelms freuen, gefolgt von Heinrich im Februar 1155. Unmittelbar vor der Geburt der ersten Tochter Mathilde im Juli 1156 starb zwar der Erstgeborene, doch bald darauf kündigte sich neuerlich Nachwuchs an. Am 8. September 1157 gebar Eleonore in Oxford einen weiteren Sohn: Richard erblickte das Licht der Welt.4
2. DIE WELT DES JUNGEN RICHARD
Über die Kindheit von Heinrichs II. und Eleonores zweitältestem überlebenden Sohn, der später den legendären Beinamen Löwenherz erhalten sollte, ist nur wenig überliefert. Das Wissen über seine Anfänge beschränkt sich im Wesentlichen auf das Faktum, dass er seine ersten Lebensjahre in England zubrachte und wie seine Geschwister der Obhut des Erzbischofs von Canterbury unterstand.5 Das Kind Richard bleibt für uns somit eine schemenhafte Gestalt. Ein Blick auf seine unmittelbare Umgebung vermag indes immerhin einige Aufschlüsse zu bieten.
Ein prägendes Moment für den jungen Königssohn stellte der Umstand dar, dass Bildung im Haus Plantagenet als außerordentlich hohes Gut betrachtet wurde. Um deren Wert zu veranschaulichen, bemühte das Gefolge Heinrichs II. bildhafte Vergleiche. Ein ungebildeter König wäre wie ein gekrönter Esel, lautete eine dieser Stehsätze, ein anderer befand, ein König ohne umfassende wissenschaftliche Kenntnisse gliche einem Boot ohne Ruder und einem Vogel ohne Federn. Dieser Parolen eingedenk, fand Heinrich II. trotz seiner fortdauernden Reisetätigkeit stets die Zeit, um seine eigene Bildung zu vervollkommnen. Er beherrschte mehrere Sprachen, befasste sich mit verschiedenen Zweigen der Wissenschaft, verfügte über umfassende literarische Kenntnisse und verfasste angeblich sogar ein Buch, das die Falkenjagd behandelte. Hinter diesen regen intellektuellen Aktivitäten stand die damals in Europa noch nicht sehr verbreitete Überzeugung, wonach ein Monarch profundes Wissen benötigte, um sich als versierter Herrscher zu profilieren.6
Eine ebenfalls maßgebliche Rolle im Haus Plantagenet spielte das intensive, ja geradezu innige Naheverhältnis zu Kunst und Kultur. Insbesondere Eleonore zeigte sich der höfischen Dichtung leidenschaftlich zugetan. Sie folgte damit der Tradition eines genialen Vorfahren. Ihr Großvater, Herzog Wilhelm IX. von Aquitanien (1086–1127), hatte durch sein reiches lyrisches Schaffen einer neuen europäischen Kunstform zum Durchbruch verholfen, nämlich der Dichtung in einer Landessprache, die im Gegensatz zur Hochsprache Latein nicht nur von Eliten, sondern von allen Schichten verstanden wurde. Ganz temperamentvoller Lebemann, hing er in einigen seiner elf überlieferten Lieder einer sinnlichen bis obszönen Poesie an, in der oft ein ebenso scharfer wie selbstironischer Witz aufblitzte. Seine eigentliche literaturhistorische Bedeutung liegt jedoch in seinen sensibleren Werken begründet, die das höfische Minnelied vorwegnahmen. Oftmals als „erster Troubadour“ – oder Trobador, wie es in der okzitanischen Sprache ursprünglich hieß – bezeichnet, prägte Wilhelm IX. mit seinen Werken das höfische Ideal sowie die provenzalische Lyrik maßgeblich mit, die sich im weiteren Verlauf des 12. Jahrhunderts zu voller Blüte entfaltete. Eleonore nahm wesentlichen Anteil an der großräumigen Verbreitung dieser Kunstform, indem sie die höfische Minnekultur mit Nachdruck förderte. Durch ihr engagiertes Mäzenatentum entwickelte sich ihr Hof in Poitiers zu einem Tummelplatz für Troubadoure und avancierte zu einer der kultiviertesten weltlichen Stätten des Abendlandes, deren künstlerische Impulse die mittelalterliche Dichtung West- und Mitteleuropas maßgeblich beeinflussten.7
Die eingehende Beschäftigung mit den Wissenschaften sowie die Förderung der Künste entsprangen gleichwohl nicht nur individuellen Interessen, sondern bildeten Eckpfeiler von Heinrichs und Eleonores herrscherlichem Selbstverständnis, waren Teil einer konsequent betriebenen Selbststilisierung und dienten der Imagebildung des Königspaares. Namentlich Heinrichs Studientätigkeit erwies sich nicht zuletzt als machtpolitisches Instrument, da sie von seiner Umgebung als beispielgebend gepriesen und zu einem wichtigen Element weiser Führung hochstilisiert wurde. Die von persönlichen Neigungen, jedoch ebenso von nüchternem Kalkül motivierte Vertrautheit mit Wissenschaft und Kultur wurde in starkem Maß an die nächste Generation weitergereicht und sollte bei Richard nachhaltige Wirkung zeitigen.
Viel Wärme dürften die Kinder des Hauses Plantagenet von ihren Eltern indes nicht empfangen haben. Für Liebe, Fürsorge, körperliche Nähe und Erziehung zeichneten in ihren ersten Lebensjahren Ammen verantwortlich. Nun stellte das in mittelalterlichen Herrscherfamilien zwar nichts Ungewöhnliches dar, war allerdings bei den Plantagenets durch die Abwesenheit beider Elternteile in besonders krassem Ausmaß gegeben. Bezeichnend für die Aufmerksamkeit, die Heinrich II. seinen Nachkommen schenkte, ist ein im Sommer 1160 verfasstes Schreiben, in dem Erzbischof Theobald von Canterbury den seit zwei Jahren durch seine auf dem Festland gelegenen Provinzen reisenden Monarchen zur Heimkehr nach England zu bewegen suchte und meinte, selbst der hartherzigste Vater könnte es doch wohl kaum ertragen, seine Kinder derart lange nicht zu sehen. Heinrich II. kümmerte der Appell offenbar nicht weiter, denn es dauerte bis zum Januar 1163 und damit insgesamt viereinhalb Jahre, ehe er nach England zurückkehrte. Die politisch ebenfalls aktive und oftmals in der Ferne weilende Mutter dürfte sich zunächst ebenfalls recht wenig in die Erziehung eingebracht haben. Gerade für Richard empfand Eleonore zwar einige Zuneigung, doch ist diese Verbundenheit erst in späterer Zeit klar zu erkennen. Während seiner ersten Lebensjahre war vielmehr eine Amme namens Hodierna seine zentrale Bezugsperson im täglichen Leben, auf die sich das ganze Liebesbedürfnis des Königskindes richtete. Die Emotionen, die er für die Ersatzmutter empfand, gingen offenbar tief und blieben ihm unvergessen, denn als er Jahrzehnte später zum König von England aufstieg, war es ihm ein besonderes Anliegen, Hodierna ein sorgenfreies Dasein zu ermöglichen. In liebevoller Dankbarkeit gewährte er ihr eine überaus großzügige Pension und machte sie damit zu einer wohlhabenden Frau.
Nach der frühesten Kindheit traten Söhne hochgeborener Eltern wie Richard in eine ausgedehnte Phase intensiver Ausbildung ein. Neben der Unterweisung in die höfischen Verhaltensregeln und umfassendem Unterricht in Sprachen, Wissenschaften und Musik begann für sie ab dem fünften oder sechsten Lebensjahr die raue Erwachsenenwelt nachdrücklich fühlbar zu werden. Früh wurden sie auf den Rücken eines Pferdes gesetzt, da das Reiten für männliche Nachkommen adeliger Eltern als unabdingbare Fertigkeit galt. Bald folgten erste Unterweisungen in die Kriegskunst der ritterlichen Welt, wozu beispielsweise die ungemein schwierige Aufgabe zählte, mit eingelegter Lanze auf einen Gegner loszusprengen und diesen mit einem Stoß aus dem Sattel zu heben, der auf den Sekundenbruchteil genau berechnet sein und mit perfekter Körperbeherrschung ausgeführt werden musste, um durchschlagende Wirkung zu entfalten.8
Knapp vor Richards achtem Geburtstag erfolgte in Paris eine Weichenstellung, deren Bedeutung für sein späteres Leben kaum überschätzt werden kann. In einer warmen Augustnacht des Jahres 1165 wurden in der französischen Hauptstadt sämtliche Glocken geläutet und Freudenfeuer entzündet. Endlich war jenes Ereignis eingetreten, worauf der mittlerweile 45-jährige König Ludwig VII. jahrzehntelang vergeblich gehofft hatte: In seiner dritten Ehe erlebte er die Geburt eines Sohnes. Der ersehnte Thronfolger wurde auf den Namen Philipp getauft. Als König Philipp II. von Frankreich sollte er kurzzeitig Richards Verbündeter und letztendlich sein gefährlichster Widersacher werden.9
Während sich Ludwig VII. seiner wahrscheinlich drängendsten Sorge enthoben sah, näherte sich die beispiellose Erfolgsstory seines Gegners und seiner ehemaligen Gemahlin ihrem Ende. Um die Mitte der 1160er Jahre entfremdeten sich Heinrich und Eleonore. Ein Auslöser dafür mögen die zahlreichen amourösen Affären des Königs gewesen sein. Neben den insgesamt neun Kindern, die seiner Ehe entsprangen – auf Richard folgten noch Gottfried (1158), Eleonore (1161), Johanna (1164) und Johann (1166) –, zeugte Heinrich II. mit unterschiedlichen Mätressen eine Reihe unehelicher Kinder. Den gesteigerten Unmut Eleonores erregte Heinrichs Dauergeliebte Rosamund Clifford, mit der sich der König schließlich sogar in aller Öffentlichkeit präsentierte und so seine Ehegattin nicht nur demütigte, sondern dazu ihren Status als Monarchin untergrub. Ihr späteres Handeln lässt überdies vermuten, dass Eleonore sich vom zunehmenden Anspruch Heinrichs II. auf exklusive Macht an den Rand gedrängt fühlte und den weitgehenden Ausschluss von der Herrschaft nicht akzeptieren wollte. Als Konsequenz der Ehekrise beschritten König und Königin nicht nur privat zunehmend getrennte Wege, sondern entfernten sich auch auf politischer Ebene voneinander und sollten schließlich zu unversöhnlichen Gegnern werden. Das Drama der Plantagenets begann seine Schatten vorauszuwerfen.10
3. ERSTE SCHRITTE IN DIE POLITIK
Für den heranwachsenden Richard brachte die wachsende Kluft zwischen seinen Eltern eine einschneidende Lebensveränderung mit sich, denn in den späten 1160er Jahren verlagerte Eleonore ihren Wohnsitz zurück nach Aquitanien. Während der älteste Sohn Heinrich für die Herrschaftsnachfolge über England sowie die anderen Länder ihres Gemahls bestimmt war, sollte er als Zweitältester Aquitanien erben und befand sich daher an der Seite der Mutter, als diese wieder in Poitiers zu residieren begann. Damit fand Richards Dasein fortan vorzugsweise in Aquitanien statt, und dort festigte sich höchstwahrscheinlich auch das Band zu Eleonore. Zudem hinterließ das von Troubadourmusik und höfischer Poesie, Turnieren und glanzvollen Festlichkeiten erfüllte Dasein am Hof seiner Mutter bei ihm einen bleibenden Eindruck und bewirkte eine lebenslange Vorliebe für Kunst und Kultur.11
Abb. 2: Eleonore von Aquitanien
Das Leben in Aquitanien hielt jedoch nicht nur Erfreuliches für die Landesherrin und ihren Sohn bereit. Seit jeher waren die einheimischen Adligen imstande gewesen, gegenüber dem Herzogshaus weitgehende Autonomie zu bewahren. Dass die Oberherrschaft nunmehr dem landesfremden Heinrich II. oblag, der in den anderen Teilen des Angevinischen Reiches ein straffes Regiment eingeführt hatte und Ähnliches auch in Aquitanien vorzuhaben schien, erzeugte bei den Baronen der Region einen starken Willen zur Gegenwehr. Anfang 1168 brach eine Revolte im Poitou aus, die sich binnen kurzer Zeit fast auf das gesamte Herzogtum ausbreitete und erst nach einigen Monaten unter Kontrolle gebracht werden konnte. Aller Voraussicht nach brachte diese Erhebung, in deren Verlauf Eleonore einmal nur um Haaresbreite einem Hinterhalt entging, Richard nachhaltige Erkenntnisse darüber, mit welchen Problemen die Herrschaft über Aquitanien einhergehen konnte.
Einige Monate später, am 6. Januar 1169, wurde die künftige Führungsverantwortung für ihn erstmals konkret greifbar, und zwar im Rahmen einer umfassenden Regelung der Herrschaftsverhältnisse auf dem Festland, dem ein neuerlicher Konflikt zwischen Heinrich II. und Ludwig VII. vorangegangen war. Um einen Ausgleich mit dem Kapetinger zu erreichen, traf der englische König in Begleitung seiner Söhne bei der Grenzstadt Montmirail mit seinem Lehnsherrn zusammen und huldigte ihm für seine Länder in Frankreich. Heinrich der Jüngere tat dasselbe für die Normandie, Anjou sowie Maine, desgleichen für die Bretagne, die er dem dritten Sohn Gottfried in weiterer Folge als Lehen übergab. Richard huldigte Ludwig VII. seinerseits für Aquitanien, wurde aber weder seinem Vater noch seinem älteren Bruder als Vasall unterstellt, was darauf hindeutet, dass Heinrich II. für ihn und Aquitanien eine Entwicklung vorsah, die sich autonom vom Angevinischen Reich vollziehen sollte. Um die Verbindung zwischen den zwei Königshäusern zu stärken, einigten sich die beiden Monarchen darauf, Richard mit Ludwigs Tochter Alice zu verloben. Bereits elf Jahre zuvor hatten sie ein Heiratsbündnis für den damals erst dreijährigen Heinrich den Jüngeren und Ludwigs einjähriger Tochter Margarete geschlossen, da beide Könige ein grundsätzliches Interesse hatten, den prekären Frieden zu sichern. Heinrich II. kam es nun als künftigem Schwiegervater zu, die Erziehung von Alice zu übernehmen. Daher wurde Ludwigs kleine Tochter seiner Obhut übergeben, und sie lebte hinfort am Hof des Plantagenet.
Unmittelbar nach der Huldigungszeremonie von Montmirail brachen in Aquitanien abermals Unruhen aus, angeführt von den Grafen von Marche und Angoumois. Als Eleonore ihre Autorität nicht durchsetzen konnte, griff Heinrich II. mit aller Härte durch und zwang die Aufständischen zur Kapitulation, indem er zahlreiche Festungen zerstörte. Danach zog der König mit seiner Streitmacht in die Gascogne, den äußersten Süden des Herzogtums, um auch in dieser nahe den Pyrenäen gelegenen Region seiner Macht energisch Geltung zu verschaffen.
Im Mai 1170 ergänzte Heinrich II. seine Erbfolgemaßnahmen, indem er seinen ältesten Sohn zum Mitkönig krönen ließ. Diese Initiative zielte allerdings keineswegs darauf ab, den Thronfolger auf die spätere Königswürde vorzubereiten oder ihn gar mit konkreten Machtbefugnissen auszustatten. Sie richtete sich vielmehr gegen Thomas Becket, den Erzbischof von Canterbury, dem die Krönung eines Königs eigentlich zustand. Acht Jahre zuvor hatte Heinrich II. seinen damaligen Kanzler und Vertrauten Becket zum Erzbischof erhoben, woraufhin dieser plötzlich zu einem unerbittlichen Verfechter kirchlicher Rechte geworden und nach heftigen Auseinandersetzungen mit dem König nach Frankreich geflohen war. In der Überzeugung, den Erzbischof durch den eigenmächtigen Krönungsakt in die Defensive gedrängt zu haben, gewährte Heinrich II. ihm im Sommer 1170 die Rückkehr, doch Becket begann seine Machtstellung sofort mit allem Nachdruck zu erneuern. Gegen Jahresende lagen Heinrichs Nerven dermaßen blank, dass er bei Hof die zornige Frage stellte, warum keiner seiner Gefolgsleute etwas gegen den Geistlichen unternähme. Vier Ritter fassten die unüberlegte Äußerung als Befehl auf und töteten Becket am 29. Dezember 1170 in der Kathedrale von Canterbury. Dem bestürzten König schadete diese Tat über die Maßen. Er galt von da an als Auftraggeber des Mordes am Erzbischof und musste dem Papsttum im Mai 1172 bedeutende Zugeständnisse machen, um die Wogen zu glätten und seine Reputation wiederherzustellen. Nach einem öffentlichen Bußakt war die schwere Regierungskrise für ihn weitgehend ausgestanden. Eine Hypothek blieb dem Monarchen jedoch: Heinrich der Jüngere begriff die Krönung zum Mitkönig keineswegs als leere Geste. Er erwartete, jetzt mit entsprechenden Rechten und Besitztümern versehen zu werden, und seine Geduld erwies sich als knapp bemessen, wie die kommenden Ereignisse zeigten.12
Eleonore zeigte bei ihrer Nachfolgepolitik größerer Umsicht als ihr Gemahl. Im Gegensatz zu Heinrich II. instrumentalisierte sie die zeitgerechte Planung einer späteren Herrschaftsübergabe nicht für taktische Manöver im Kontext anderer machtpolitischer Fragen, sondern bereitete Richard allem Anschein nach behutsam und planvoll auf die ihn erwartenden Aufgaben vor. Um ihren Sohn als späteren Herzog zu etablieren und ihn ihren Untertanen bekannt zu machen, bereiste sie mit ihm ihre Länder und ließ ihn dabei symbolische, einem kommenden Herrscher zukommende Aktivitäten durchführen, so etwa die Grundsteinlegung eines Klosters in Limoges. Schließlich, im Juni 1172, vollzog Richard seinen eigentlichen Eintritt ins politische Leben. Im Beisein seiner Mutter empfing er im Rahmen prunkvoller Zeremonien in der Kathedrale von Poitiers die Insignien eines Herzogs von Aquitanien.13
Nicht einmal ein Jahr später zog er in Verbindung mit einer breiten Allianzbewegung gegen den mächtigsten Mann Westeuropas in den Kampf – seinen eigenen Vater.
4. NEBENAKTEUR EINER FOLGENSCHWEREN REVOLTE
Am 25. Februar 1173 hielt Heinrich II. eine Reichsversammlung in Limoges ab und verlautbarte in Anwesenheit seiner höchsten Barone einige Vorhaben für die Zukunft. Dazu gehörte der Plan, seinen jüngsten Sohn Johann mit der Tochter des über umfangreiche Teile des Westalpenraumes gebietenden Grafen Humbert III. von Savoyen zu verloben. Zu diesem Zweck gedachte der König, Johann, der bei der Länderzuteilung von Montmirail unberücksichtigt geblieben war und dem seitdem der Beiname Ohneland anhaftete, drei strategisch bedeutende Burgen in Anjou zu übergeben. Diese Maßnahme erzürnte jedoch den ältesten Sohn des Monarchen. Heinrich der Jüngere hatte zwar im Jahr 1169 für die Normandie, Anjou und Maine dem französischen König gehuldigt und 1170 seine Königskrönung erfahren, gleichwohl seitdem keinen konkreten Besitz erlangt. Er betrachtete die jetzige Intention Heinrichs II. daher als Eingriff in seine Rechte, erhob gegen seinen Vater während der Versammlung heftige Vorwürfe und fasste schließlich einen radikalen Entschluss: Wenige Tage nach dem Eklat von Limoges setzte er sich zu Ludwig VII. ab, um seine Forderungen mit dessen Hilfe gewaltsam durchzusetzen.
Der König von Frankreich nahm Heinrich den Jüngeren mit offenen Armen auf, denn dessen Überlaufen bot ihm zum ersten Mal überhaupt die Gelegenheit, seinem überlegenen Kontrahenten Heinrich II. einen entscheidenden Schlag beizubringen und das Angevinische Reich nachhaltig zu destabilisieren. Er ergriff die Chance mit beiden Händen, sicherte dem jungen englischen Monarchen militärischen Beistand gegen seinen Vater zu und schwor eine Reihe namhafter Fürsten seines unmittelbaren Einflussbereiches auf einen Krieg gegen Heinrich II. ein. Unzufrieden mit der autoritären Herrschaft des Plantagenet und dessen drückender Besteuerungen, liefen überdies zahlreiche Barone aus angevinischen Kernländern wie der Normandie oder der Bretagne in das Lager Ludwigs VII. und Heinrichs des Jüngeren über. Auch Eleonore, deren Ehe mit Heinrich II. mittlerweile völlig zerrüttet war, verwarf nach der spektakulären Flucht ihres ältesten Sohnes das letzte Quäntchen Solidarität zu ihrem Mann und gedachte, seine Macht zugunsten ihrer Söhne zu brechen. Auf ihr Betreiben zogen der damals 15 Jahre alte Richard und der erst 14-jährige Gottfried nach Frankreich, um sich ihrem älteren Bruder und Ludwig VII. anzuschließen, die im Juni 1173 gegen Heinrich II. losschlugen.
Doch Ludwig VII., Heinrich der Jüngere und ihre Bündnispartner hatten sich verschätzt: Heinrich II. zeigte sich der von vielen Seiten erklärten Kampfansage vollkommen gewachsen. Selbst die gleichzeitige Erhebung englischer Barone sowie der Angriff des Königs Wilhelm I. von Schottland (1165–1214) konnten ihn nicht seiner Handlungsfähigkeit berauben. Mit enormen finanziellen Mitteln ausgestattet, warb der Herrscher des Angevinischen Reiches eine rund 20.000 Mann starke Söldnerarmee an und ging in die Offensive, begünstigt durch den Umstand, dass sich die Koalition als schlecht organisiert erwies und die maßgeblichsten Verbündeten auf eigene Rechnung und weitgehend isoliert voneinander kämpften. Folglich konnte niemand Heinrichs geballter Kampfkraft etwas entgegensetzen. Zunächst brachte der Monarch durch einen erfolgreichen Feldzug im Sommer 1173 die Normandie wieder weitgehend unter seine Kontrolle, und im Herbst gelang es ihm, die Rebellen in England in die Defensive zu drängen. Zur selben Zeit glückte einer seiner Patrouillen auf dem Festland ein für ihn unerwarteter Erfolg: die Gefangennahme Eleonores, die in Männerkleidung zu Ludwig VII. zu fliehen versuchte.
Durch die Inhaftierung der Königin veränderte sich Richards Position entscheidend. Bislang hatte er während der turbulenten Ereignisse lediglich eine Nebenrolle gespielt und im Schatten wichtigerer Akteure wie Ludwig VII. und Heinrich dem Jüngeren gestanden. Nun aber, da seine Mutter in die Hand des Vaters geraten war, trat er erstmals als eigenständig Handelnder in den Vordergrund und begann, den Kampf gegen Heinrich II. im Norden Aquitaniens, namentlich in Poitou, zu entfachen. Um sich eine möglichst starke strategische Position zu verschaffen, versuchte er, die Kontrolle über den zentralen Atlantikhafen La Rochelle zu gewinnen. Doch die Offensive des Jünglings scheiterte rasch, denn die loyal zu Heinrich II. stehenden Einwohner der Stadt verschlossen die Tore vor ihm. Richard zog sich daraufhin nach Saintes zurück, das er zu einer starken Verteidigungsstellung auszubauen trachtete. Auch dieses Vorhaben schlug bald fehl. Anfang Mai 1174 rückte Heinrich II. in Poitou ein, überraschte seinen Sohn mit einem Blitzangriff auf Saintes, nahm die Stadt im Sturm und zwang das Gros der aufständischen Truppen zur Kapitulation. Richard entkam mit einigen Getreuen und verschanzte sich in Taillebourg, der als uneinnehmbar geltenden Festung seines Vasallen Gottfried von Rancon.
Heinrich II. verfügte nicht über die Zeit für eine langwierige Belagerung. Weitaus bedenklicher als der Widerstand Richards, in dem der König nun keine ernsthafte Bedrohung mehr erblickte, gestaltete sich die Lage in England, wo sowohl Truppen des schottischen Königs als auch englische Rebellenverbände marodierten und brandschatzten. Unverzüglich kehrte er wieder nach Norden um und überquerte Anfang Juli 1174 den Ärmelkanal. Seine Gemahlin und ihren Hofstaat führte er mit sich, ebenso die Frauen oder Verlobten seiner Söhne, darunter auch Richards Verlobte Alice. Für Eleonore brach nun eine bittere Zeit an, denn fortan musste sie ihr Dasein als Gefangene ihres Gatten fristen und verschwand für fünfzehn Jahre nahezu gänzlich von der politischen Bühne.
Im Sommer desselben Jahres gewann Heinrich II. im Kampf gegen seine zahlreichen Opponenten endgültig die Oberhand. Am 13. Juli geriet König Wilhelm I. von Schottland in Gefangenschaft, und in den folgenden beiden Wochen brach der Widerstand der englischen Aufständischen unter dem Druck der Regierungstruppen zusammen. Danach setzte der Plantagenet mit seiner Söldnerarmee in die Normandie über und bereitete einer Belagerung Rouens durch Ludwig VII., Heinrich dem Jüngeren und Graf Philipp I. von Flandern ein Ende. Daraufhin strich der französische König die Segel und willigte in einen Waffenstillstand ein.
Nur ein einziger Widersacher stand jetzt noch zwischen Heinrich II. und dem vollständigen Triumph: Richard. Von den diversen Fehlschlägen der Anführer des Koalitionskrieges unbeeindruckt, kämpfte er auf eigene Faust weiter und bemühte sich um eine Stärkung seiner strategischen Position in Aquitanien, indem er mehrere Burgen seines Vaters im Poitou angriff. So hartnäckig war sein Widerstand, dass Heinrich II. sich genötigt sah, nochmals den Weg nach Süden einzuschlagen, um reinen Tisch zu machen. Das Erscheinen der Hauptarmee seines Vaters brachte Richard schnell an die Grenzen seiner Möglichkeiten. Von der turmhohen Truppenübermacht des Monarchen heillos überfordert, wagte der junge und unerfahrene Herzog keinen Kampf und wich zurück, zeigte sich dennoch immer noch nicht zur Kapitulation bereit und floh mit seinen Getreuen von Burg zu Burg, während sein Vater unaufhaltsam nachrückte. Erst als er vom Scheitern seines älteren Bruders sowie Ludwigs VII. erfuhr und erkennen musste, dass er nunmehr völlig allein stand, rang er sich zu der einzig richtigen Erkenntnis durch, dass weitere Gegenwehr keinen Sinn mehr hatte und lenkte ein. Am 23. September erschien er unbewaffnet vor seinem Vater, warf sich ihm zu Füßen und bat um Vergebung. Heinrich II. zeigte sich milde, half Richard auf und gab ihm den symbolischen Friedenskuss.
Abb. 3: König Heinrich II.
Auch in weiterer Folge demonstrierte der siegreiche Herrscher des Angevinischen Reiches gegenüber seinen drei aufrührerischen Söhnen Nachsicht. Ende des Jahres feierte er mit ihnen ein friedliches Weihnachtsfest in Argentan. Bis auf weiteres nahm er sie zwar unter strengere Aufsicht, beließ ihnen jedoch ihre Funktionen. Richard wurde wie seinen Brüdern Heinrich und Gottfried einige Einschränkungen auferlegt. Er musste die Halbierung seiner Einkünfte aus Aquitanien hinnehmen und durfte von da an nur noch zwei unbefestigte Residenzen nutzen. Seine machtpolitische Stellung erweiterte sich dennoch erheblich, denn infolge der Gefangennahme seiner Mutter wies Heinrich II. nunmehr ihm die Regierungskompetenz im Herzogtum zu. Auf Anordnung seines Vaters begab er sich sodann in seine Länder, um sich als loyaler Herzog zu beweisen und das eruptive Aquitanien zu einem soliden südlichen Eckpfeiler des angevinischen Herrschaftsraumes auszubauen.14
5. IM KAMPF UM AQUITANIEN
Als Richard um die Jahreswende 1174/75 zurück nach Poitiers zog, konnte er sich als potenziell höchst gewichtiger Machtfaktor fühlen. Mochte der Vater seinen Handlungsspielraum auch eingegrenzt haben und ihn unter wachsamer Aufsicht halten, so handelte es sich bei seinem Herzogtum doch um eine ebenso weitläufige wie reiche Region, mit fruchtbaren Feldern und erlesenem Wein, der sich im Lauf der vergangenen Jahrzehnte zu einem äußerst gewinnbringenden Exportartikel entwickelt hatte. Durch die Einhebung entsprechender Steuern und Zölle nahm ein Fürst dieses Landes eine Position ein, die den überregionalen Vergleich puncto finanzieller Liquidität nicht zu scheuen brauchte.
Gleichzeitig war Aquitanien jedoch ebenso ein Herzogtum, das innerhalb des Angevinischen Reiches in vielerlei Hinsicht eine Sonderstellung innehatte. Hier vereinigten sich scheinbar völlig gegensätzliche Daseinselemente zu einem für Nordfranzosen oder Engländer kaum nachvollziehbaren Ganzen. Für die aquitanischen Adligen gehörten kunstvolle Poesie und intellektuelle Diskurse ebenso zum Alltag wie kriegerische Roheit und pralle Lebenslust, die mit moralischen Werten oftmals kollidierte, ein Selbstverständnis, das durch die Dichtung der Troubadoure eine Überhöhung und zusätzliche Steigerung erfuhr.15 Es mag daher kein Zufall sein, dass dieses Kulturland mit archaischen Abgründen bahnbrechende, gleichermaßen sensibel-tiefgründige wie kriegerisch-abenteuerlustige Dichter wie den ersten Troubadour Wilhelm IX. oder den zu Richards Lebzeiten dichtenden Bertran von Born hervorbrachte, dessen lyrisches Schaffen eine unstillbare Freude an ritterlichen Waffentaten widerspiegelte – „Der Friede hat mir keinen Trost. Nach Kampf begehrt mein Herz. Ich halt und glaub kein anderes Gesetz“16 –, und der Kampfszenen mit schwelgerischer Begeisterung beschrieb:
„Schön ist es mir, wenn aneinander Schilde drängen, von roten und von blauen Farben überdeckt, Fahnen und Lanzenwimpel auch von vielen Farben bunt, wenn Zelte mannigfach und reich sich spannen, wenn Lanzen splittern, Schilde brechen, und wenn man blanke Helme spaltet, Hiebe gibt und nimmt.“17
Für den erst 17 Jahre zählenden Richard stellte das unruhige Aquitanien zweifelsohne eine ungeheure Herausforderung dar. Eine starke Zentralgewalt, wie von seinem Vater in England, der Normandie und in anderen Teilen des Angevinischen Reiches bereits errichtet, existierte hier nach wie vor nicht. Selbst Heinrichs Sieg über seine Söhne und Ludwig VII. hatte zu keiner Steigerung angevinischer Macht im Land beigetragen, denn die entscheidenden Waffengänge waren weiter im Norden erfolgt. Die aquitanischen Barone hingegen mussten auf keine Niederlage gegen den König zurückblicken. Seit jeher an weitgehende Unabhängigkeit gewohnt, sahen sie daher auch jetzt keinerlei Notwendigkeit, sich angevinischer Oberherrschaft zu beugen. Dass Richard in seiner bisher einzigen kriegerischen Bewährungsprobe verloren und sich dem Vater kampflos unterworfen hatte, trug ebenfalls nicht dazu bei, den selbstsicheren Baronen der Region Respekt vor dem kaum erwachsenen Herzog einzuflößen.
Die sich vor ihm auftürmenden Probleme ließen den jungen Plantagenet dennoch nicht verzagen. Sein politisches Programm zeugt vielmehr von veritablem Selbstvertrauen und Majestätsbewusstsein. Es lief im Wesentlichen darauf hinaus, seine fürstliche Autorität nachdrücklich zu festigen, dem Unabhängigkeitsstreben der widerspenstigen aquitanischen Vasallen energisch zu begegnen und eine durchsetzungsstarke zentralisierte Administration zu errichten.
Und nun, da Richard zum ersten Mal als eigenständiger Herzog regierte, zeigte sich, dass er über eine Gabe verfügte, die ihn von seinen Brüdern unterschied und die im Mittelalter von immensem Wert war: Er erwies sich als hoch talentierter Feldherr und Truppenführer, instinktsicher in Strategie und Taktik, trickreich und flexibel, vorangetrieben von jäher und wilder Energie.
„Kein noch so steiler und schroffer Berg, kein noch so hochragender und uneinnehmbarer Turm konnten ihn aufhalten“18,
schrieb Giraldus Cambrensis, der das detaillierteste Bild des jungen Richard zeichnete. In der Tat wurde die mit auffälliger Kühnheit gepaarte Einsatzbereitschaft des Herzogs schon bald zu seinem Markenzeichen. Der damals weithin gepflogene Verzicht auf Winterfeldzüge kümmerte ihn nicht. Zuweilen zog er mitten in der kalten Jahreszeit mit seinen Streitkräften los, trotzte Wind und Wetter und harrte trotz schlechtester Bedingungen im Feldlager aus, um sein Ziel zu erreichen. Kam es zum Kampf, dirigierte Richard seine Truppen im Gegensatz zu manch anderen Feldherren nicht aus sicherer Entfernung, sondern führte sein Schwert an vorderster Front. Er teilte mit seinen Soldaten Strapazen und Risiken, war General und Elitesoldat in Personalunion. Gleichzeitig zeigte sich Richard aber auch imstande, bei der Realisierung seiner militärischen Vorhaben Ausdauer und Geduld aufzubringen – Eigenschaften, die im aquitanischen wie im gesamten französischen Raum eine ausschlaggebende Rolle spielten, denn die damalige Kriegsführung drehte sich keineswegs um gewaltige Entscheidungsschlachten und den Zusammenprall mächtiger Ritterheere, die mit Tausenden Toten endeten, wie es das Klischee vermuten lassen würde. Nicht der Tod des Gegners bildete das Ziel, sondern die Durchsetzung von Macht sowie der Erhalt von Kompensationszahlungen zur Steigerung der eigenen Handlungsfähigkeit. Um den Kontrahenten zum Nachgeben zu zwingen, verwüstete man mit kleineren Verbänden seine Liegenschaften – für die wehrlosen Bauern und Dörfler freilich ein Martyrium –, und vor allem: Man setzte alles daran, seine Burgen, die Basis der gegnerischen Stärke, einzunehmen. Deren Eroberung erforderte allerdings nicht selten viel Beharrlichkeit und einen langen Atem.
Nach seinem Herrschaftsantritt in Poitiers nahm Richard unverzüglich den Kampf auf, um sich die Macht zu erobern. Für all jene, die den blutjungen Herzog nicht ernst genommen hatten, gab es ein böses Erwachen. Im Frühjahr und Sommer 1175 bemächtigte er sich der meisten Burgen der Grafschaft Poitou. Danach stieß er in den zentralaquitanischen Raum vor und brachte seinen Herrschaftsanspruch in der Grafschaft Périgord sowie im Limousin zur Geltung. 1176 schlug er eine Erhebung nieder, die von den Söhnen des Grafen Wilhelm V. von Angoulême, dem Herrn von Angoumois, und deren Halbbruder Aimar V. von Limoges, dem Herrn des Limousin, geführt wurde und zeitweilig selbst seine Position im Poitou bedrohte. Gegen Ende des Jahres ging Richard schließlich gegen eine Reihe von Burgherren im Süden vor, welche die Benutzung der zentralen Handels- und Pilgerroute von Bordeaux zu den Pyrenäen bzw. Santiago de Compostella behinderten, und setzte sich in einer für seine Widersacher überraschenden Winteroffensive durch.
Zu seinem Vater unterhielt Richard in jenen Jahren leidlich gute Beziehungen. Unter dem Eindruck des gründlich fehlgeschlagenen Koalitionskrieges, an dem er wahrscheinlich mehr auf Eleonores Betreiben denn aus eigenem Antrieb teilgenommen hatte, nahm er von unbotmäßigem Verhalten Abstand und entsprach der Forderung des übermächtigen Vaters nach Loyalität konsequent. Wohl um seine Vertrauenswürdigkeit zu unterstreichen, erstattete er Heinrich II. regelmäßig Bericht über seine Aktivitäten, oft schriftlich, manchmal auch persönlich. Der König billigte sein Vorgehen und gewährte ihm Unterstützung, wenn es ihm notwendig erschien. Infolge der Revolte im Angoumois und im Limousin etwa versah er Richard 1176 mit beträchtlichen finanziellen Mitteln zur Anwerbung eines kampfstarken Söldnerkontingents und befahl darüber hinaus Heinrich dem Jüngeren militärische Beistandsleistung in Aquitanien. Der Thronfolger erwies sich zwar nicht als sonderlich hilfreich – nach kurzer Präsenz auf dem Kampfschauplatz zog er unverrichteter Dinge wieder von dannen –, doch die Söldnertruppe verschaffte Richard genug militärische Durchschlagskraft, um mit dem Aufstand fertig zu werden.19
6. TAILLEBOURG, 10. MAI 1179
Mit den militärischen Erfolgen der Jahre 1175 bis 1177 konnte Richard seine Macht in Teilen Aquitaniens auf Dauer durchsetzen. Insbesondere bei den Baronen des zentralaquitanischen Raumes jedoch war der Wille zu Widerstand und Rebellion nach wie vor ungebrochen. Gegen Ende des Jahres 1178 verbündete sich Graf Vulgrin III. von Angoulême mit Gottfried von Rancon, der wenige Jahre zuvor noch gemeinsam mit Richard gegen Heinrich II. gekämpft hatte und den jetzt königstreuen Herzog als Feind einstufte.
Aus herzoglicher Sicht verlangte die Erhebung der beiden Barone nach sofortiger Reaktion. Neben dem Umstand, dass Inaktivität Richards Herrschaftsautorität untergraben hätte, erforderten wirtschaftliche Gründe rasches Handeln, da die Kommunikations- und Handelslinien zwischen Poitiers im Norden sowie Bordeaux und der Gascogne im Süden Aquitaniens durch Vulgrins und Gottfrieds Territorien verliefen und daher der Wirtschaftsverkehr des Herzogtums in weiten Gebieten lahmgelegt zu werden drohte. Nachdem er unverzüglich mobil gemacht hatte, rückte Richard gegen Gottfried von Rancon vor, der es mit seinen nahe dem Atlantik gelegenen Festungen in der Hand hatte, den Handelsverkehr an der Küstenlinie zu blockieren.
Der nun folgende, von einigen Rückschlägen geprägte Feldzug zeigte bereits viele Charakteristika, die den späteren Kreuzritterkönig Richard Löwenherz und wahrscheinlich fähigsten europäischen Feldherrn des ausgehenden 12. Jahrhunderts kennzeichneten. Stets zu maximalem persönlichem Einsatz bereit, griff der junge Herzog zunächst neuerlich zur Strategie der Winteroffensive und rückte Ende Dezember 1178 mit seiner Armee gegen die Festung Pons vor, doch die dortige Garnison ließ sich nicht überraschen und wehrte seinen Angriff ab. Daraufhin verbiss er sich in eine Belagerung, die allerdings, obwohl sie den ganzen restlichen Winter dauerte, keinen Erfolg zeitigte. Als die Verteidiger von Pons nach über drei Monaten noch immer standhielten, zog er mit einem Teil seiner Truppen los, um in rascher Folge fünf kleinere Burgen zu erobern und diese bis auf die Grundmauern niederzureißen. Gottfried von Rancon traf trotzdem keine Anstalten, sich zu unterwerfen, woraufhin Richard Ende April 1179 den höchsten Einsatz wagte:20 Er führte seine Armee geradewegs zu Gottfrieds Machtzentrum Taillebourg, das ihm fünf Jahre zuvor noch als Unterschlupf gegen seinen Vater gedient hatte. Damit fällte er eine Entscheidung, die im Fall eines Erfolges den dringend nötigen Sieg bringen würde, jedoch ein erhebliches Risiko darstellte, denn die Festung Taillebourg und die ihr unmittelbar vorgelagerte Stadt galten gemeinhin als uneinnehmbar. Sie befanden sich auf einem Fels, dessen Steilheit auf drei Seiten jeden Angriff vereitelte, wurden auf der vierten Seite durch einen dreifachen Graben sowie eine dreifache Mauer geschützt und von einer ebenso zahlenstarken wie wohl bewaffneten Garnison gehalten. Kein aquitanischer Herzog hatte bisher den Versuch gewagt, diese machtvolle Bastion zu belagern. Aus der Sicht des Chronisten Ralph von Diceto handelte es sich bei Richards Vorstoß um „ein höchst verzweifeltes Unterfangen“21, das für die Zeitgenossen völlig unerwartet kam.
Gottfried von Rancon und seine Garnison, in festem Vertrauen auf die Unbezwingbarkeit der Festung, zeigten sich vom Erscheinen des jungen Plantagenet zunächst wenig beunruhigt und verspotteten ihn. Ihre Selbstsicherheit begann allerdings rasch zu schwinden, denn Richard war wild entschlossen, sein Ziel unter Einsatz all seiner Mittel zu erreichen. Zuerst ließ er die umliegenden Felder verwüsten, die Weingärten zerstören und einige Dörfer niederbrennen. Anschließend begann er, Taillebourg mit Belagerungsmaschinen zu beschießen. Damit nicht genug, errichtete er sein Lager zur Verblüffung Gottfrieds in provokanter Siegesgewissheit direkt unterhalb der Festungsmauern. Zwei Tage erduldete die Garnison den permanenten Beschuss und die Verwüstungsaktionen im Umland, dann erlag sie dem Reiz des verführerisch nahen Lagers und unternahm in der Hoffnung, die Angreifer zu überrumpeln, einen Ausfall. Genau darauf hatte Richard gewartet. Kaum, dass die Verteidiger die schützenden Mauern verlassen hatten, unternahm er mit seinen Männern einen Gegenangriff. Nach einem heftigen Gefecht um den Zugang zur Festung durchbrach er die gegnerischen Reihen, drang mit seinen Soldaten in die Stadt ein, eroberte sie im Sturm und bezog unmittelbar vor der Burg Stellung. Zwei Tage hielt Gottfried von Rancon dem jetzt übermächtigen Druck Richards noch stand. Am 10. Mai 1179 schließlich geschah, was wenige für möglich gehalten hatten: Der Herr von Taillebourg kapitulierte und lieferte seine sämtlichen Besitzungen aus, darunter auch das von Richard lange vergeblich belagerte Pons.22