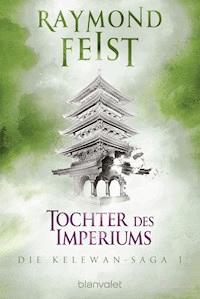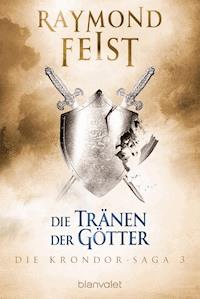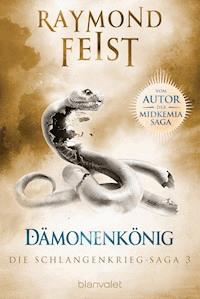7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: DIE KRONDOR-SAGA
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
Die Gilde der Attentäter kehrt nach Krondor zurück wo sie scheinbar ohne Plan oder System töten. Der Junker James und der eben erst ernannte Leutnant William werden mitten in eine düstere Welt aus Mord und Intrigen gestürzt als sie versuchen, den Attentätern auf die Spur zu kommen. Als ein Adeliger aus einem benachbarten Reich umgebracht wird, droht Krondor im Krieg zu versinken. Die Zeit wird knapp und die Stadt wird von Angst beherrscht – die beiden Männer müssen die Verantwortlichen finden und zur Rechenschaft ziehen, bevor es zu spät ist …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 509
Ähnliche
Raymond Feist
Die Krondor-Saga 2
Im Labyrinth der Schatten
Roman
Das Buch
Die Gilde der Attentäter kehrt nach Krondor zurück wo sie scheinbar ohne Plan oder System töten. Der Junker James und der eben erst ernannte Leutnant William werden mitten in eine düstere Welt aus Mord und Intrigen gestürzt als sie versuchen, den Attentätern auf die Spur zu kommen. Als ein Adeliger aus einem benachbarten Reich umgebracht wird, droht Krondor im Krieg zu versinken. Die Zeit wird knapp und die Stadt wird von Angst beherrscht – die beiden Männer müssen die Verantwortlichen finden und zur Rechenschaft ziehen, bevor es zu spät ist …
Der Autor
Raymond Feist wurde 1945 in Los Angeles geboren und lebt in San Diego im Süden Kaliforniens. Viele Jahre lang hat er Rollenspiele und Computerspiele entwickelt. Aus dieser Tätigkeit entstand auch die fantastische Welt Midkemia seiner Romane. Die in den 80er Jahren begonnene Saga ist bereits ein Klassiker des Fantasy-Genres, und Feist gilt als einer der wichtigsten Vertreter der Fantasy in der Tradition Tolkiens.
Die amerikanische Originalausgabe erschien unter dem Titel »Krondor the Assassins, Book Two of the Riftwar Legacy« bei Avon Books, New York.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag weist ausdrücklich daraufhin, dass im Text enthaltene externe Links vom Verlag nur bis zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung eingesehen werden konnten. Auf spätere Veränderungen hat der Verlag keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
1. Auflage Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe Juni 2016 bei Blanvalet, einem Unternehmen der Verlagsgruppe Random House GmbH
Neumarkter Straße 28, 81673 München Deutsche Erstveröffentlichung © 2000 bei Verlagsgruppe Random House GmbH, München Copyright © der Originalausgabe 1999 by Raymond Elias Feist
Für John Cutter und Neal Hallford,denen ich für ihre Kreativität
Inhaltsverzeichnis
Prolog
Abschiede
Die Soldaten marschierten über den Bergkamm.
Arutha hatte den Versorgungstross geteilt; die erste Gruppe – Verwundete und Tote, die in Krondor in Ehren eingeäschert werden würden – setzte sich gerade in Bewegung. Die vielen Wagen und Stiefel wirbelten jede Menge Staub auf, und der feine Puder vermischte sich mit dem beißenden Rauch, der von den erlöschenden Feuerstellen aufstieg. Die aufgehende Sonne schickte ihre orangefarbenen und hellgoldenen Strahlen durch den Dunst, Pfeile aus Farben in einer ansonsten grauen Morgendämmerung. In der Ferne sangen Vögel; sie kümmerten sich nicht um den Nachhall der Schlacht.
Arutha, Prinz von Krondor und Herrscher über den westlichen Teil des Königreichs der Inseln, saß auf seinem Pferd und gestattete sich das Vergnügen, die Herrlichkeit des Sonnenaufgangs und die Serenade aus Vogelgezwitscher zu genießen, während er seinen Männern beim Aufbruch zusah. Die Kämpfe waren glücklicherweise kurz gewesen, aber trotzdem blutig. Zwar waren weniger Opfer zu beklagen gewesen, als er befürchtet hatte, aber er hatte es schon immer gehasst, auch nur einen einzigen Soldaten zu verlieren, der unter seinem Befehl stand. Jetzt ließ er es zu, dass die Schönheit der Landschaft ringsum seine Wut und Trauer eine Zeit lang besänftigten.
Äußerlich unterschied sich Arutha kaum von dem Mann, der zehn Jahre zuvor auf den Thron gekommen war, wenngleich Linien um seine Augen und ein paar graue Strähnen in seinen sonst schwarzen Haaren offenbarten, welchen Tribut das Herrschen von ihm forderte. Wer ihn gut kannte, wusste, dass er auch ansonsten noch immer der gleiche Mann war, ein kompetenter Verwalter, ein militärisches Genie und ein äußerst pflichtbewusster Mann, der sich auch dann unverzüglich opfern würde, wenn es galt, einem Soldaten der untersten Rangstufe das Leben zu retten.
Sein Blick wanderte von einem Wagen zum nächsten, als wollte er sich dazu zwingen, die darin verborgenen Verwundeten zu sehen, als könnte er ihnen so seine Dankbarkeit für die hervorragend ausgeführte Aufgabe übermitteln. Jene, die Arutha nahe standen, wussten, dass er tief in seinem Innern Schmerz über jede Verletzung empfand, die einem Mann zugefügt worden war, der Krondor und dem Königreich diente.
Arutha schob seinen Kummer beiseite und dachte über den Sieg nach. Der Feind – eine verhältnismäßig kleine Armee von Dunkelelben – hatte sich über einen Zeitraum von zwei Tagen zurückgezogen. Eine größere Streitmacht hatte daran gehindert werden können, den Düsterwald zu erreichen, als von den beiden Junkern James und Locklear eine Spaltmaschine zerstört worden war. Ein Magier namens Patrus hatte dabei sein Leben verloren, doch sein Opfer hatte dazu geführt, dass die Eindringlinge ihren eigenen, internen Konflikten anheim fielen. Delekhan, der Möchtegern-Eroberer, war beim Kampf um den Stein des Lebens gestorben, gemeinsam mit Gorath, einem Moredhel-Anführer, der sich als ebenso ehrenvoll und würdig erwiesen hatte wie jedes andere Wesen, dem Arutha bisher begegnet war. Arutha verfluchte die Existenz dieses geheimnisvollen und uralten Artefakts unterhalb der verlassenen Stadt Sethanon, und er fragte sich, ob er es wohl noch erleben würde, dass seine Geheimnisse ergründet und die Gefahren, die in ihm wohnten, beseitigt werden würden.
Delekhans Sohn Moraeulf war durch einen Dolchstoß gestorben, den Narab, einst Verbündeter Delekhans, ihm versetzt hatte. Wie mit Narab vereinbart worden war, verfolgten die Streitkräfte des Königreichs die sich zurückziehenden Moredhel so lange nicht, wie sie sich direkt nach Norden begaben. Es war der Befehl erteilt worden, den Moredhel einen sicheren Weg nach Hause zu gewähren – solange sie sich auf dem Weg dorthin befanden.
Die Streitkräfte des Königs im Düsterwald teilten sich jetzt wieder in ihre unterschiedlichen Garnisonen auf; der größte Teil kehrte nach Westen zurück, einige wandten sich nach Norden zu den Gebieten der Grenzbarone. Sie würden erst später im Laufe des Morgens aufbrechen. Die bisher geheim gehaltene Garnison nördlich von Sethanon würde an einen anderen Ort verlegt und mit frischem Proviant versehen werden.
Arutha begann zu schwitzen, als die Sonne den Morgennebel auflöste und nur noch Rauch und Staub in der Luft hingen. Es wurde bereits heiß, und die Kälte des vergangenen Winters verblasste zu einer fernen Erinnerung. Arutha verdrängte die Sorgen tief in seinem Innern, während er über den letzten Angriff auf den Frieden seines Königreichs nachdachte.
Der Herzog von Krondor war den tsuranischen Magiern nach dem Ende des Spaltkriegs offen und aufrichtig entgegengetreten. Beinahe zehn Jahre lang hatten sie die Freiheit besessen, sich mit Hilfe ihres magischen Spalts zwischen den beiden Welten hin und her zu bewegen. Jetzt hatte er das tiefe Gefühl, hintergangen worden zu sein. Er verstand voll und ganz, welche Gründe den tsuranischen Erhabenen Makala zu dem Versuch getrieben hatten, den Stein des Lebens von Sethanon in seine Gewalt zu bringen – die Überzeugung, dass das Königreich eine Waffe von größter Zerstörungsmacht besaß, eine Maschine mit einer solchen Macht, dass sie im Krieg genau der Person die Vorherrschaft sichern würde, in deren Besitz sie sich befand. Wäre er an Makalas Stelle gewesen und hätte die gleichen Vermutungen gehabt, hätte er möglicherweise ähnlich gehandelt. Aber selbst mit diesem Eingeständnis konnte er die Tsuranis nicht weiter frei nach Belieben im Königreich herumlaufen lassen, was wiederum bedeutete, dass sich ein Jahrzehnt des Handels und des kulturellen Austauschs dem Ende zuneigte. Arutha verdrängte die Sorge, wie er die notwendigen Veränderungen herbeiführen würde, doch er wusste, dass er sich irgendwann mit seinen Beratern zusammensetzen und einen Plan entwickeln musste, um die künftige Sicherheit des Königreichs zu gewährleisten. Und er wusste auch, dass kaum jemand über die Veränderungen, die er bewirken würde, glücklich sein würde.
Arutha warf einen Blick nach rechts und sah zwei sehr junge Männer rittlings auf ihren Pferden. Der Anblick entlockte ihm ein seltenes Lächeln, kaum mehr als ein schwaches Hochziehen der Mundwinkel, das dennoch genügte, den oft sehr ernsten Ausdruck seines noch jugendlichen Gesichts etwas zu mildern. »Müde, meine Herren?«
James, der rangältere Junker des Prinzen, schenkte seinem Herrscher einen Blick aus Augen, die von dunklen Ringen umrahmt waren. James und sein Kamerad, Junker Locklear, hatten einen atemberaubenden Ritt hinter sich, ermöglicht durch magische Kräuter, mit deren Hilfe sie sich tagelang im Sattel wach gehalten hatten. Die Nachwirkungen dieses Tranks – der plötzliche Ausbruch lang unterdrückter Müdigkeit und körperlicher Schmerzen – hatten die beiden jungen Männer unmittelbar danach ereilt. Beide hatten die ganze Nacht in Aruthas Zelt auf Kissen geschlafen, waren am nächsten Morgen aber trotzdem mit schweren Gliedern und trägem Geist erwacht. James kratzte seinen letzten Rest Humor zusammen. »Nein, wir sehen immer so aus, wenn wir wach werden. Nur seht Ihr uns gewöhnlich erst, wenn wir bereits eine Tasse Kaffee getrunken haben.«
Arutha lachte. »Ich sehe, du bist so charmant wie eh und je, James.«
Ein kleiner Mann mit dunklen Haaren und einem dunklen Bart trat zu ihnen.
»Guten Morgen, Hoheit«, sagte Pug und verneigte sich.
Arutha nickte höflich. »Pug, kehrt Ihr mit uns nach Krondor zurück?«
Besorgnis spiegelte sich auf Pugs Gesicht. »Nicht sofort, Hoheit. Ich muss einigen Dingen in Stardock nachgehen. Die Beteiligung der tsuranischen Erhabenen an diesem jüngsten Anschlag auf Sethanon bereitet mir große Sorgen. Ich muss sicherstellen, dass sie die einzigen Magier waren, die damit zu tun hatten, und dass jene, die noch in meiner Akademie leben, frei von jeder Schuld sind.«
Arutha blickte dem abfahrenden Wagen nach. »Wir müssen uns darüber unterhalten, welche Rolle die Tsuranis von Eurer Akademie bei der Sache gespielt haben, Pug. Aber nicht hier.«
Pug nickte zustimmend. Zwar waren alle, die sich in Hörweite befanden, in das Geheimnis des unter Sethanon ruhenden Steins des Lebens eingeweiht, aber es war trotzdem klüger, in Ruhe und Abgeschiedenheit darüber zu reden. Pug wusste außerdem, dass Arutha sich ernste Gedanken wegen des Verrats machte, den der tsuranische Magier Makala begangen hatte – ein Verrat, der zu dieser letzten Schlacht zwischen der Armee des Prinzen und einer eindringenden Armee von Moredhel-Kriegern geführt hatte. Er erwartete, dass Arutha weit einschneidendere Kontrollen darüber fordern würde, wer durch den Spalt – das magische Tor – zwischen Midkemia und Kelewan, der Heimatwelt der Tsuranis, reisen würde.
»Das werden wir, Hoheit. Doch zuerst einmal muss ich für die Sicherheit von Katala und Gamina sorgen.«
»Ich verstehe Euer Anliegen«, sagte der Prinz. Um Pug von Midkemia wegzulocken, war seine Tochter Gamina mittels Magie auf eine ferne Welt entführt worden – während der tsuranische Magier versucht hatte, sich des Steins des Lebens zu bemächtigen.
»Ich muss sicherstellen, dass ich nie wieder wegen eines Familienmitglieds so verletzbar bin.« Er blickte den Prinzen wissend an. »Was William angeht, so kann ich nichts tun, aber ich kann dafür sorgen, dass Gamina und Katala in Stardock in Sicherheit sind.«
»William ist ein Soldat, also ist er schon allein durch seine Arbeit einer gewissen Gefahr ausgesetzt.« Dann lächelte Arutha Pug an. »Aber er ist so sicher, wie ein Soldat nur sein kann, umgeben von sechs Kompanien der Königlichen Krondorianischen Hausgarde. Wer immer versuchen sollte, Euch durch William zu erpressen, wird es schwer haben, überhaupt an ihn heranzukommen.«
Pugs Miene verriet, dass ihm diese Vorstellung ganz und gar nicht gefiel. »Er hätte so viel mehr sein können.« Sein Blick schien Arutha etwas Bestimmtes nahelegen zu wollen. »Er könnte es immer noch. Es ist noch nicht zu spät für ihn, mit mir nach Stardock zurückzukehren.«
Arutha betrachtete den Magier. Er verstand Pugs Enttäuschung, genau wie seinen väterlichen Wunsch, den Sohn wieder in der Familie zu haben. Aber der Ton des Prinzen ließ keinen Zweifel an seiner mangelnden Bereitschaft, zugunsten von Pug einzugreifen. »Ich weiß, dass Ihr wegen seiner Entscheidung Auseinandersetzungen mit ihm gehabt habt, Pug, aber ich muss es Euch überlassen, die Angelegenheiten für Euch befriedigend zu klären. Wie ich Euch schon damals gesagt habe, als Ihr die ersten Einwände gegen Williams Eintritt in meinen Dienst geäußert habt, ist er kraft der Adoption ein königlicher Cousin und ein freier, mündiger Mann, daher gab es für mich keinen Grund, seiner Bitte nicht zu entsprechen.« Bevor Pug einen anderen Einwand äußern konnte, hob er die Hand. »Nicht einmal als Gefallen Euch gegenüber.« Sein Ton wurde weicher. »Abgesehen davon hat er genug Talent, um weit mehr als nur ein durchschnittlicher Soldat zu werden. Er ist ganz schön geschickt, wenn ich den Worten meines Schwertmeisters glauben darf.« Arutha wechselte das Thema. »Ist Owyn bereits unterwegs nach Hause?« Owyn Belefote, der jüngste Sohn des Barons von Timons, hatte sich im jüngsten Kampf als wertvoller Verbündeter von James und Locklear erwiesen.
»Er hat sich gleich bei Tagesanbruch aufgemacht. Er hat gesagt, er hätte mit seinem Vater etwas zu bereinigen.«
Arutha winkte Locklear zu sich, ohne den Blick von Pug abzuwenden. »Ich habe etwas für Euch.« Als Locklear es unterließ, der Geste Folge zu leisten, war Arutha gezwungen, ihn doch direkt anzublicken. »Junker, das Dokument bitte.«
Locklear war kurz davor gewesen, im Sattel einzuschlafen, doch jetzt wurde er schlagartig wach, als die Stimme des Prinzen durch seine benebelten Gedanken drang. Er lenkte sein Pferd neben Pug und reichte ihm ein Pergament.
»Dieses Dokument macht Euch durch meine Unterschrift und mein Siegel zur ersten Autorität bei allen Angelegenheiten, bei denen Magie im Spiel ist, sofern sie den westlichen Teil des Königreichs betreffen«, erklärte Arutha und lächelte leicht. »Es sollte mir keine Schwierigkeiten bereiten, Seine Majestät davon zu überzeugen, dies auf das gesamte Königreich auszudehnen. Wir hören in diesen Angelegenheiten schon lange auf Euch, Pug, aber dieses Dokument verschafft Euch auch Autorität für den Fall, dass Ihr ohne mein Beisein mit einem anderen Edlen oder einem Königlichen Offizier aneinander geratet. Ihr werdet darin zum offiziellen Magier am Hof von Krondor ernannt.«
»Meinen Dank, Hoheit«, sagte Pug. Er schien etwas sagen zu wollen, zögerte aber.
Arutha neigte den Kopf leicht zur Seite. »Es gibt ein ›Aber‹, nicht wahr?«
»Aber ich muss bei meiner Familie in Stardock bleiben. Es gibt viel Arbeit zu tun, und meine Aufgaben dort lassen es nicht zu, dass ich Euch in Krondor diene, Arutha.«
Arutha seufzte leise. »Ich habe verstanden. Aber dadurch fehlt mir noch immer ein Magier am Hof, wenn Ihr nicht bereit seid, in den Palast einzuziehen.«
»Ich könnte Euch Kulgan schicken, damit er Euch ordentlich zusetzt«, sagte Pug mit einem Lächeln.
»Nein, mein früherer Lehrer vergisst allzu leicht meinen Rang und tadelt mich vor meinem Hof. Das ist schlecht für die Moral.«
»Wessen Moral?«, murmelte Jimmy leise.
»Meine natürlich«, sagte Arutha, ohne den Junker anzusehen. Er wandte sich an Pug. »Aber im Ernst, der Verrat von Makala zeigt mir, wie weise mein Vater darin war, einen Berater für die Angelegenheiten der Magie um sich zu haben. Kulgan hat es verdient, sich zur Ruhe zu setzen. Also, wenn nicht Ihr oder der junge Owyn, wer dann?«
Pug dachte einen Augenblick nach. »Ich denke, es gibt da jemanden. Da ist nur ein Problem.«
»Und das wäre?«, fragte Arutha.
»Sie ist Keshianerin.«
»Das heißt, es gibt zwei Probleme«, erwiderte Arutha.
Pug lächelte. »Ich hätte nicht gedacht, dass Eure Hoheit die Vorstellung einer Beraterin befremdlich finden würde – bei einer solchen Schwester und Ehefrau, wie Ihr sie habt.«
Arutha nickte. »Das tue ich auch nicht. Aber viele an meinem Hof werden es … schwierig finden.«
»Ich hatte bisher nicht den Eindruck, dass Ihr Euch übermäßig viel aus der Meinung anderer macht, wenn Ihr Eure Entscheidung erst einmal getroffen habt, Arutha«, meinte Pug.
»Die Zeiten ändern sich, Pug«, antwortete der Prinz. »Und Männer werden älter.« Er schwieg einen Moment und sah zu, wie ein weiteres Kontingent seiner Armee die Zelte abbrach und sich auf den Abmarsch vorbereitete. Dann wandte er sich wieder zu Pug um, die eine Braue fragend gewölbt. »Aber eine Keshianerin?«
»Niemand wird ihr unterstellen, dass sie sich mit dieser oder jener Gruppe am Hof verbünden könnte«, sagte Pug.
Arutha kicherte. »Ich hoffe, Ihr macht einen Scherz.«
»Nein, mache ich nicht. Sie ist ungewöhnlich begabt, trotz ihrer Jugend. Sie ist kultiviert und gebildet, sie kann verschiedene Sprachen lesen und schreiben, und sie hat eine beachtliche Auffassungsgabe und außerordentliche Wahrnehmungsfähigkeit, wenn es um Magie geht, und das ist es ja, was für Euch in diesem Fall am wichtigsten ist. Aber am allerwichtigsten ist, dass sie die Einzige von meinen Studenten ist, die die Bedeutung und die Wirkung von Magie in politischen Zusammenhängen erkennen kann, denn sie ist am Hof von Kesh ausgebildet worden. Sie stammt aus der Jal-Pur-Wüste und hat auch eine Vorstellung davon, wie die Dinge im Westen laufen.«
Arutha schien eine Zeit lang darüber nachzudenken. »Kommt nach Krondor, sobald Ihr es ermöglichen könnt, und erzählt mir mehr darüber. Ich sage nicht, dass ich nicht in Eure Wahl einwillige, doch Ihr müsst mich noch ein bisschen mehr überzeugen.« Er schenkte dem Magier das gewohnte angedeutete Lächeln und wendete sein Pferd. »Aber mir gefällt allein die Vorstellung, die Mienen der Edlen am Hof zu sehen, wenn eine Frau aus Kesh zu ihnen tritt.«
»Ich verbürge mich für sie, darauf gebe ich Euch mein Wort«, sagte Pug.
Arutha blickte ihn über die Schulter hinweg an. »Ihr seid sehr von ihr überzeugt, nicht wahr?«
»Ja. Jazhara ist jemand, der ich das Leben meiner Familie anvertrauen würde. Sie ist nur ein paar Jahre älter als William und hat beinahe sieben Jahre bei uns in Stardock verbracht, das heißt, ich kenne sie etwa ein Drittel ihres Lebens. Sie ist absolut vertrauenswürdig.«
»Das bedeutet einiges. Eine ganze Menge sogar. Also kommt nach Krondor, wann immer Ihr wollt, und wir werden in aller Ruhe darüber sprechen.« Er winkte Pug zum Abschied zu, dann wandte er sich an James und Locklear. »Meine Herren, wir haben einen weiten Ritt vor uns.«
Locklear konnte die Vorstellung, noch mehr Zeit im Sattel zu verbringen, kaum ertragen, auch wenn sie jetzt sicherlich nicht ein solch mörderisches Tempo vorlegen würden.
»Einen Augenblick, wenn Ihr gestattet, Eure Hoheit. Ich möchte gern noch mit Herzog Pug sprechen«, sagte James.
Arutha gab mit einer leichten Handbewegung seine Einwilligung und ritt mit Locklear ein Stück voraus.
Als der Prinz außer Hörweite war, fragte Pug: »Was ist, Jimmy?«
»Wann wolltet Ihr es ihm sagen?«
»Was denn sagen?«, fragte Pug.
Trotz der überwältigenden Müdigkeit gelang es James, sein vertrautes Grinsen auf sein Gesicht zu zaubern. »Dass das Mädchen, das Ihr ihm schicken wollt, die Großnichte von Lord Hazara-Khan von den Jal-Pur ist.«
Pug unterdrückte ein Kichern. »Ich dachte, ich hebe mir das für einen günstigeren Zeitpunkt auf.« Dann veränderte sich seine Miene; jetzt verriet sie Neugier. »Wie hast du das herausgefunden?«
»Ich habe so meine Quellen. Arutha vermutet, dass Lord Hazara-Khan mit den keshianischen Spionen im Westen verbündet ist – was er nach allem, was ich herausfinde, auch tatsächlich ist. Wie auch immer, Arutha überlegt, wie er dem keshianischen Nachrichtendienst mit einer eigenen Organisation begegnen kann – aber das habt Ihr nicht von mir erfahren.«
Pug nickte. »Natürlich nicht.«
»Da ich meine eigenen Ziele habe, halte ich es für angebracht, wenn ich versuche, mich in dieser Angelegenheit auf dem Laufenden zu halten.«
»Und daher hast du ein bisschen herumgeschnüffelt?«
»So in etwa«, gestand James mit einem Schulterzucken. »Und es kann ja schließlich nicht allzu viele edle keshianische Frauen von den Jal-Pur geben, die Jazhara heißen.«
Pug lachte. »Du wirst es noch weit bringen, Jimmy, sofern dich nicht irgendwer vorher hängt.«
James schüttelte seine Müdigkeit ab, als er das Lachen erwiderte. »Ihr seid nicht der Erste, der das sagt, Pug.«
»Ich werde noch genug Gelegenheit haben, die besondere Verwandtschaftsbeziehung des Mädchens zu erwähnen.« Er winkte Arutha und Locklear ein letztes Mal zu. »Du solltest jetzt besser zu den anderen reiten.«
James nickte, während er das Pferd wendete. »Ihr habt Recht. Einen schönen Tag noch, Herzog.«
»Danke, Junker, und dir auch einen schönen Tag.«
James trat seinem Pferd in die Flanken, und das Tier trabte hinter Arutha und Locklear her. Er lenkte sein Pferd neben seinen Freund, während Arutha zu Marschall Gardan ritt, um mit ihm die weitere Auflösung der Armee zu besprechen.
»Was war los?«, fragte Locklear.
»Ich habe Herzog Pug nur etwas gefragt.«
Locklear gähnte. »Ich könnte eine ganze Woche lang ununterbrochen schlafen.«
Arutha hörte die Bemerkung, da er sich ihnen wieder näherte, und antwortete darauf: »Du kannst eine ganze Nacht in Krondor schlafen, sobald wir zurück sind. Aber dann brichst du in den Norden auf.«
»In den Norden, Hoheit?«
»Du bist ohne meine Erlaubnis von Tyr-Sog zurückgekehrt, obwohl ich zugeben muss, dass du gute Gründe dafür gehabt hast. Jetzt ist die Gefahr jedoch vorüber, und du musst zum Hof von Baron Moyiet zurückkehren und deinen restlichen Dienst dort ableisten.«
Locklear schloss die Augen, als hätte er Schmerzen. Dann öffnete er sie wieder. »Ich dachte …«
»… du könntest dich auf diese Weise der Verbannung entziehen?«, beendete James leise.
Arutha hatte Mitleid mit dem erschöpften Jungen. »Diene Moyiet gut, und ich hole dich vielleicht früher nach Krondor zurück. Sofern du keinen Unsinn anstellst.«
Locklear nickte, ohne noch eine Bemerkung von sich zu geben, als Arutha seinem Pferd die Hacken in die Flanken trieb und vorausritt.
»Nun, immerhin kannst du vor deinem Aufbruch noch eine ganze Nacht in einem warmen Bett schlafen«, meinte James.
»Was ist mit dir?«, fragte Locklear. »Sind da nicht noch ein paar unerledigte Angelegenheiten in Krondor, um die du dich kümmern musst?«
James schloss einen Moment die Augen, als würde das Denken ihn ermüden. »Ja, es hat einigen Ärger mit der Gilde der Diebe gegeben. Aber nichts, worüber du dir Sorgen machen müsstest. Das kriege ich schon alles in den Griff.«
Locklear schnaubte und schwieg. Er war zu müde, um sich etwas darauf einfallen zu lassen.
»Ja, nach dieser hässlichen Sache mit den Tsuranis und den Moredhel werden die Angelegenheiten mit den Dieben in Krondor vergleichsweise langweilig sein.«
Locklear blickte seinen Freund an, und er sah, dass James mit den Gedanken längst bei den Spöttern war – bei der Gilde der Diebe. Und mit einem Frösteln begriff er, dass sein Freund etwas herunterspielte, was eigentlich sehr ernst zu nehmen war, denn die Gilde der Diebe hatte James mit dem Todesbann belegt – damals, als er sie verlassen hatte, um dem Prinzen zu dienen.
Und da war noch mehr, spürte Locklear. Doch dann erinnerte er sich, dass das immer so war, wenn es um James ging.
Eins
Rettung
Die Geräusche der Verfolger hallten durch die dunklen Gänge.
Limm war fast völlig außer Atem von dem Versuch, jenen zu entkommen, die fest entschlossen waren, ihn zu töten. Der junge Dieb flehte zu Ban-ath, dem Gott der Diebe, dass seine Verfolger die Abwasserkanäle von Krondor nicht so gut kannten wie er. Ihm war klar, dass er ihnen weder davonlaufen noch gegen sie kämpfen konnte; seine einzige Hoffnung war, sie auszutricksen.
Der Junge wusste, dass Panik sein größter Feind war, und während er sich in dem Schatten hielt und vor den Männern floh, die ihn töten wollten, kämpfte er gegen die schreckliche Angst an, die aus ihm ein verängstigtes Kind zu machen drohte – ein Kind, das sich an alles klammerte, was Zuflucht und Geborgenheit bieten mochte. Er blieb einen Augenblick an einer Stelle stehen, wo sich zwei große Abwasserkanäle kreuzten, und wandte sich dann nach links, ertastete sich in der Dunkelheit seinen Weg. Seine einzige Lichtquelle war eine kleine, zerbrochene Lampe. Er hatte das Schiebefenster bis auf einen winzigen Spalt geschlossen, denn er benötigte nur einen schwachen Schimmer, um sich orientieren zu können. Es gab Bereiche im System der Abwasserkanäle, in die von oben Licht gelangte – durch Abzugskanäle, Roste, zerbröckelte Pflastersteine und andere Spalten und Lücken. Dieses bisschen Licht reichte ihm, um seinen Weg entlang der stinkenden Seitenwege unterhalb der Stadt zu finden. Aber es gab auch Bereiche, in denen totale Finsternis herrschte und er so wenig sehen konnte, als wäre er blind.
Er erreichte eine Stelle, wo sich der Umfang des runden Tunnels verringerte, und er duckte sich, um sich nicht den Kopf an der kleineren Öffnung zu stoßen. Seine nackten Füße ließen das dreckige Wasser aufspritzen, das sich am Ende des größeren Abwasserkanals sammelte, bis es weit genug gestiegen war, um wieder eine schäbige Röhre hinabzustürzen.
Limm spreizte die Beine und bewegte sich leicht hoppelnd voran, setzte die Füße so hoch wie möglich an den Seiten des runden Durchgangs auf, denn er wusste, dass weniger als drei Meter vor ihm eine hässliche Mündung im Boden war, die den Abfall in einen riesigen Kanal sechs Meter tief nach unten schickte. Die harten Schwielen an seinen Füßen verhinderten, dass der schroffe Untergrund ihm die Sohlen aufschlitzte. Der Junge schloss das Schiebefenster der Lampe, als er auf einen Tunnel traf, der eine weite Strecke geradeaus führte; er hatte hier kein Problem, sich zurechtzufinden, und er wollte nicht das geringste Risiko eingehen, dass seine Verfolger auch nur den kleinsten Lichtschimmer bemerken konnten. Er tastete sich um eine Ecke herum und betrat den nächsten Gang; er war über hundert Meter lang, und hier war selbst ein äußerst schwaches Licht vom einen Ende zum anderen sichtbar.
Auf diese Weise eilte er weiter, so gut es ging. Er spürte den Druck des Wassers an seinen Füßen, als es mit lautem Rauschen aus einer Öffnung im Rohr von neuem gespeist wurde. Es gab noch andere Mündungen, die sich in dieses Gebiet ergossen – unter den ortsansässigen Dieben auch als »die Quelle« bekannt. Das Plätschern und Gurgeln hallte durch die Röhre und machte es schwierig, die genaue Quelle zu orten, daher kam er nur langsam voran. Schon ein Fehltritt von nur zehn Zentimetern konnte seinen Tod bedeuten.
Etwa drei Meter weiter wäre er beinahe gegen ein Gitter geprallt, so sehr konzentrierte er sich auf die Geräusche derjenigen, die ihn verfolgten. Er kauerte sich hin, machte sich so klein wie möglich, um für den Fall, dass ein Lichtreflex den Tunnel erhellte, keine Zielscheibe abzugeben.
Kurz darauf drangen Stimmen zu ihm; anfangs war es ihm unmöglich, die Worte zu verstehen. »… kann nicht allzu weit gekommen sein. Er ist doch bloß ein Junge«, hörte er jemanden sagen.
»Er hat uns gesehen«, sagte der Anführer, und der Junge wusste nur zu gut, wer der Sprecher war. Das Bild des Mannes und jener, die ihm dienten, hatte sich tief in seinen Kopf gegraben, obwohl er sie nur wenige Augenblicke gesehen hatte, bevor er sich abgewandt hatte und geflohen war. Er kannte zwar nicht den Namen des Mannes, aber er kannte diese Sorte Mensch. Zeit seines Lebens hatte Limm unter solchen Männern gelebt, obwohl er nur wenigen begegnet war, die so gefährlich waren wie jene, die hinter ihm her waren.
Limm machte sich keine Illusionen, was seine Fähigkeiten betraf; er wusste, dass er es niemals auf einen Kampf gegen solche Männer ankommen lassen konnte. Mit dem waghalsigen Verhalten, das er häufig zur Schau stellte, versuchte er lediglich, denen, die stärker waren als er, vorzumachen, dass sie kein leichtes Spiel mit ihm haben würden, und seine Bereitschaft, dem Tod ins Auge zu sehen, hatte ihm mehr als einmal den Hals gerettet. Aber er war kein Narr: Limm wusste, dass diese Männer ihm gar nicht erst die Zeit lassen würden, ihnen etwas vorzumachen. Ohne jegliches Zögern würden sie ihn töten, denn er konnte sie mit einem schrecklichen Verbrechen in Verbindung bringen.
Der Junge blickte sich um und sah Wasser von oben herabrinnen. Trotz des Risikos, entdeckt zu werden, öffnete er den Schieber seiner Lampe einen winzigen Spalt und ließ einen kurzen Augenblick einen schwachen Lichtstrahl auf die Stelle fallen. Das Gitter, vor dem er stand, reichte nicht ganz bis zur Tunneldecke, und auf der anderen Seite führte ein Weg durch die Decke hinauf.
Ohne zu zögern kletterte der Junge das Gitter hinauf und steckte den Arm durch den schmalen Spalt; aufgrund seiner Erfahrung konnte er einigermaßen abschätzen, ob er durch diese Engstelle passen würde. Er betete zu Ban-ath, dass er nicht allzu sehr gewachsen war, seit er das letzte Mal eine solche Übung ausgeführt hatte. Limm kletterte höher und wandte sich um. Zuerst steckte er seinen Kopf durch die Öffnung, indem er ihn zur Seite drehte und sich dann mit dem Gesicht voran zwischen oberster Gitterkante und Gemäuer hindurch nach vorn schob. Es hatte sich im Laufe der Zeit herausgestellt, dass seine Ohren weniger litten, wenn sie während der Prozedur nicht nach hinten abgeknickt waren. Das dringende Gefühl, sich beeilen zu müssen, überwältigte ihn, ließ ihn die Schmerzen vergessen, während seine Verfolger unbarmherzig näher rückten. Doch die Wangen brannten immer stärker, je weiter er sich durch die kleine Lücke schob. Blut und Schweiß rannen ihm über das Gesicht, und seine Lippen schmeckten nach Salz und Eisen. Ihm kamen die Tränen, doch er gab auch dann keinen Laut von sich, als er sich beide Ohren grausam aufschabte – das eine am Stein, das andere am schmutzigen Eisengitter. Einen Augenblick drohte Panik ihn zu überwältigen, denn die Fantasie gaukelte ihm Bilder vor, in denen er hilflos zwischen Gitter und Gewölbedecke eingeklemmt hing, während seine Verfolger zu ihm eilten und nach ihm griffen.
Dann hatte er den Kopf hindurchgezwängt. Er schob die eine Schulter nach. Im Stillen hoffend, dass er das Gelenk nicht würde ausrenken müssen, um durchzukommen, machte er weiter, zwängte auch die zweite Schulter hindurch. Er atmete tief aus und zog die Brust nach. Mit der zweiten Hand hielt er jedoch noch die Laterne, und er begriff plötzlich, dass sie nicht hindurchpassen würde.
Er holte tief Luft, ließ sie los und stieß sich vollends durch die schmale Lücke. Als die Laterne mit lautem Geschepper auf die Steine fiel, hing er bereits auf der anderen Seite am Gitter.
»Er muss da vorne sein!«, kam ein Schrei ganz aus der Nähe, und Licht erhellte den Tunnel.
Limm erstarrte einen Augenblick und schaute sich suchend um. Genau über ihm befand sich das Loch, das in dem schwachen, aber eilig näher kommenden Licht kaum zu erkennen war. Er schob sich weiter hoch, stemmte die Handflächen gegen die Wände des senkrechten Schachts und stellte die Füße auf das Gitter. Erst musste er sich mit den Händen an etwas festhalten, bevor er sich mit den Füßen abstoßen konnte. Er betastete die Oberfläche des Schachts, bis seine Finger schließlich zwischen zwei Steinen einen tiefen Spalt fanden; er hatte gerade einen weiteren aufgetan, als irgendetwas seinen nackten Fuß berührte.
Spontan schüttelte er es mit einem kräftigen Fußtritt ab, und jemand fluchte laut. »Verdammte Kanalratten!«
»Da kommen wir nicht durch!«, meinte eine andere Stimme.
»Wir vielleicht nicht, aber meine Klinge!«
Der junge Dieb nahm seine ganze Kraft zusammen und zog sich in den Schacht empor. Was er tat, war höchst gefährlich – er legte die Hände in den Rücken und drückte sich mit aller Kraft gegen die Wand, während er die Füße vom sicheren Halt des Gitters löste und emporzog, sie in einer nahezu akrobatischen Darbietung mit unglaublichem Druck gegen die gegenüberliegende Seite presste. Er hörte das Schrappen von Metall auf Eisen, als jemand sein Schwert durch das Gitter steckte. Limm wusste, dass er durchbohrt worden wäre, hätte er auch nur einen Augenblick länger gezögert.
»Er ist durch diesen Schornstein da verschwunden!«, fluchte jemand.
»Dann muss er im Stockwerk drüber ja wieder rauskommen!«, meinte ein anderer.
Einen Augenblick lang spürte Limm, wie sein Rücken am Hemd entlang etwas hinabrutschte und seine nackten Füße über den glatten Stein glitten. Er verstärkte den Druck und betete, dass er die Position halten konnte. Unten entstand Bewegung, und er lauschte.
»Er ist weg!«, rief einer seiner Verfolger. »Wenn er noch da oben gewesen wäre, hätte er doch längst runterfallen müssen!«
Der Junge erkannte die Stimme des Anführers. »Lauft zum nächsten Stockwerk und verteilt euch! Wer ihn tötet, kriegt eine Prämie! Ich will die Ratte noch vor morgen früh tot sehen!«
Limm kletterte Stück für Stück weiter nach oben – eine Hand, ein Fuß, die andere Hand, der andere Fuß. Für jede zwei Zentimeter, die er gewann, verlor er einen wieder. Es ging nur langsam voran, und seine Muskeln schrien geradezu nach einer Pause, aber er kämpfte sich weiter hinauf. Ein kühler Luftzug wehte von oben herab und verriet ihm, dass er den Abwasserkanälen des nächsten Stockwerks schon sehr nahe sein musste. Er hoffte inständig, dass die Röhre groß genug für ihn war, denn ihm war ganz und gar nicht danach, den Schacht wieder hinab und durch das Gitter zurückzuklettern.
Er erreichte den Rand des Schachts und hielt kurz inne. Dann nahm er einen tiefen Atemzug, drehte sich um und griff mit einer raschen Bewegung an die Kante. Die eine Hand rutschte auf etwas Dickem und Klebrigem aus, aber mit der anderen gelang es ihm, sich festzuhalten. Obwohl er noch nie eine Neigung zum Baden verspürt hatte, sehnte er sich jetzt geradezu danach, den Schmutz loszuwerden und saubere Kleidung anzuziehen.
Der Junge blieb eine kurze Zeit still so hängen und wartete. Er wusste, dass die Männer, die ihn verfolgten, jeden Augenblick auftauchen konnten. Er lauschte.
Limm war vom Wesen her eigentlich eher spontan, doch er hatte gelernt, dass voreiliges Handeln in riskanten Situationen manchmal große Gefahren bergen konnte. Sechs andere Jungen waren etwa zur selben Zeit zum Spötterschlupf gekommen wie er. Sie waren inzwischen alle tot. Zwei waren durch einen Unfall gestorben – sie waren von den Dächern gestürzt. Drei waren in jener Zeit, als besonders hartes Durchgreifen angesagt gewesen war, als gemeine Diebe von den Beamten des Prinzen gehängt worden. Der letzte Junge war in der vorigen Nacht durch die Hand der Männer gestorben, die jetzt Limm verfolgten. Denn es war dieser Mord gewesen, den Limm beobachtet hatte.
Der Junge wartete, bis sich sein rasender Puls beruhigt hatte und er wieder gleichmäßiger atmete. Dann hievte er sich über den Rand und fand sich in einer anderen großen Röhre wieder. Er verschwand sofort in der Dunkelheit, indem er sich an der rechten Wand entlangtastete. In den meisten Tunneln hätte er sich auch blind zurechtgefunden, aber er wusste auch, wie leicht es war, sich vollkommen zu verirren. Dazu genügte es schon, ein einziges Mal falsch abzubiegen oder irgendeinen unscheinbaren Seitentunnel zu übersehen. In diesem Viertel der Stadt lag eine zentrale Zisterne, und da Limm wusste, wo er sich im Verhältnis zu ihr befand, besaß er etwas, das ihm genauso gut half wie eine Karte – allerdings nur, solange er einen klaren Kopf behielt und sich konzentrierte.
Er kroch weiter, lauschte auf das schwache Gurgeln und Plätschern des Wassers und drehte den Kopf erst in die eine, dann in die andere Richtung, um sicherzugehen, dass das Geräusch auch wirklich vom Abwasserkanal kam und kein Echo war, das von den Steinen widerhallte. Während er sich blind weitertastete, dachte er über den Wahnsinn nach, der die Stadt in den letzten Wochen befallen hatte.
Zuerst hatte es wie ein eher unwichtiges Problem ausgesehen: Eine neue, rivalisierende Bande war aufgetaucht, wie es von Zeit zu Zeit immer mal wieder geschah. Gewöhnlich genügte ein Besuch von den Schlägern der Spötter oder eine kleine Bestechung seitens der Männer des Sheriffs, und das Problem war aus der Welt geschafft.
Dieses Mal war es anders gewesen.
Eine neue Bande war an den Docks aufgetaucht, darunter eine große Anzahl keshianischer Verbrecher. Das allein war jedoch kaum der Erwähnung wert, denn Krondor war für Kesh ein wichtiger Handelshafen. Was diese neue Gruppe so ungewöhnlich machte, war die Gleichgültigkeit, die sie gegenüber den Drohungen der Spötter zeigte. Ihr Verhalten war im höchsten Maße herausfordernd, sie bestachen Amtspersonen und forderten die Spötter auf, sich mit ihnen auseinander zu setzen. Sie schienen eine Konfrontation geradezu heraufbeschwören zu wollen.
Als die Spötter schließlich gehandelt hatten, war es ein Desaster gewesen. Elf der gefürchtetsten Schläger – die Vollstrecker der Diebesgilde – waren in ein Lagerhaus am Ende eines halb verlassenen Docks gelockt und dort eingesperrt worden. Dann hatte man das Gebäude angezündet, so dass alle elf verbrannt waren. Von diesem Augenblick an war in Krondors Unterwelt der Krieg ausgebrochen.
Den Spöttern wurde hart zugesetzt, doch auch die Eindringlinge, die für jemanden arbeiteten, der nur als der Kriecher bekannt war, bekamen es zu spüren, als der Prinz von Krondor sich eingemischt hatte, um die Ruhe in seiner Stadt wiederherzustellen.
Es ging das Gerücht, dass Männer, die sich als Nachtgreifer – Mitglieder der Gilde der Attentäter – verkleidet hatten, Wochen zuvor in den Abwasserkanälen gesichtet worden waren. Sie hätten der Köder sein sollen, so hieß es, der die Armee des Prinzen hinter sich her locken und dazu veranlassen sollte, die Spötter zu vernichten. Man war davon ausgegangen, dass die Garde des Prinzen, wäre sie in genügender Anzahl in die Abwasserkanäle hinabgestiegen, sämtliche unter den Straßen lebende Menschen – Attentäter, falsche Nachtgreifer, Spötter – ausgelöscht oder gefangen genommen hätte. Es war ein raffinierter Plan gewesen, aber er hatte keinerlei Erfolg gehabt.
Junker James, der ehemals unter dem Namen Jimmy die Hand ein Mitglied der Spötter gewesen war, hatte die List vereitelt, bevor er plötzlich verschwunden war, weil er einen Auftrag für den Prinzen auszuführen hatte. Dann hatte der Prinz seine Armee aufmarschieren lassen und war mit ihr aufgebrochen. Und wieder hatte der Kriecher zugeschlagen.
Seither versteckten sich beide Seiten, die Spötter in ihrem Spötterschlupf, dem gut verborgenen Hauptquartier, und die Männer des Kriechers in einem unbekannten Versteck irgendwo bei den nördlichen Docks. Wer auch immer versucht hatte, den genauen Ort des Hauptquartiers des Kriechers herauszufinden, war niemals wieder zurückgekehrt.
Die Abwasserkanäle waren zu einer Art Niemandsland geworden. Nur wenige wagten es, sich dort aufzuhalten, und auch nur, wenn es einen triftigen Grund dafür gab. Limm würde auch längst im sicheren, geschützten Spötterschlupf sein, wären nicht zwei Dinge geschehen: Er hatte von einem schrecklichen Gerücht erfahren und die Nachricht eines alten Freundes erhalten. Niemals hätte das Gerücht allein oder nur die Nachricht ihn aus seinem Versteck locken können, doch die Mischung von beidem hatte ihm keine andere Wahl gelassen, als zu handeln.
Spötter hatten gewöhnlich wenig Freunde; die Loyalität zwischen Dieben entsprang selten einer Zuneigung, sondern dem großen Misstrauen all jener, die außerhalb der Gilde standen, und der Furcht vor den anderen. Seinen Platz in der Bruderschaft der Diebe verdiente man sich, indem man Stärke und Verstand bewies.
Gelegentlich entwickelte sich aber doch eine Freundschaft, ein tieferes Band als das, welches gewöhnlich existierte, und diese wenigen Freunde waren es wert, um ihretwillen ein gewisses Risiko einzugehen. Limm kannte weniger als eine Hand voll Leute, für die er überhaupt irgendein Risiko eingegangen wäre, und schon gar nicht eines, das zu einer Gefangennahme oder womöglich zu seinem Tod führen konnte. Aber jetzt waren zwei von den Spöttern in Not, und er musste ihnen unbedingt von dem Gerücht erzählen.
Weiter vorn in der Dunkelheit rührte sich etwas, und Limm erstarrte. Er wartete und lauschte, ob er ein unpassendes Geräusch hörte. Der Abwasserkanal war alles andere als still, denn im Hintergrund war – zusätzlich zu dem unentwegten Tröpfeln, dem Scharren der Ratten und des anderen Ungeziefers – ein ständiges Geräusch zu hören, als in der Ferne grollend Wasser durch den großen Abflusskanal rauschte, durch den gewöhnlich der Abfall der Stadt hinter die Hafenmündung geleitet wurde.
Limm bedauerte, dass er jetzt kein Licht mehr bei sich hatte, und wartete. Geduld war bei Jungen seines Alters, die nicht zu den Spöttern zählten, eine seltene Gabe, doch ein voreiliger Dieb war nur zu schnell ein toter Dieb. Limm verdiente sich seine Bleibe bei den Spöttern, indem er der beinahe geschickteste Taschendieb von ganz Krondor geworden war, und seine Fähigkeit, sich still und ohne Aufsehen zu erregen, durch die Menschenmenge am Markt oder geschäftige Straßen hindurchzuschlängeln, hatte ihm hohe Achtung von Seiten der Führung der Gilde eingebracht. Die meisten Jungen in seinem Alter arbeiteten noch immer zu mehreren auf der Straße – Bengel, die für Ablenkung sorgten, während andere Spötter Waren von den Karren zerrten oder ein fliehender Dieb das Weite suchte.
Limms Geduld wurde belohnt, als er das schwache Geräusch eines Stiefels auf Stein vernahm. Ein kurzes Stück weiter vorn vereinigten sich zwei große Abflusskanäle. Er würde durch das langsam dahinfließende Abwasser waten müssen, um die andere Seite zu erreichen.
Es war ein guter Platz, um zu warten, dachte der junge Dieb. Das Geräusch, das er verursachen würde, wenn er durchs Wasser ging, würde jeden in der Nähe aufscheuchen, und seine Verfolger wären hinter ihm her wie Jagdhunde hinter einem Hasen.
Limm wog im Stillen seine Möglichkeiten ab. Es gab keinen Weg, der an dieser Verbindungsstelle vorbeiführte. Er konnte den Weg zurückgehen, den er gekommen war, aber das würde bedeuten, dass er sich weitere Stunden durch die gefährlichen Abwasserkanäle unter der Stadt würde quälen müssen. Er konnte darauf verzichten, den anderen Abflusskanal zu durchqueren, indem er nach rechts um die Ecke bog, sich an der Wand entlanghangelte, um nicht gesehen zu werden, und dann einfach diesen Gang weiterschritt. Hatte er die Kreuzung erst einmal hinter sich gelassen, war das Schlimmste überstanden.
Limm ging weiter, vorsichtig einen Fuß vor den anderen setzend, damit nicht ein Stein verrutschte oder irgendein anderer Gegenstand ihn verriet. Er unterdrückte den Impuls zu rennen, hielt seinen Atem unter Kontrolle und zwang sich, langsam weiterzugehen.
Schritt für Schritt näherte er sich der Kreuzung der beiden Gänge, und als er die Ecke erreicht hatte, an der er abbiegen wollte, hörte er ein weiteres Geräusch. Ein leichtes Schrappen von Metall auf Stein, als würde ein Schwert oder eine Scheide sanft an einer Wand entlangstreichen. Er erstarrte.
Selbst im Dunkeln hielt Limm seine Augen geschlossen. Er wusste nicht, wieso, doch mit geschlossenen Augen arbeiteten seine anderen Sinne noch besser. Er hatte sich in der Vergangenheit eine Zeit lang Gedanken darüber gemacht herauszufinden, warum das so war. Er wusste einfach, dass sein Gehör und sein Tastsinn darunter litten, wenn er auch nur ein bisschen Energie darauf verschwendete, etwas sehen zu können – selbst im Stockdunkeln.
Nachdem Limm eine Zeit lang still und reglos verharrt hatte, hörte er Wasser auf sich zurauschen. Jemand – ein Ladeninhaber oder ein Arbeiter der Stadt – musste eine Zisterne geklärt oder eine der kleineren Schleusen geöffnet haben, aus denen sich der Abwasserkanal speiste. Das leise Geräusch genügte, um ihm das Weitergehen zu ermöglichen, und er hatte die Ecke rasch umrundet.
Limm eilte – noch immer vorsichtig – weiter; er spürte, wie der Drang, den Wächter der Kreuzung – wer immer es sein mochte – so weit wie möglich hinter sich zu lassen, immer stärker wurde. Insgeheim zählte er die Schritte, und als er einhundert erreicht hatte, öffnete er die Augen.
Wie erwartet, war vor ihm ein schwacher Lichtfleck zu sehen, von dem er wusste, dass er von einem offenen Gitter des Westlichen Marktplatzes herrührte. Es war nicht so viel Licht vorhanden, dass er wirklich gut sehen konnte, aber es genügte, um erkennen zu können, wo er sich befand.
Er bewegte sich rasch weiter und erreichte eine andere Kreuzung. Er ließ sich in den widerlichen Abwasserkanal hinab und durchquerte den jetzt fließenden Strom aus Abfällen, bis er – ohne allzu laute Geräusche verursacht zu haben – die andere Seite erreichte.
Schnell erklomm er den neben der Wasserrinne verlaufenden Weg und lief weiter. Er wusste, wo seine Freunde sich verschanzten, und er wusste auch, dass es ein verhältnismäßig sicherer Ort war – abgesehen davon, dass angesichts der neuen Umstände der letzten Zeit eigentlich gar kein Ort mehr wirklich sicher war. Was einst die Straße der Diebe genannt worden war – der Bereich über den Dächern von Krondor –, war jetzt genauso offenes Kriegsgebiet wie die Abwasserkanäle. Die Bürgerschaft von Krondor mochte sich in ihrem Unwissen über den Krieg, der über ihren Köpfen und unter ihren Füßen tobte, glücklich wähnen, aber Limm wusste es besser; er wusste, dass er nicht nur den Männern des Kriechers begegnen konnte, sondern auch mit den Soldaten des Prinzen rechnen musste, oder mit den Mördern, die sich als Nachtgreifer ausgaben. In diesen Tagen war es notwendig, nicht nur jenen nicht zu trauen, die er gar nicht kannte, sondern auch nur bedingt jenen, die er lediglich mit Namen kannte.
Limm blieb stehen und betastete die Wand zu seiner Linken. Er war so weit gegangen, wie er seiner Schätzung nach gehen musste, und bemerkte jetzt voller Zufriedenheit, dass er sich nur einen Fuß entfernt von den Eisensprossen befand, die in die Mauer eingelassen waren. Er kletterte an ihnen hoch. Noch immer so gut wie blind betrat er einen Steinschacht und begriff rasch, dass er den Grund eines Kellers erreicht hatte. Er streckte die Hand aus und griff nach dem Riegel. Als er vorsichtig daran zog, stellte er fest, dass die Tür von der anderen Seite verschlossen worden war.
Er klopfte: zweimal schnell, Pause, wieder zweimal schnell, Pause, einmal. Er wartete, zählte bis zehn und wiederholte das Muster dann in umgekehrter Reihenfolge: einmal, Pause, zweimal schnell, Pause, zweimal schnell. Der Riegel auf der anderen Seite glitt auf.
Die Falltür schwang nach oben, doch der Raum über ihm war ebenso dunkel wie der Abwasserkanal unter ihm. Wer immer dort oben wartete, wollte ungesehen bleiben.
Als Limm sich nach oben hievte, wurde er von starken Armen ergriffen und hochgezogen, und die Falltür wurde rasch wieder geschlossen. »Was hast du da unten gemacht?«, flüsterte eine weibliche Stimme.
Limm ließ sich auf den Steinboden sinken. Die Müdigkeit überschwemmte ihn jetzt geradezu. »Ich bin um mein Leben gerannt«, sagte er leise. Als er etwas Atem geschöpft hatte, fuhr er fort. »Gestern Nacht habe ich gesehen, wie Jackie umgebracht worden ist. Es waren Schläger des Kriechers.« Er schnippte mit den Fingern. »Sie haben ihm das Genick gebrochen, als wäre er nichts weiter als ein Hühnchen. Sie haben Jackie nicht einmal Zeit gelassen, um sein Leben zu betteln oder ein Gebet zu sprechen. Wie eine Küchenschabe haben sie ihn zermalmt.« Er stand kurz davor zu weinen, als er ihnen das sagte – zusätzlich überwältigt von der Erleichterung darüber, dass er jetzt zum ersten Mal seit Stunden verhältnismäßig sicher war. »Aber das ist nicht das Schlimmste.«
ENDE DER LESEPROBE