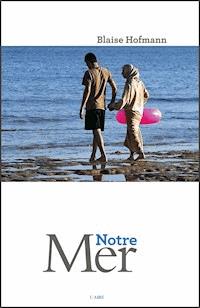Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Atlantis Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Während in der Stadt immer mehr Menschen von einem Leben im Einklang mit der Natur träumen, ist der Bauer zunehmend in die Kritik geraten. Er vergifte die Erde, rufen die, die eine Gersten- nicht von einer Weizenähre unterscheiden können. Als Blaise Hofmann, Sohn und Enkel von Bauern, zurück aufs Dorf zieht, bekommt er den tiefen Graben zu spüren und macht sich auf, den Dialog zwischen Stadt und Land, wo man offenbar gar nicht mehr dieselbe Sprache spricht, wiederzubeleben. Er hört eingefleischten und veganen Bauern zu, trifft Bio-Produzenten, lernt Micro-Farming, Bakterienpflege, Wurzelökologie kennen – und entdeckt eine Welt, die sich aller gängigen Vorstellungen zum Trotz, ständig neu erfindet. Auch wenn der kunstvoll aufgeschichtete Misthaufen von den meisten Höfen verschwunden ist und man automatisierte Entmistungsanlagen nutzt, vor allem aber Formular um Formular ausfüllt, um das Anrecht auf die Direktzahlungen geltend zu machen, sieht sich der Bauer immer noch in der Verantwortung, die Bevölkerung zu ernähren und mit gesunden Produkten zu versorgen. In seinem Buch – Tagebuch, literarische Reportage und Pamphlet zugleich – untersucht Hofmann umfassend und faktenreich die Krise, in der Ackerbau und Viehzucht heute stecken, und verteidigt zugleich den Traum von einer hundertprozentig nachhaltigen Landwirtschaft, die eine Herausforderung für die ganze Gesellschaft bedeutet.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 172
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Blaise Hofmann
Die Kuh im Dorf lassen
oder die Herausforderungen einer nachhaltigen Landwirtschaft in der Schweiz
atlantis
Für meine Großeltern in Villars-sous-Yens
Für meine Großeltern in Vulliens
Für ihre Kinder, Enkel und Urenkel
Für alle künftigen Bäuerinnen und Bauern
Wenn aus Gras keine Milch mehr wird
Hätte man Großvater Hofmann zu Lebzeiten gesagt, dass der Haufen einmal verschwinden und dort ein Parkplatz entstehen würde, hätte er nur spöttisch gelächelt, was so viel bedeutete wie: Blödsinn.
Der Haufen thronte vor dem Bauernhof auf dem Betonsockel gegenüber des zweiflügeligen Tors zum Stall. Im Laufe des Winters konnte er bis zu zwei Meter hoch werden, Großvaters ganzer Stolz. Ein sauber aufgeschichteter, makelloser Misthaufen »nach Berner Art«.
Ich sehe sie noch alle vor mir, Onkel Hans, meinen Vater, den Lehrbub, Carlos oder Manuel, wie sie morgens und abends mit ihrer Schubkarre aus dem Stall kamen. Mit verkniffenen Zügen, hochkonzentriert, peilten sie die Rampe an, ein robustes, jedoch schmales Brett, und kippten oben die Karre aus, um das Gemisch aus Stroh und Kuhmist mit einer vierzackigen Gabel zu verteilen. Sie schichteten zuerst die Ecken schön auf, dann die Seiten, danach trampelten sie mit ihren hohen Gummistiefeln darauf herum, das verlangsamt den Gärungsprozess. Zwar setzt das Herumtrampeln nicht nur Luft, sondern auch Stickstoff frei, aber dafür können die Bakterien sich an die Arbeit machen und den wertvollen Humus produzieren; deswegen ist es in einem Misthaufen warm, deswegen dampft er auch im Winter.
Die Autos mussten vor der Kreuzung auf der Höhe des Misthaufens abbremsen, manchmal auch in seiner Nähe parken, wenn man in dem kleinen Lebensmittelladen der Genossenschaftsmolkerei von Villars-sous-Yens einkaufen wollte. Manche Leute hielten sich vor diesem dampfenden Kunstwerk, dessen Bedeutung ihnen entging, die Nase zu: eine Ode an den Graskreislauf, dank der Ausscheidungen unserer vor zehntausend Jahren domestizierten Wiederkäuer. Ein Kreislauf, der auch die Weizenfelder einschließt: die weiten gelben rechteckigen Flächen, die schön in der Landschaft liegen und Streu und Stroh liefern. Der gewonnene Mist kehrt mit seinen Nähr- und Wirkstoffen als Dünger, als geballte Lebenskraft und Energie in die Erde zurück und beschenkt uns mit gutem Gras, mit gelbem und grünem Weizen, mit Fleisch und Milch.
Die Kundschaft hatte nicht die Muße, ihn zu betrachten, zu bemerken, was hier so kunstvoll und zu welchem Zweck überhaupt aufgeschichtet war, und dem Bauern zu gratulieren, der sich im Gegensatz zu den Passanten manchmal auf die Holzbank neben der Stalltür setzte, die getane Arbeit zu bewundern, weil er wusste, dass ein guter Misthaufen das beste Mittel ist, um einen müden Boden zu kräftigen, eine ausgetrocknete, widerständige Erde zu beleben.
Auf dem Land wurde die Mitgift nach der Größe des Misthaufens des elterlichen Hauses bestimmt.
Die Jauche war das schwarze Gold der Ställe.
Der Mist, die Hefe des Bodens.
Als mein Vater im elterlichen Betrieb auf dem Belpberg im Berner Mittelland seinen Beruf erlernte, um später in die Westschweiz zu ziehen, hatten die Bauern nie mehr Vieh, als ihre Felder und Weiden versorgen konnten. Man importierte kein Futter, verwendete keine künstlichen Düngemittel. Man tat, was zu tun war, und niemand sprach von Nachhaltigkeit, ökologischer Verantwortung, Harmonie zwischen Mensch, Tier und Natur. Man tat es einfach. Man wusste nicht, dass ein Kubikmeter Mist fünf Kilogramm Stickstoff, fünf Kilogramm Phosphorsäure und sechs Kilogramm Kalium enthält. Man tat es, weil es funktionierte und weil man es immer so getan hatte.
Auch mein Vater war bestimmt stolz auf seinen Misthaufen, gab es doch im ganzen Dorf keinen, der sorgfältiger aufgeschichtet gewesen wäre; ganz besonders stolz sieht Vater auf dem Dorffest von Villars-sous-Yens an diesem ersten Juli-Wochenende 1983 aus (ich war damals fünf): Auf einem Foto, das meine Mutter in einem Album gefunden hat, ist mitten in der festlich gekleideten Menge die blau uniformierte Blaskapelle von Yens zu sehen, man erkennt auch meinen in Sonntagskluft und Gummistiefeln steckenden Vater, der zusammen mit seinem Angestellten auf ebendiesem Misthaufen eine Stabpuppe installiert, einen Greis in blauem Overall, mit einer Heugabel in der Hand: Das war Pipe, die Hauptfigur aus Les Petites fugues von Yves Yersin; der Film über den pensionierten Bauernknecht, der am Lenker seines Mofas noch einmal zum Leben erwacht, war in der Stadt wie auf dem Land ein Riesenerfolg gewesen.
Wäre der Misthaufen heute noch da, würde man allerdings anders vorgehen. Der Stall wäre mit einer automatisierten Entmistungsanlage inklusive Schwenkarm ausgerüstet. Vor allem aber würde man die Formulare der Bundesverwaltung ausfüllen, das Feld »Hofdünger« ankreuzen, eine Düngerbilanz erstellen, womit man die Kriterien des ökologischen Leistungsnachweises erfüllt und Anrecht hat auf die wertvollen Direktzahlungen, die den Bauern trotz sinkenden Milchpreises ihren Lebensunterhalt sichern.
2023 sagen sich die meisten Kunden im Lebensmittelladen: Umso besser, wenn der Misthaufen nicht mehr da ist, das macht weniger eingesperrte Tiere im Winter, weniger zwangsbesamte Kühe, weniger Kälber, die nach der Geburt gleich von der Mutterkuh getrennt werden, weniger Stiere, die man sechs Monate lang mästet und dann kaltblütig schlachtet, weniger überflüssiges Protein auf den Barbecues, weniger enthornte Kühe, Stockschläge, Maul- und Klauenseuche, weniger Rinderpest und BSE.
Am schlimmsten ist aber – Großvater, verzeih –, dass ich manchmal genauso denke wie die Kunden im Lebensmittelgeschäft. Ich habe es im Fernsehen gesehen: 40 % des treibhausgasintensiven Methans kommen von der Viehzucht. Ich habe es im Radio gehört: Gewisse wegen Misshandlung ihres Viehs sanktionierte Bauern erhalten weiterhin Bundessubventionen. Ich habe es in der Zeitung gelesen: In Brasilien wird Tierfutter produziert, um europäisches Vieh zu ernähren, dort wird abgeholzt, hier importiert, und die Ausscheidungen unserer Kühe gelangen nie auf die Felder zurück, von denen sie einst gekommen sind; der Düngungskreislauf ist unterbrochen, zu viel Nitrat und Stickstoff bei uns und zu wenig Dünger dort, also exportieren die europäischen Konzerne anorganischen Dünger nach Übersee, die Welt steht Kopf, und ich weiß nicht mehr, was ich denken soll.
Früher einmal – es ist gar nicht so lange her – wurde der Landwirt an seiner jährlichen Milchproduktion gemessen.
Nur wer Vieh im Stall hatte, durfte sich Bauer oder Bäuerin nennen.
Und die anhaltende Begeisterung für Alpabzüge, Älplerfeste und Ringkuhkämpfe spricht Bände. In der Schweiz ist die Anzahl Kühe pro Einwohner schon immer höher gewesen als anderswo auf der Welt. Die Kuh ist als geschnitzte Holzfigur oder in der Schokoladenwerbung nach wie vor angesagt. Die Kuh ist in unserer DNA, sie gehört zur Swissness.
»Der Schweizer melkt die Kuh und lebt ein friedliches Leben«, lautet ein Satz in Victor Hugos »Legende der Jahrhunderte«.
2018 stimmte die Schweizer Bevölkerung an der Urne darüber ab, ob die Haltung behornter Kühe gefördert werden solle. (Sie stimmte zu 55 % Nein.)
In Villars-sous-Yens wissen es wenige: Es gibt im Dorf heute keinen Milchproduzenten mehr. Wer ist schuld? Der Milchpreis sinkt seit dreißig Jahren unaufhörlich; er hat sich kürzlich stabilisiert, bleibt aber deutlich unter den Produktionskosten.
Als 2021 die letzten Milchkühe in einem Viehwagen abtransportiert wurden, hat dies niemanden sonderlich bewegt. Weder Fernsehen noch Radio oder Zeitungen haben darüber berichtet. Derlei Ereignisse sorgen nicht für Schlagzeilen. Es geht nicht um den neuen Standort einer 5G-Antenne, eine Schulhausverlegung oder die Schließung einer Poststelle. Doch das Dorf hat ein wenig seine Seele verloren.
Küffer besitzt schon lange kein Vieh mehr; Reymond mästet Kälber; Schmid, Guibert und Rezin halten Mutterkühe. Bevor die Milchsammelstelle der Molkerei geschlossen wurde, fuhr bei Martin, dem letzten Milchproduzenten, noch täglich ein Milchwagen vorbei. Seit 2021 beschränkt er sich auf Färsen und hält die Milchkühe fünfzehn Kilometer von seinem Hof entfernt, am Jurafuß, wo er für seine Milch immer noch einen angemessenen Preis bekommt und Gruyère-Käse mit Herkunftsgarantie produziert werden kann.
Die kleine Molkerei besteht zwar weiterhin, aber nur noch als gemeinschaftlicher Landmaschinenpark. Es gibt eine WhatsApp-Gruppe, um einen Güllewagen, eine Egge oder einen Viehanhänger zu reservieren; das Problem ist nur, dass Küffer immer noch kein Handy hat.
Zusammen mit der Auberge de la Croix Fédérale – das Wirtshaus hält sich knapp über Wasser –, der längst geschlossenen Poststelle und dem Schulhaus, wo Pilates, Yoga und Qigong angeboten werden, war die Molkerei einer der letzten Treffpunkte im Dorf: Die Milchbauern kamen dort gern auf einen Schwatz vorbei, besonders an Winterabenden. Mein Vater erinnert sich, wie die Informationen zirkulierten: »Martin brachte die Neuigkeiten aus dem Oberdorf. Heute grüßt man sich noch knapp mit der Hand durch die Windschutzscheibe. Vielleicht liegt ein Freund seit zwei Wochen im Krankenhaus, und niemand weiß es.«
Als ich klein war, gab es in unserer Straße noch drei weitere Bauernhöfe: Rezins und Küffers Höfe sind heute Mietshäuser, Guiberts Hof wurde abgerissen, jetzt stehen dort vier Reihenhäuser. Wir hielten bei uns noch fünfzehn Kühe, auf der anderen Straßenseite waren zwei Hühnerställe und ein Schweinestall, den heute zwei Garagen ersetzen. Es gab auch einen großen Kaninchenstall, und da wo acht Rinder untergebracht waren, sind heute die Waschküche, ein Lagerraum sowie das kleine Büro, in dem mir mein Vater gerade von seinem Leben als Bauer erzählt.
Als seine Eltern 1937 vom Kanton Bern in die Waadt ans Ufer des Genfersees zogen, führte ein Käser namens Sigenthaler die Molkerei; die Eltern verkauften ihm Schweine, die er mit seiner Molke fütterte. Es folgte ein gewisser Davet, der Butter und Joghurt anbot. Dann kam Monsieur Guignard aus dem Jura; mein Vater konnte bei ihm, in der Nähe von Mouthe, seine Rinder übersommern. Der Nächste war Diserens, der den kleinen Lebensmittelladen eröffnete und ihn später an Sachot weitergab, dem Allerletzten, der noch Milch entgegennahm.
Die Milch musste morgens zwischen 6 Uhr 30 und 7 Uhr, abends zwischen 18 Uhr 30 und 19 Uhr abgeliefert werden; die Zeiten richteten sich nach dem Milchwaggon, der am Bahnhof St-Prex abfuhr, um die Genfer Genossenschaftsmolkerei zu erreichen. Nur ein paar Minuten Verspätung, und schon bekam man, besonders beim griesgrämigen Sachot, eins auf den Deckel.
In den vierziger Jahren, als mein Vater ein Kind war, gab es noch keine elektrischen Zäune, die Kühe mussten auf der Weide gehütet werden. Es kam vor, dass die eine oder andere zu viel Klee oder Luzernen fraß und sich ihr Pansen aufblähte; ein solches Tier musste dann so schnell wie möglich in den Stall zurückgebracht, in gewissen Fällen sogar punktiert werden, um es zu erleichtern. Wenn mein Vater die Kühe zu früh von der Weide holte, wurde er gescholten, weil sie nicht genug gegrast hatten. Tat er es zu spät, riskierte er, dass sie litten. Und ließ er sie frei laufen, gab es andere Probleme.
Doch mein Vater mochte das Vieh, und man musste ihn nicht lange bitten, nach der Schule irgendwo auszuhelfen. Er war gern beim Kalben dabei. Auch später, als er die Kühe übernommen hatte, machte es ihm nichts aus, mitten in der Nacht aufzustehen: »Manchmal meinst du, jetzt ist es gleich so weit, die Kuh beginnt zu stampfen, dann geht es plötzlich nicht mehr weiter, stundenlang nicht weiter, und du musst um drei Uhr morgens den Tierarzt rufen. Manchmal kommt das Kalb in Steißlage, mit den Füßen zuerst. Oder es sind Zwillinge. Einmal mussten wir einem Kalb im Uterus die Beine absägen, um es herausziehen zu können und die Kuh zu retten, es lebte noch, als es draußen war, mein Mitarbeiter ist ohnmächtig geworden.«
Eine Geschichte reiht sich an die nächste. Ein ganzes Bauernleben. Von der Kindheit bis zur Pensionierung, vom Stall zum Obstgarten, von den Feldern zum Weinberg. Gewisse Dinge bittet er mich, nicht aufzuschreiben; möglichst nicht darauf herumreiten, wie lang im Sommer ein Arbeitstag war, um fünf Uhr früh läutete bereits der Wecker, sieben Tage die Woche, alle drei Wochen einen Sonntag frei, das wars. Er gibt zu, dass er sich mit fünfzehn auch gut einen anderen Beruf vorstellen konnte, Florist oder Landschaftsarchitekt. Sein Lehrer wollte sogar, dass er auf die Kunsthochschule geht.
Nach der Schule absolviert er ein einjähriges Praktikum bei einem Bauern, im Kanton Bern: »Es war wie eine Zeitreise, man benutzte den Traktor nur zum Pflügen, arbeitete noch mit Pferden. Manchmal galt es, dreißig hundert Kilo schwere Weizensäcke vom Karren abzuladen. Ich verdiente hundert Franken im Monat, dazu zwanzig Franken Weihnachtsgeld, weil der Chef mit mir zufrieden war.« Diese Erfahrung habe ihn gelehrt, sich später seinen Angestellten gegenüber fair zu verhalten.
Mit der Zeit hat es ihm immer besser gefallen; ein Leben ohne Weinberg, ohne Obstgarten konnte er sich fortan nicht mehr vorstellen. Er hat sich nie einen anderen Beruf gewünscht, hat es nie bereut, Bauer geworden zu sein.
Wenn ich ihm zuhöre, kommt meine Kindheit zurück. Ich sehe die beiden an der großen Stalltür hängenden Melkschemel. Da sind der süßliche Milchgeruch und der Stallmief. Ich höre das kleine UKW-Radio krächzen, das während des Melkens stets eingeschaltet war. Da sind die an eine Schnur angebundenen Kuhschwänze, Schiefertafeln mit den Namen der Kühe, Fliegen, der Geruch des Melkfetts und des Desinfektionsmittels für die Zitzen, die brummende Melkmaschine, Berge von frischem Gras vor den Futterraufen und unsere wilden Spiele im Heu.
Mitten im Winter: Der Scheinwerfer erhellt den Straßenrand, der Zweitaktmotor eines Puch Maxi knattert, auf den Planken des Anhängers scheppern die Milchkannen. Vom Perron der Molkerei her ist das laute Lachen der Viehhalter zu hören. Dann mein Vater, der mit einer Fünfzig-Liter-Kanne auf dem Rücken die Straße überquert, mit ganz kleinen Schritten, um ja nichts zu verschütten.
Ein Schauspiel, das im Dorf zweimal am Tag gratis geboten wurde.
Heute laufe ich durch einen toten, fast geruchlosen Stall, es gibt nur ein paar Spinnen mit ihren Netzen und Schwalben, unter jedem Nest ein Kothaufen. Der Stapler für die Heu- und Strohballen ist noch da, etwas weiter eine Kurbel, mit der die Wagenböden an vier Stahlkabeln hochgezogen wurden.
In einer Scheune lagern die Bühnenbilder des Dorftheaters. In die andere ließ mein Cousin Patrick, als er Gemeindepräsident war und die Schule geschlossen wurde, die Stühle und Bänke räumen.
Ich habe mich mit Patrick in seinem Weinkeller verabredet, wo wir an seinem in der Landwirtschaftsschule in Morges selbst geschreinerten Tisch sitzen. Ein ziemliches Durcheinander auf engstem Raum: Doktor Maurys Gesund mit Wein, in den siebziger Jahren ein Bestseller, ein Zeitungsartikel jüngeren Datums aus dem Lokalblatt La Côte über die Schützenkunst seines Vaters Hans mit dem Titel »Und er trifft auch nach fünfzig Jahren noch«, das Nummernschild ihres alten Mähdreschers, der für siebenhundert Franken an einen Händler verkauft und in Einzelteilen nach Osteuropa exportiert wurde. Er entkorkt einen einheimischen Chasselas und kredenzt ihn mir in einem kleinen Glas der lokalen Blaskapelle.
Auf die Kühe und damit auf den Misthaufen zu verzichten, ist seine Entscheidung gewesen. Doch als ich ihn nach den schönen Momenten seines Bauernlebens frage, erwähnt Patrick ausschließlich Erinnerungen, die mit der Viehhaltung zusammenhängen: den Elektrozaun versetzen und sich dann mit den im hohen Gras fressenden Kühen freuen, die Kälber zum ersten Mal am Halfter auf die Weide führen, als Siebenjähriger den Mistkran steuern. Aufregend fand er es, die Herde mit dem Fahrrad auf die Weide zu bringen; er hatte am Rahmen einen Rutenhalter befestigt, den er aber nie benutzte, da er, wie er sagte, lieber mit »gleichen Waffen«, sprich mit den beiden »Hörnern« seines Lenkers kämpfen wollte.
Als Sohn und Enkel von Landwirten war seine berufliche Zukunft festgeschrieben. Nach einer zweijährigen Lehre kommt er mit siebzehn in den elterlichen Betrieb. Dann teilen mein Vater und mein Onkel den Hof in zwei getrennte Betriebe auf; mein Vater übernimmt die Obstbäume und den Weinberg, die Felder und das Vieh gehen an meinen Onkel und meinen Cousin. Bald richten sie eine Entmistungsanlage und eine neue Jauchegrube ein, eine über dreißig Jahre abzahlbare Investition.
Als 2002 sein Vater 65 Jahre alt wird und als Rentner keine Bundessubventionen mehr erhält, übernimmt Patrick den Betrieb. Die Zusammenarbeit sei harmonisch gewesen, ohne Generationenkonflikte. Das Problem liege woanders: Der Milchpreis sei im freien Fall. »Die Zahlen sind knallhart«, entfährt es ihm bitter. 2004 trägt er Betriebskosten, Nebenkosten und den Milchpreis in eine Excel-Tabelle ein: Obwohl weitere Arbeitskräfte (sein Vater) finanziell kaum ins Gewicht fallen, stellt er fest, dass sein Stundenlohn zwischen vier und sechs Franken liegt. Und der Milchpreis sinkt und sinkt.
Die Entscheidung fällt ihm ebenso schwer, wie sie – nach einem Jahr – schnell getroffen ist:
»Einmal den Kugelschreiber in die Hand nehmen, unterschreiben, und es ist erledigt, ein Zurück gibt es nicht: Alles, was ich übernommen hatte, die gesamte Hinterlassenschaft meines Großvaters.« Teils kommen die Kühe zum Schlachthof, teils werden sie an befreundete Viehhalter verkauft. Ein Bauer aus dem Dorf übernimmt das Heu, als Gegenleistung düngt er ihm die Felder. Schließlich verkauft Patrick sein Milchkontingent – eine vom Staat festgelegte Obergrenze, um Überproduktion zu vermeiden – an drei Kollegen weiter, zwei Drittel des Verkaufswerts sind ihm genug, er will sie nicht übervorteilen.
Mein Onkel stellt die Melkutensilien zum alten Werkzeug des Großvaters, in ein Kabäuschen, aus dem er gern einmal ein kleines Agrarmuseum machen würde.
Ohne Kühe wird im Stall Platz frei. Patrick versucht sich in der Kaninchenzucht, er schlachtet sie selbst, baut sein Netzwerk aus, setzt auf den Direktverkauf. Die Nachfrage ist wohl da, doch es gibt zu viele Krankheiten, und er gibt auf. Heute hält er keine Tiere mehr, bis auf zwei Zwergziegen, seinen Töchtern zuliebe. Ironie des Schicksals, das junge im Bauernhaus eingemietete Paar ohne landwirtschaftliche Wurzeln schafft sich eine seltene Hühnerart an, Haustiere, die man streicheln oder auf der Schulter tragen kann; und mitten in ihrem Stall, dort wo das Getreidesilo stand, hängt heute eine kleine Schaukel, auf der die Tiere balancieren können.
Mein Cousin widmet sich fortan seinen 32 Hektaren Ackerland und setzt, wie viele Bauern, auf Diversifizierung. Da er sich nicht zum Agro-Tourismus berufen fühlt – Gästezimmer und Brunch auf dem Bauernhof –, arbeitet er für seine Kollegen als Fahrer während der Erntezeit, übernimmt in der Gemeinde die Wartung der Kläranlage oder mäht Straßenböschungen. Seine Frau Vanessa arbeitet weiterhin außerhalb des Betriebs. Ihr einfacher Lohn als Primarschullehrerin hat dem Paar schon immer mehr eingebracht als die Milch.
Heute ist Patrick vierundfünfzig. Seine älteste Tochter hat klar gesagt, dass aus ihr keine Bäuerin wird. Die jüngere träumt davon, Esel zu züchten, ist aber erst elf. Also kommt er ins Grübeln. Er weiß nicht, wie sich die Landwirtschaft entwickelt. Es ist schwer, in die Zukunft zu blicken. Er sagt, er lässt es auf sich zukommen. Er wird schon sehen.
Während Patrick die Viehzucht 2005 aufgab, entschieden sich Alexandre und David, die beiden Cousins mütterlicherseits, für das Gegenteil: investieren, ausbauen und so viel Milch produzieren, dass zwei Familien davon leben können.
Ich fahre also nach Peney-le-Jorat, nördlich von Lausanne, und finde mich auf dem Bauernhof wieder, wo wir jedes dritte Jahr Weihnachten gefeiert haben; zu den Erinnerungen an jene Tage gehört auch die an die Brüder Gavillet, die sich, obwohl kaum älter als ich, jeweils Punkt vier Uhr nachmittags abmeldeten, um zu melken. Der Garten ist unverändert geblieben (bis auf die Gemüsebeete, da wächst heute Rasen), die kleine Gartenlaube, der alte Brunnen, ein typischer Bauernhof aus dem Jorat. Allerdings ist unterhalb des Hofs ein riesiger Stall zu sehen, den gab es früher nicht; die Hälfte der Dachfläche ist mit Solarpanels bedeckt.
Alexandre empfängt mich in seiner Küche und entkorkt sofort eine kleine Flasche exzellenten Chasselas aus Valeyres-sous-Rances. Er zeigt sein zurückhaltendes, aber warmes Lächeln, das man von ihm so gut kennt, trägt ein T-Shirt mit der Aufschrift »Georges Baumgartner, Radio Suisse Romande, Tokyo«. Am Telefon hat er dreimal wiederholt, er wäre kein repräsentativer Bauer, und vor allem habe er keine Lust, im Rampenlicht zu stehen. Seit ich an diesem Buch arbeite, ist mir längst klargeworden, dass es den typischen Bauern sowieso nicht gibt. Introvertiertheit oder Diskretion scheinen mir aber weitverbreitete Charakterzüge unter Bauern zu sein.
Die Wörter Humus und Humilität, was Demut heißt, haben denselben Stamm.
Alexandre wollte nie einen anderen Beruf ausüben, seine Eltern haben ihn auch nie unter Druck gesetzt. Nach der Matura und zwei Sommern auf Bauernhöfen in England und Deutschland absolviert er ein Masterstudium in Agrarwissenschaften an der ETH in Zürich, merkt dann aber nach einer kurzen Anstellung beim landwirtschaftlichen Beratungszentrum der Westschweiz, dass er »nicht wirklich der Bürotyp« ist, und kehrt auf den elterlichen Hof zurück.
2004 übernimmt er mit seinem Bruder David sogar den Hof. Sie wollen den Betrieb erweitern. Eine Umweltverträglichkeitsprüfung wird erstellt, sie besuchen andere Bauernhöfe, erarbeiten eine optimale Raumnutzung. Glücklicherweise haben die Eltern ihnen den Betrieb schuldenfrei überlassen, sie bekommen ein zinsloses Darlehen sowie nicht rückzahlbare Zuschüsse, müssen sich aber trotzdem schwer verschulden: »So was muss man tun, wenn man jung ist, da stellt man sich nicht allzu viele Fragen.«
Für die Stallhaltung lassen sie einen modernen Viehstall mit Melkstation bauen. Zur Aufstockung des 200000 Liter-Milchkontingents des Vaters kaufen sie das Kontingent eines Freunds dazu, womit sie ihre Produktion verdoppeln, und finden über den Anzeigenteil der lokalen Landwirtschaftszeitung weitere 100000 Liter. Nun haben sie also schon 80 Milchkühe. 2021 erreicht ihre Produktion fast 750000 Liter, und zwar Gruyère-