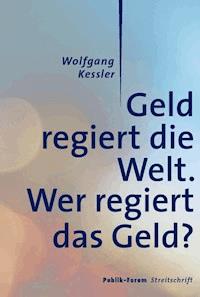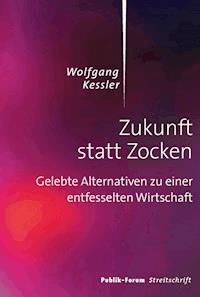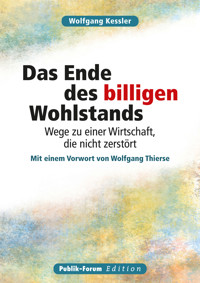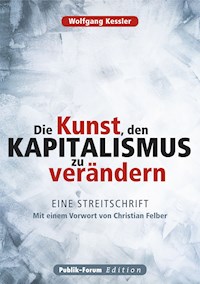
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Publik-Forum Edition
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
"Ein Buch für alle, die in diesem Land etwas verändern wollen." Stephan Hebel, Journalist "Der erfahrene Journalist Wolfgang Kessler präsentiert ein beeindruckendes Feuerwerk von Alternativen, das nur eine Schlussfolgerung zulässt: Alles ist tatsächlich zum Besseren veränderbar." Christian Felber, Publizist Megakonzerne und Großinvestoren erobern Innenstädte, Krankenhäuser, Pflegeheime, Ackerland und unsere Daten. Der rasende globale Kapitalismus bedroht Mensch, Demokratie, Natur und Klima. Wirtschaft und Konsum müssen grundlegend anders werden. Die Kunst wird sein, am offenen Herzen des kapitalistischen Systems so zu operieren, dass die Folgen für Mensch und Natur auf der ganzen Welt immer mitgedacht werden. Von dieser Kunst erzählt dieses Buch.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 124
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch
»Ein Buch für alle, die in diesem Land etwas verändern wollen.« Stephan Hebel, Journalist
»Der erfahrene Journalist Wolfgang Kessler präsentiert ein beeindruckendes Feuerwerk von Alternativen, das nur eine Schlussfolgerung zulässt: Alles ist tatsächlich zum Besseren veränderbar.« Christian Felber, Publizist
Megakonzerne und Großinvestoren erobern Innenstädte, Krankenhäuser, Pflegeheime, Ackerland und unsere Daten. Der rasende globale Kapitalismus bedroht Mensch, Demokratie, Natur und Klima. Wirtschaft und Konsum müssen grundlegend anders werden. Die Kunst wird sein, am offenen Herzen des kapitalistischen Systems so zu operieren, dass die Folgen für Mensch und Natur auf der ganzen Welt immer mitgedacht werden. Von dieser Kunst erzählt dieses Buch.
Über den Autor
Wolfgang Kessler, geb. 1953, wuchs in Oberschwaben auf und wurde dort durch die katholische Jugendarbeit geprägt. Das Studium der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften in Konstanz, Bristol/England und an der London School of Economics schloss er 1982 mit der Promotion ab. Er arbeitete wissenschaftlich über den Internationalen Währungsfonds, auch in der Zentrale in Washington D.C., wandte sich aber aufgrund der umstrittenen Politik des IWF dem Journalismus zu. Dies zunächst im eigenen Pressebüro, ab 1991 bei Publik-Forum. Von 1999 bis 2019 war Wolfgang Kessler Chefredakteur der Zeitschrift. Er ist Autor zahlreicher Bücher zu sozialethischen Themen. Wolfgang Kessler wurde 2007 mit dem Internationalen Bremer Friedenspreis für »sein öffentliches Wirken für Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung« ausgezeichnet.
Dieses Buch widme ich Barbara, Christian, Tina und Fay
Danksagung
Dieses Buch ist auch das Ergebnis zahlreicher intensiver Diskussionen mit völlig unterschiedlichen, aber engagierten Menschen. Als erstes gebührt mein Dank allen Kolleginnen und Kollegen von Publik-Forum, die in unterschiedlichen Rollen bei dieser Zeitschrift oder für diese Zeitschrift arbeiten.
Danken möchte ich auch für intensive Dialoge bei unterschiedlichen Gelegenheiten mit Dascho Karma Ura (Bhutan), Otmar Edenhofer, Christian Felber, Sven Giegold, Silja Graupe, Friedhelm Hengsbach, Bischof Erwin Kräutler (Österreich/Brasilien), Stephan Lessenich, Boniface Mabanza (Kongo/Deutschland), Bundeskanzlerin Angela Merkel, Kumi Naidoo (Südafrika), Nico Paech, Hartmut Rosa, Antje Schrupp, Jutta Sundermann, Dieter Zetzsche sowie den Mitstreitern der Akademie Solidarische Ökonomie.
Wolfgang Kessler
Christian Felber über Wolfgang Kesslers Buch
Ein Feuerwerk an Alternativen
Die Entwicklung eines zukunftsfähigen Wirtschaftssystems, das die Umwelt schützt, die Erträge gerecht verteilt und auf transparenten demokratischen Regeln beruht, ist – so einleuchtend das Ziel wirken mag – scheinbar unmöglich zu verwirklichen: Mächtige Interessenballungen paralysieren die Politik, mächtige Glaubenssätze die Wirtschaftswissenschaft, mächtige Gewohnheiten das Verhalten der Menschen. Echte Freiheit und Verantwortung scheinen für viele gar kein wirklich erstrebenswertes Ziel zu sein.
Wolfgang Kessler ist sich dieser vielen Widersprüche und Hindernisse auf dem Weg zu einer von so vielen Menschen ersehnten Vision einer demokratischen, gerechten und nachhaltigen Wirtschaftsweise bewusst und möchte keine unseriösen Illusionen nähren. Sein scharfer Blick erschließt aber nicht nur verborgene Finessen und noch lauernde Fallen des Kapitalismus, sondern auch eine so große Fülle von schon existierenden alternativen Ansätzen und Praktiken, dass man am Ende dieser Streitschrift zu gar keiner anderen Schlussfolgerung kommen kann, als dass tatsächlich alles zum Besseren veränderbar ist.
Der erfahrene Journalist veranschaulicht dies mit einem beeindruckenden Feuerwerk an Alternativen: von der Finanztransaktionssteuer bis zum Deutschlandsfonds, vom sozialen Wohnungsbau bis zum WeBook, vom Ökobonus bis zur Kohlendioxyd-Steuer, vom Kontowechsel zu einer ethischen Bank bis zum Elektro-Car-Sharing; und von der Vision eines ethischen Welthandels bis zu einem finanzierbaren, sozial gerecht angelegten Grundeinkommen für alle.
Der nüchterne Realismus, mit dem diese Optionen vorgetragen werden, hinterlässt vielleicht die erschreckende Gewissheit, dass dieses reichhaltige Menü an möglichen Alternativen nur dann Realität werden wird, wenn jede Leserin und jeder Leser sich persönlich entscheidet, ihr oder sein Herz dafür zu öffnen, ihren oder seinen Geist darauf auszurichten und mit ihren Handlungen zu ihrer Verwirklichung beizutragen. Gandhis zeitloser Spruch »Sei du selbst der Wandel, den Du in der Welt sehen möchtest« bedeutet für die Leser eine mächtige Einladung – zu Freiheit und Verantwortung.
Christian Felber ist Buchautor, Dozent und Initiator der Gemeinwohl-Ökonomie, die inzwischen mehr als 2000 Unternehmen praktizieren.
Vorwort
Das Kapitalismus-Tabu oder: Was mich bewegt
Über Wirtschaft wird ständig geredet, doch eine breite, kritische, vorbehaltlose Diskussion über unser Wirtschaftssystem findet nicht statt. In weiten Kreisen der Gesellschaft herrscht ein Kapitalismus-Tabu. Dieses Tabu ist gefährlich.
Denn der globale Kapitalismus ist weit von jener sozialen Marktwirtschaft entfernt, die in Deutschland verehrt wird. Mit ihr wurde versucht, die wirtschaftliche Dynamik einer Marktwirtschaft mit sozialer Gerechtigkeit zu verbinden. Teilweise erfolgreich.
Klar: Auch der globale Kapitalismus hat Wohlstand gebracht. Rund zwei Milliarden Menschen leben heute viel besser als noch vor zehn Jahren. Gleichzeitig bedrohen die Triebkräfte dieses Systems inzwischen jedoch weltweit demokratische Errungenschaften, Menschenrechte und die Ressourcen der Erde. Finanzfonds und Mega-Konzerne unterwerfen die ganze Menschheit dem Diktat der Rendite. Ihre Macht geht längst über die bloße Produktion von Waren und Dienstleistungen hinaus. Diese Mega-Investoren greifen nach Wohnungen und Büros von Innenstädten, Regenwäldern und Ackerflächen ebenso wie nach deutschen Krankenhäusern und Pflegeheimen. Ihre Macht dringt in alle Poren der Gesellschaft ein. Ihre Technologien erlauben die lückenlose Überwachung aller. Sie treiben ein rasendes Wachstumskarussell an, das keine Rücksicht auf Mensch, Tier und Natur nimmt. Das Klima wird immer weiter aufgeheizt. Auch demokratisch gewählte Regierungen wirken häufig nur noch als Vollzugsorgane des globalen Kapitalismus. »Diese Wirtschaft tötet«, schrieb Papst Franziskus. Sieht man von kleinen kritischen Minderheiten der Weltbevölkerung ab, scheint dies niemanden groß zu interessieren.
Für mich bestehen keine Zweifel: Dieser Kapitalismus muss grundlegend verändert werden. Aber: Dies ist leichter gesagt als getan. Auch Kritiker müssen zugeben, dass es einfach umsetzbare Alternativen nicht gibt. Wer den Kapitalismus verändern will, operiert am offenen Herzen eines Systems, in das Millionen, ja sogar Milliarden Menschen als Unternehmer, Beschäftigte, Sparer, Eigentümer, Mieter, Erwerbslose oder Verbraucher eingebunden sind. Wer – auch mit noch so gutem Willen – an den falschen Stellschrauben dreht, kann eine tiefe Krise auslösen. Mit Folgen, die eher den Faschismus fördern als Demokratie, Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit.
Die Veränderung dieses Wirtschaftssystems erfordert deshalb zweierlei: den Mut, ohne Tabus, ohne Rücksicht auf mächtige Interessen über die Entwicklung der Wirtschaft zu diskutieren. Und sie erfordert die Kunst, am offenen Herzen des Systems so zu operieren, dass die Folgen für Mensch und Natur auf der ganzen Welt immer mitgedacht werden.
Von dieser Kunst erzählt dieses Buch.
Wolfgang Kessler, 10. April 2019
ABGRÜNDE
Der Kampf aller gegen alle
Glanz und Elend des globalen Kapitalismus
Die Welt ist aus den Fugen. Dieser Anklang an William Shakespeares Hamlet ist derzeit sehr populär. Und das ist durchaus verständlich. Denn wer wollte bestreiten, dass die Welt derzeit von extremen Widersprüchen beherrscht wird. Auch in Deutschland sind sie spürbar. Die meisten Bundesbürger leben im Wohlstand. Und doch ist ihre Verunsicherung, ihre Zukunftsangst mit Händen zu greifen. Selbst jene, die auf der Sonnenseite des Lebens stehen, haben das Gefühl, dass vieles Erreichte gefährdet ist, dass nichts so bleiben wird, wie es ist. Viele haben Angst davor, dass es ihnen und ihren Kindern oder Enkeln schlechter gehen könnte.
Typisch »German Angst«, werden manche Beobachter sagen. Angst als Charakterzug eines Volkes. Der Hinweis ist nicht ganz falsch. Er ignoriert allerdings, dass dieses Gefühl der Angst seit Jahren durch Entwicklungen bestärkt wird, die sich viele Bundesbürger vor wenigen Jahren nicht vorstellen konnten: Rund um Europa, ja sogar auch in Europa, herrschen Krieg und Terror; ganze Staaten im Nahen und Mittleren Osten oder in Afrika versinken in Gewalt; mehr als 60 Millionen Menschen sind weltweit aus ihrer Heimat geflohen, Zehntausende riskieren eher den jämmerlichen Tod im Mittelmeer, als in ihrer Heimat zu bleiben; in kriegerischen Konflikten wird Gefangenen der Kopf abgehackt und die Bilder gehen durch das Internet; gleichzeitig sterben Tier- und Pflanzenarten aus, fordern Waldbrände, Wirbelstürme, Dürren und Überschwemmungen als Vorboten der Klimaerwärmung immer mehr Opfer. Als wäre das nicht schon genug, bedrohen rechte Populisten die Demokratie, die man für selbstverständlich hielt. Engagierte Bürger und Politiker werden mit Hassparolen überzogen und auf offener Straße belästigt, Flüchtlinge müssen in Unterkünften um Leib und Leben fürchten. Die Zivilisation, die Menschen, die Natur – sie sind bedroht. Zukunftsangst ist nur allzu verständlich.
Doch die Erzählung von der Welt aus den Fugen wäre nicht vollständig, gäbe es da nicht auch die andere Seite der Entwicklung, eine großartige, die oft vergessen wird: Die weltwirtschaftliche Dynamik des vergangenen Vierteljahrhunderts hat zwei Milliarden Menschen ein besseres Leben beschert; das gewiss umstrittene chinesische Regime hat rund 600 bis 700 Millionen Menschen aus der Armut befreit. Nach Angaben der Weltbank ist die Zahl derer, die in extremer Armut leben, auf zehn Prozent der Weltbevölkerung gesunken, also auf knapp 800 Millionen Menschen. Viele Sozialindikatoren weisen nach oben. Mehr Menschen als je zuvor können lesen und schreiben, die Müttersterblichkeit ist ebenso stark gesunken wie die Kindersterblichkeit. Und die Zahl der Kriege zwischen Staaten ist geringer denn je.
Die Welt aus den Fugen ist eine Welt voller Reichtum und Glanz, in der sich trotz allem die Zeichen von Selbstzerstörung mehren. Es mag viele Gründe für diese Widersprüche geben, doch einer ist besonders prägend: Wer diese Welt aus den Fugen verstehen will, muss sich die Weltwirtschaft der vergangenen dreißig Jahren und ihre Triebkräfte vor Augen führen.
Die globale Entfesselung der Marktkräfte
Es gibt ein Zauberwort, um das die wirtschaftliche und soziale Entwicklung kreist: Globalisierung. Laut Wikipedia taucht der Begriff im Laufe der 1960er-Jahre zum ersten Mal auf. Damals begannen die großen Unternehmen, Teile ihrer Produktion in sogenannte Niedrigkostenländer zu verlagern. So entstand in den 1970er- und 1980er-Jahren eine neue internationale Arbeitsteilung: Die Niedrigkostenländer erhalten moderne Technologien und industrielle Arbeitsplätze, die Wohlstandsländer billigere Waren, die transnationalen Konzerne steigern ihre Macht und ihre Gewinne, weil sie zu niedrigen Kosten produzieren und dabei die einzelnen Länder gegeneinander ausspielen können. Wer damals die Entwicklung kommentierte, sprach oft von einer ungeheuren Dynamik. Dabei waren große, realsozialistisch organisierte Teile der Welt wie Osteuropa oder China von dieser Entwicklung ausgeschlossen. Erst nach einer politischen Revolution wurde deutlich, was kapitalistische Dynamik wirklich bedeutet: 1989.
Da überwanden mutige Demokraten unter der Schirmherrschaft des damaligen Generalsekretärs des Zentralkomitees der KPdSU, Michail Gorbatschow, den real existierenden Sozialismus in der Sowjetunion. Für Millionen Menschen bedeutete diese friedliche Revolution politische und bürgerliche Rechte. Ein Highlight der Geschichte.
Doch dieser politischen Revolution folgte eine globale wirtschaftliche Revolution. Westliche Regierungen, allen voran die USA und Großbritannien, nutzten die Überwindung des real existierenden Sozialismus, um den ungebändigten Kapitalismus über die ganze Welt zu verbreiten. Gemäß der Doktrin des Neoliberalismus, die bereits seit Margaret Thatchers Regierungsübernahme im Jahre 1979 ihre Wirkung in Großbritannien entfaltete, versuchte die Politik, den Staat aus der Wirtschaft zurückzudrängen. Staatliche Regelungen wurden abgeschafft, öffentliche Betriebe und Dienstleistungen privatisiert sowie Steuern, aber auch Sozialleistungen, gesenkt.
Und das Wichtigste: Sehr viele Begrenzungen für das Kapital wurden abgebaut. Das veränderte das Finanzsystem und die Weltwirtschaft. Während in den 1980er-Jahren Kapitalüberweisungen von einem Land in das andere kontrolliert wurden, konnten nun alle, die Geld hatten, ihr Kapital in wenigen Minuten in jede Ecke der Welt überweisen. Und sie taten und tun es. Die einen, um möglichst geringe Steuern zu bezahlen, die anderen, um jeden Unterschied an möglicher Rendite zwischen den verschiedenen Weltregionen für sich auszunutzen. Diese Liberalisierung der Finanzmärkte entfesselte den globalen Kapitalismus, im wahrsten Sinne des Wortes: Noch im März 2009, ein halbes Jahr nach dem Zusammenbruch von Lehman Brothers, verkaufte die Zürcher Börse rund 3000 Wertpapiere pro Sekunde. Inzwischen rechnen die Börsen nicht mehr in Sekunden. Sie versuchen, in jeder Millisekunde 80 000 Geschäfte abzuwickeln. Das läuft ohne direkten menschlichen Zugriff, nur über Computer-Software.
Diese Entfesselung der Finanzmärkte ließ die Triebkräfte des Kapitalismus explodieren. Die Welt wurde in wenigen Jahren zu einem großen Marktplatz, mit harter Konkurrenz zwischen großen Konzernen. Flexibel wie selten zuvor können die Unternehmen ständig neu darüber entscheiden, wo sie welche Teile ihrer Produkte herstellen und wo sie sie anbieten. Die Konkurrenz treibt die Unternehmen von Erfindung zu Erfindung, von Angebot zu Angebot. Erleichtert und beschleunigt wurden diese Entscheidungen durch digitale Technologien. Es war und ist kein Kunststück, Software preisgünstig in Indien entwickeln zu lassen und dann weltweit zur Anwendung zu bringen.
Mit diesen Möglichkeiten vor Augen setzte sich die Politik der westlichen Industrienationen, aber auch jene in China, Russland und in zahlreichen Schwellenländern, neue Ziele. Fortan ging es ihnen darum, die Chancen ihrer Exporteure auf dem Marktplatz namens Welt zu erhöhen, um den heimischen Lebensstandard zu steigern. Ob es sich um Rohwaren, landwirtschaftliche Exporte, Billigprodukte oder Industriegüter handelt – je mehr Exporte, desto besser. Und es wurden erheblich mehr. Seit 1995 hat sich der Welthandel mehr als versechsfacht.
Der Glanz der Globalisierung
Dieses weltweite Wirtschaftswachstum ließ den weltweiten Reichtum explodieren – nicht nur den der Superreichen. Sogar die Wachstumskritiker des Club of Rome honorierten in ihrem Bericht »Wir sind dran« aus dem Jahre 2018, dass diese Entwicklung für ein »erstaunliches Einkommenswachstum« in Schwellenländern wie China, Indien, Brasilien, Indonesien sorgte und fast zwei Milliarden Menschen aus der Armut befreite. Selbst unter den Persönlichkeiten der Welt mit den höchsten Vermögen finden sich immer mehr aus der sogenannten Dritten Welt. In einem Armenhaus wie Indien konsumieren mehr Menschen auf europäischem Niveau, als Deutschland Einwohner zählt. China und Indien zusammen zählen mehr kaufkräftige Konsumenten als die Europäische Union.
In vielen Regionen der Welt führte die wirtschaftliche Globalisierung auch zu mehr Rechten und zu höheren politischen Ansprüchen der Menschen. Nicht wenige Kapitalismuskritiker bezweifeln, dass politische Freiheitsbewegungen viel mit diesem Wirtschaftssystem zu tun haben. Doch auch hier hat die Entwicklung zwei Seiten: Zum einen geht Kapitalismus gut zusammen mit autoritären Regimen, die den Konzernen genügend Freiraum lassen, aber Gewerkschaften und soziale Bewegungen verbieten oder blockieren, damit die Unternehmen nicht durch höhere Löhne und Sozialleistungen zur Abwanderung gedrängt werden. In vielen Staaten sorgte eine unheilige Allianz von Diktatoren und Konzernherren dafür, dass hohes Wirtschaftswachstum mit der Ausbeutung von Beschäftigten einherging und einhergeht.
Allerdings gerät diese unheilige Allianz durch die rasante Entwicklung des Kapitalismus mit der Zeit unter Druck, denn die Konkurrenzfähigkeit von Unternehmen erfordert ab einem bestimmten Entwicklungsstandard ein wachsendes Maß an Ausbildung, an individueller Bewegungs- und Konsumfreiheit der Bürger. Auf lange Sicht fördert dies auch politische und soziale Bewegungen, weil sich individuelle Freiheiten nicht auf den Konsum oder auf die Arbeitsmobilität reduzieren lassen. Zu allem kam und kommt die Entwicklung moderner Kommunikationstechnologien, die soziale Bewegungen – gerade unter diktatorischen Bedingungen – für sich nutzen können. So verwundert es nicht, dass in den vergangenen dreißig Jahren überall auf der Welt demokratische Bewegungen wuchsen, die ihre Regierungen herausforderten. Fast ganz Lateinamerika ist inzwischen zumindest formal demokratisch, nachdem sich Amnesty International in den 1970er- und 1980er-Jahren vor allem mit lateinamerikanischen Militärdiktaturen herumschlagen musste.
Auch der arabische Frühling wäre ohne Globalisierung nicht denkbar gewesen. Es gibt breite Demokratiebewegungen in Malaysia, in Hongkong, in Pakistan, auch in einigen Staaten Afrikas. Klar ist: Die Unterdrückung der Menschenrechte hat kaum nachgelassen. Dennoch bildeten sich mächtige Bewegungen für Demokratie und Freiheitsrechte. Man denke nur an die Frauenbewegung, die Länder wie Indien oder ganz Lateinamerika verändert oder bereits verändert hat. Oder man denke an die Bewegung von Indigenen, die Freiheit und kulturelle Eigenständigkeit einfordern.