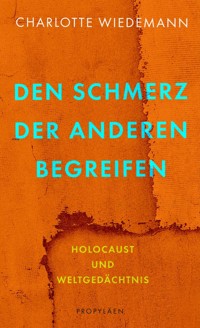11,99 €
Mehr erfahren.
Wann der Tod in dein Leben kommt, kannst du kaum beeinflussen. Wie du mit ihm umgehen willst, dagegen schon.
Sterben gehört zum Leben – doch kaum ein Thema wird so sehr verdrängt. Charlotte Wiedemann, ausgebildete Death Doula (Sterbegefährtin), begleitet Menschen bei den großen Übergängen des Lebens und zeigt, wie wir einen offeneren Zugang zum Tod finden können.
Aus persönlichen Erfahrungen und bewegenden Fallgeschichten ist ein einfühlsames Buch entstanden, das berührt und Orientierung gibt. Ergänzt wird es durch konkretes Wissen, Rituale und Übungen, die helfen, eigenen Wünsche zu klären, Vorsorge zu treffen und Abschiede bewusst zu gestalten.
• Persönlich, poetisch und praxisnah: eine neue Perspektive auf Sterben, Tod und Trauer.
• Mit Übungen, Ritualen und Fragen, die helfen, eigene Wünsche und Werte zu klären.
• Inspirierende Geschichten aus der Arbeit einer ausgebildeten Death Doula.
• Ein Buch, das Mut macht, den Tod ins Leben zu holen - für mehr Tiefe und Erfüllung im Alltag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 344
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Buch
Viele Menschen streben nach Achtsamkeit und Erfüllung. Sie praktizieren Yoga, Meditation und Spiritualität, um dorthin zu gelangen. Für Charlotte Wiedemann vereint der Tod dieses Bedürfnis: Denn mit der eigenen Endlichkeit vor Augen fällt es plötzlich leichter, sich auf das zu besinnen, was einem guttut und Erfüllung schenkt.
Die Autorin hat sich als Death Doula, Sterbeamme, ausbilden lassen und begleitet Menschen bei den großen Übergängen des Lebens. Anhand berührender Fallgeschichten vermittelt Charlotte Wiedemann Wissen und Handlungskompetenz rund um die Themen Tod, Sterben und Trauer. Durch Rituale, gemeinsames Gestalten und den Mut, umzudenken, wird der Tod (be-)greifbarer und der Abschied menschlich und nah. Einfühlsam beschreibt die Autorin, wie wir die letzte Reise für uns und unsere Liebsten möglichst unbefangen und selbstbestimmt gestalten können.
Aus dem Alltag einer Death Doula: authentisch, einfühlsam und ermutigend – für einen neuen, bewussten Umgang mit dem Lebensende.
Autorin
Die Kulturjournalistin Charlotte Wiedemann entdeckte dank einer prägenden Geburtserfahrung gute Begleitung in Lebensübergängen für sich. Als ausgebildete Death Doula hat sie sechs Jahre lang die Welt der Sterbebegleitung, Bestattung und Trauerbegleitung erforscht und praktisch vertieft. Sie verantwortet u. a. erfolgreiche Kommunikationsprojekte wie den Sterbereport mit brand eins sowie den erfolgreichen Social-Media-Kanal @dertod_undwir, der mittlerweile ca. 400 000 Follower zählt.
Charlotte Wiedemann
Die Kunst des Abschiednehmens
Wie wir einen neuen Umgang mit dem Sterben finden und uns rechtzeitig vorbereiten können
Alle Ratschläge in diesem Buch wurden von der Autorin und vom Verlag sorgfältig erwogen und geprüft. Eine Garantie kann dennoch nicht übernommen werden. Eine Haftung der Autorin beziehungsweise des Verlags und seiner Beauftragten für Personen-, Sach- und Vermögensschäden ist daher ausgeschlossen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Copyright © 2025: Kailash Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
(Vorstehende Angaben sind zugleich Pflichtinformationen nach GPSR.)
Projektleitung: Stefanie Gördes
Redaktion: Caroline Kaum
Umschlaggestaltung: Ki 36, Sabine Krohberger
Umschlagmotiv: © istockphoto/MelanieMaya
© istockphoto/BitsAndSplits
Satz und E-Book Produktion: Satzwerk Huber, Germering
ISBN 978-3-641-33551-9V001
www.kailash-verlag.de
Inhalt
Prolog: Meine Tochter kommt zur Welt und ich gehe fast
Kapitel I: Über die Geburt dieses Buches und wie du es lesen kannst
Kapitel II: Vom Anfang und vom Ende – Lebensübergängen mit offenem Herzen begegnen
In den existenziellsten Momenten gehalten werden
Geburt und Tod in Händen der Frauen
Wie werde ich eine Death Doula?
»Rites de passage« – Übergangsriten zwischen den Welten
Deutschland braucht Death Doulas – und einen sanften Blick auf den Tod
Mit offeneren Augen auf den Tod schauen – von einer neuen, zarten Bewegung
Tod und Berufung – wie Menschen zu dieser Arbeit finden
Eine Einladung an dich
Kapitel III: Gefährtinnen an den Schwellen des Lebens – was eine Death Doula sein kann
Going With Grace
Wie sieht der Alltag einer Death Doula aus?
Zwischen Wissen und Nichtwissen
Aus dem Leben: Menschen, Fragen, Gefühlen, denen ich als Death Doula begegne
Wie kann ich meine eigene Death Doula werden?
Und wenn ich mich professionell zur Death Doula ausbilden lassen will?
Welche Aus- oder Weiterbildung passt zu mir?
Kapitel IVWie viel können wir mit dem Tod anfangen? Vom Umgang unserer Gesellschaft mit der Endlichkeit
Aus dem Leben: Was der Krieg mit unserer Trauer machte
Corona – eine neue kollektive Todeserfahrung
Der Tod ganz lebendig unter den Menschen – ein Blick in andere Kulturen
Wie sterben wir eigentlich in Deutschland?
Wandel in der Bestattungskultur – neue Rituale und mehr Nachhaltigkeit
Eine bewusste Bestattungskultur – im Sinne der Natur
Wenn Digitales neue Nähe schafft
Politischer und gesellschaftlicher Aktivismus rund um das Lebensende
Endlichkeitsmeditation
Kapitel VDas Ende halten, vielleicht sogar lieben lernen – für einen neuen Anfang
Der Tod lädt uns ein, ihn kreativ zu gestalten
Spirituelle und philosophische Dimensionen zum Lebensende
Sind wir alle gleichermaßen in der Lage, uns vorzubereiten?
Aus dem Leben: Wie Menschen sich auf das Lebensende vorbereiten
Zwischen Tod und Bestattung – Abschied nehmen von Mensch zu Mensch
Historische und kulturelle Perspektiven – Abschied im Wandel der Zeit
Neue Türen öffnen: Als ich zum ersten Mal eine Verstorbene versorgte
Intimität vs. Überforderung – ein Spannungsfeld zwischen Nähe und Grenze
Aus dem Leben: Dem Tod begegnen – aber wie?
Trauer und Gedenken – zwischen Verlust und Verbindung
Neue Formen des Gedenkens – analog und digital
Aus dem Leben: Trauernde sprechen
Meine wundersame Begegnung zwischen Leben und Tod
Kapitel VILet’s talk about death! In der und durch die Trauer begleiten
Die Worte, die uns fehlen – und die, die wir neu erfinden
Den ersten Schritt tun
Familiäre Dynamiken – zwischen Fürsorge, Konflikt und Sprachlosigkeit
Was hätte sie gewollt? – Ein Abschied, drei Perspektiven
Generationenrollen im Wandel
Neues übereinander herausfinden
Wie beziehe ich Kinder mit ein?
Rituale als Türöffner, um mit Kindern über den Tod zu sprechen
Abschied vom Haustier – ein erster Berührungspunkt mit dem Tod
Aus dem Leben: Wie Kinder Abschied nehmen
Der Tod im Arbeitsumfeld – zwischen Pflicht- und Mitgefühl
Trauer am Arbeitsplatz – von der Einzelfalllösung zur Unternehmenskultur
Führungskräfte sind Kulturträger – jedoch keine Therapeutinnen und Therapeuten
Trauerkompetenz entwickeln – durch Aufklärung und Fortbildung
Strukturen schaffen – durch Rituale und institutionelle Begleitung
Aus dem Leben: Trauer im Job
Das Sprechen rund um stille Geburt, Fehlgeburt und unerfüllten Kinderwunsch
Neue Gesprächsräume schaffen – wenn der Tod einen Platz bekommt
Aus dem Leben: Miteinander über den Tod ins Gespräch kommen
Grenzen setzen: Darf ich auch mal »nicht wollen«?
Kapitel VIIIn die eigene Endlichkeit hineinspüren – wie wir der Angst vor dem Tod begegnen können
Etwas Persönliches zum Thema »Lebenserwartung«
Phase 1: Der eigenen Endlichkeit begegnen
Phase 2: Sich auf das Lebensende vorbereiten
Phase 3: Den Tod (mit)erleben
Phase 4: Trauern und gedenken
Den Tod ins Leben hineinnehmen
Zum guten Ende
Danke
Ressourcen für deine Reise
Anmerkungen
Prolog
Meine Tochter kommt zur Welt und ich gehe fast
Berlin im Februar 2019. Die Stadt um mich herum war in Bewegung, doch in mir schien alles stillzustehen. Wie so oft in den letzten Tagen und Wochen ging ich durch die Straßen, versuchte, mich abzulenken, zu beschäftigen. Trotzdem blieb das Gefühl des Wartens und der Ungeduld – und der Hoffnung, dass irgendetwas, das ich tat (etwas Scharfes essen, Yoga machen, doch ein Glas Prosecco trinken?), endlich den Moment in Gang setzen würde, auf den ich schon so lange gewartet hatte. Rita war überfällig. Tag für Tag hoffte ich, dass sie sich ankündigen würde, doch nichts geschah. Mein Bauch war so dick, dass ich ohne andere Hilfe nur noch langschaftige Stiefel anziehen konnte, die von weit oben greifbar waren. Meinen eigenen Geburtstag, den letzten, den meine zu dem Zeitpunkt zweijährige Tochter Rosa als Einzelkind verbringen würde, hatte ich vor Kurzem im stark dehnbaren Paillettenkleid als wandelnde Discokugel verbracht.
Der Nachmittag dieses 18. Februars zog sich zäh dahin. Mein Mann und ich hatten gerade in einem Café mit einem Vater gesprochen, der uns hinterherrief, wir sollten es genießen. Ein Termin bei der Hebamme stand jetzt noch an, und ich rechnete damit, dass wir auch heute wieder unverrichteter Dinge nach Hause gehen würden. Dass immer noch Warten angesagt wäre. Doch als wir im Behandlungszimmer saßen, geschah etwas Unerwartetes. »Ich höre heute die Herztöne nicht so gut.« Die Worte unserer Hebamme kamen ruhig aus ihrem Mund, doch sie hallten nach wie ein leises Echo. Mein Mann und ich sahen uns an. Keine Panik, noch nicht, nur ein seltsames Gefühl der Orientierungslosigkeit. Wir sollten ins Krankenhaus fahren, sicherheitshalber, sagte sie. Es würde schon alles gut sein.
Wir stiegen ins Auto, fuhren durch die Straßen, die wir gut kannten, aber an diesem Tag schienen sie verändert. Wir waren verändert. Die neue Situation war da, aber anders, als ich es mir gedacht und gewünscht hatte. Alles in Zeitlupe. Langsam stieg Unruhe in mir auf. Ich dachte an die beiden Frauen in meinem Bekanntenkreis, die ihre Kinder kurz nach dem errechneten Geburtstermin verloren hatten. Das Leben und der Tod, so nah beieinander.
Im Krankenhaus schloss man mich an den Wehenschreiber an, und da waren sie, die Herztöne. Schwach, aber vorhanden. Alles gut? Alles gut. Die Hebamme fragte, ob ich die Geburt einleiten wollte. Ich schüttelte den Kopf. Äußerte aber den Wunsch, hierzubleiben. Nur für den Fall. Sie sah mich an, zögerte, sagte, das sei eigentlich nicht nötig. Doch ich hatte ein komisches Gefühl. Die Nacht im Krankenhaus schien mir ein vernünftiger Kompromiss, sollte Rita sich entscheiden, endlich ihren Weg zu uns zu finden.
Frühmorgens dann die Bestätigung, dass es gut gewesen war, auf meinen Instinkt zu hören. Ein sogenannter Wehensturm setzte ein: Stundenlang erbarmungslose Wellen, ohne Pause, ohne Atemholen. Die Schmerzen – es gab keinen Vergleich. Als ob mein Körper gevierteilt würde. Durch die Erschütterung begann sich die Plazenta zu lösen, und ich wusste, dass meine Tochter und auch ich in Gefahr waren. Überall Blut. Ich fühlte mich hilflos, wie ein Boot im Sturm.
Ich sah die Hebamme an, meinen Mann – sie gaben ihr Bestes, doch ihr Ausdruck verhieß nichts Gutes. »Oh.« Das war alles, was die Ärztin sagte, als sie das Zimmer betrat. Es war klar, wie ich mich entscheiden musste. Vier Menschen hielten mich fest, um mir trotz des Bebens die PDA für den Kaiserschnitt setzen zu können. Nicht das, was ich gewollt hatte, aber ich wusste, dass mir keine Wahl blieb. Auch wenn sie mir gefühlt eine ließen.
Währenddessen hatte ich das Gefühl, dass ich mich bereits auf der Schwelle befand – an jenem Ort zwischen Leben und Tod, einer Schleuse oder einem Zwischenraum, in dem die Zeit stillsteht. Wo die Seele zu wandern beginnt, lange bevor der Körper aufgibt. Würden meine Tochter und ich uns hier zwischen den Schleiern zum ersten und vielleicht letzten Mal begegnen, ehe sie das Licht der hiesigen Welt erblickte?
Dann ging alles sehr schnell, und sie war da. Rita.
Ihr Weg zu uns war von einer solchen Heftigkeit gewesen, dass ich sie nicht gleich ansehen konnte. Als sie mir auf die Brust gelegt wurde, spürte ich sie, fühlte ihre Wärme, aber es war, als müsste ich mich erst wieder in diesen Raum zurückkämpfen. In dieses einfache, schlichte Krankenhauszimmer, nach einer Reise, die mich an die äußersten Grenzen des Lebens geführt hatte.
Im Wochenbett las ich über den Tod. Geschichten von großen Übergängen und Lebenszyklen zogen mich magisch an, fesselten mich. Familie und Freunde waren erst etwas verwirrt und wohl auch besorgt, doch sie ließen mich machen, als sie sahen, wie sehr mich dieses Thema belebte. Die Gedanken an den Tod wurden meine ständigen Begleiter, doch nicht auf dramatische, sondern essenzielle Weise. Und ich verstand, dass der Weg, den ich bei der Geburt meiner Tochter gegangen war, mehr bedeutet hatte als ein Übergang in ein neues Leben. Er war auch ein Blick auf das Ende gewesen.
Zufällig stolperte ich in dieser Zeit online über die US-Amerikanerin Alua Arthur und ihre Arbeit. Ihr »Beruf«, mehr aber ihre Berufung: Death Doula. Der Begriff leuchtete mir auf meinem Bildschirm entgegen, als wäre er immer schon da gewesen und hätte nur auf mich gewartet. Eine Hebamme – nur in die andere Richtung. Ein Mensch, der nicht das Leben empfängt, sondern in den Tod begleitet. Der Raum schafft, wo gefühlt keiner ist. Möglichkeiten aufzeigt, wo alles aussichtslos erscheint. Wie mir bei Ritas Geburt. Zur gleichen Zeit gewann das Coaching-Unternehmen, für das ich arbeitete, einen neuen Kunden. Ein Zusammenschluss von Bestattungsinstituten, die eine Website in Auftrag geben wollten, auf der man sich mit seiner eigenen Beerdigung auseinandersetzen konnte. Es schien, als würde sich alles fügen. Ich meldete mich sofort aus der Elternzeit zurück.
Bei meinem ersten Gespräch mit unserem neuen Kunden, mit Rita in der Trage, betrat ich ein Gebäude im Berliner Westend, genau gegenüber der Geburtsklinik, wo ich sie zur Welt gebracht hatte – und sie mich. Ein erster Kreis hatte sich geschlossen, und ein neuer Weg lag vor mir. Einer, dem ich bereit war zu folgen.
Kapitel I
Über die Geburt dieses Buches und wie du es lesen kannst
Dieses Buch speist sich aus vielen Quellen – aus Gesprächen in Hospizen, in Bestattungsunternehmen und in Küchen nach Trauerfeiern, aus Begegnungen mit Sterbenden und Trauernden, aus Erfahrungen, die ich als Death Doula machen durfte, aus dem Schreiben während schlafloser Nächte, in denen das Leben groß und zerbrechlich schien. Und es ist entstanden, weil ich überzeugt bin: Wir brauchen neue, offenere Formen, über den Tod zu sprechen – und mit ihm zu leben.
Vielleicht hast du dieses Buch in der Hand, weil du jemanden verloren hast. Vielleicht, weil du Angst vor dem Sterben hast. Oder weil du spürst, dass es an der Zeit ist, dich dem Thema Tod zu nähern, ohne dass ein konkreter Anlass dich dazu zwingt. Was auch immer dich hergeführt hat – dieses Buch ist für dich.
Es ist kein klassisches Sachbuch und auch kein Ratgeber im engen Sinn. Es will kein festes Ziel erreichen. Vielmehr ist es ein Begleiter: ein Gefäß für Gedanken, Erfahrungen, Werkzeuge, Bilder, Stimmen, Möglichkeiten. Es lädt ein zur Reflexion, zur aktiven Auseinandersetzung, zum Innehalten.
Du kannst es von vorne bis hinten lesen – vom ersten bis zum letzten Kapitel. Oder du kannst es irgendwo zufällig aufschlagen, eine Seite »ziehen«, wie du eine Spielkarte ziehen würdest, dich von dort aus weitertreiben lassen, dir heraussuchen, was dich gerade anspricht. Einige Abschnitte sind eher erzählend, andere konkret und praxisnah.
Was dich unter anderem erwartet:
Impulse und Reflexionsfragen, die dir helfen können, über dich selbst, deine Beziehungen und deinen Umgang mit dem Tod nachzudenken.Übungen und Rituale für verschiedenste Formen deiner Begegnung mit dem Leben, dem Sterben, dem Tod und der Trauer, die du allein oder mit anderen ausprobieren kannst.Handreichungen und Checklisten, die bei der konkreten Vorsorge helfen – von der Patientenverfügung bis zur Gestaltung deiner Trauerfeier.Ressourcen und Empfehlungen – Bücher, Filme, Podcasts, künstlerische Arbeiten und Anlaufstellen, die Fragestellungen und Themen weiterführen und vertiefen.Fallgeschichten und persönliche Erlebnisse, Assoziationen, emotionale Momentaufnahmen, die den Text als kleine »Zwischenräume« durchweben, in denen du dich dem Thema auf poetische, fragmentarische Weise annähern kannst.Du musst nichts davon »machen«. Aber du kannst dich einladen lassen, zu überlegen, was dein Weg sein kann. Vielleicht mit einem Stift in der Hand in einem ruhigen Moment, vielleicht gemeinsam mit jemandem, mit dem du sonst nie über solche Dinge sprichst.
Der Tod ist keine To-do-Liste, kein Projekt. Aber er ist auch kein fremdes Land, das wir nie betreten dürfen. Wenn du möchtest, begleite ich dich ein Stück dorthin. Nicht, um dir die Angst zu nehmen – sondern, um deinen Mut zu wecken, sie auszuhalten. Und vielleicht sogar etwas Schönes darin zu entdecken.
Kapitel II
Vom Anfang und vom Ende – Lebensübergängen mit offenem Herzen begegnen
Meine erste Begegnung mit dem Tod hatte ich wie jeder andere Mensch nicht auf einem Friedhof, sondern bei meiner eigenen Geburt. Die Erschütterung im Mutterleib, das Sich-Hindurchquetschen durch den Geburtskanal oder das abrupte Hinausgehebelt-Werden bei einem Kaiserschnitt zählen zu den intensivsten Nahtoderfahrungen, die wir durchleben können – und sind gleichzeitig etwas, das wir für den Rest unseres Lebens verdrängen.
Geburt ist ein Anfang – und gleichzeitig eine Schwelle. Nicht nur für das Kind. Auch für die Mutter. Viele Frauen fordert dieses Ereignis nicht nur körperlich extrem, es stellt auch mental eine tiefgreifende Grenzerfahrung dar. Psychologisch oft als Kontrollverlust erlebt, ist es gleichzeitig verbunden mit einer plötzlichen Klarheit darüber, was wirklich zählt. Das kann empowernd sein, aber auch überfordernd. Viele Frauen berichten von dem Gefühl, in einem Zwischenraum gewesen zu sein – »nicht mehr ganz hier«, aber auch »noch nicht ganz dort«.
Rein physisch kommt eine Geburt einer Hochleistung gleich: Der Körper mobilisiert Kräfte, die ihn an seine äußersten Grenzen führen – hormonell, muskulär, nervlich. Die gesamte biochemische Zusammensetzung unseres Organismus ändert sich durch diesen Vorgang. Geburten sind von einer Intensität, die sich nicht nur in Glücksgefühlen, sondern auch in Schmerz und Angst ausdrücken kann. Wird das Ereignis als traumatisch erlebt, kann es immense Spuren hinterlassen – bis hin zu postpartalen Traumafolgestörungen.
Spirituell berichten viele Menschen – insbesondere nach besonders schwierigen oder lebensbedrohlichen Geburten – von Zuständen, die an sogenannte Nahtoderfahrungen erinnern: dem Gefühl, »aus dem Körper zu treten«, einer veränderten Zeitwahrnehmung oder einer tiefen Verbindung mit etwas Größerem. Studien zeigen, dass derartige Erfahrungen das Weltbild dauerhaft verändern können: hin zu mehr Dankbarkeit, einem neuen Zugang zu Spiritualität oder dem Wunsch, dem Leben eine neue Richtung zu geben.
Das Erleben einer Geburt wirkt in jedem Fall nach – bewusst oder unbewusst. Es kann die Entscheidung für oder gegen weitere Kinder beeinflussen, neue Lebensfragen aufwerfen oder ein Umdenken in beruflichen und persönlichen Beziehungen auslösen. Wer eine Geburt als existenziell erfährt, wird oft auch für andere Übergänge im Leben – wie Krankheit, Trennung oder Tod – empfindsamer. Und manchmal, so wie in meinem Fall, kann sie der Wendepunkt hin zu einer neuen Berufung sein.
In meiner Familie war der Tod nie weit weg. Mein Vater ist Onkologe, der Tod und der Kampf gegen ihn waren ständige Begleiter im Hintergrund. Doch es sollte noch viele Jahre dauern, bis ich herausfinden würde, dass ich meinen beruflichen und persönlichen Weg genau hier, in der aktiven Beschäftigung mit dem Lebensende, finden würde.
Zunächst arbeitete ich in einer vermeintlich völlig anderen Welt: der Mode. Eine Branche, die sich oberflächlich um Trends und Neuheiten dreht – und in Wahrheit zutiefst von Vergänglichkeit geprägt ist. Mode lebt vom ständigen Wandel. Trends werden geboren, erfahren einen Höhepunkt und sterben wieder. Manchmal kehren sie zurück, wie alte Bekannte, die erst nicht wiederzuerkennen sind und trotzdem einen vertrauten Kern haben. Es ist ein unaufhörlicher Zyklus von Entstehen, Vergehen und Neuerstehen – nur auf ästhetischer Ebene.
Nicht zufällig setzten sich Designer wie Alexander McQueen, Gareth Pugh oder Thierry Mugler in ihrer Arbeit explizit mit dem Tod auseinander. Ich erinnere mich an ihre Schauen, Inszenierungen des Endes, in denen ich von einer fast schon unheilvollen Lebendigkeit, einem atemlosen Bewusstsein für die Kürze und Heftigkeit unserer Existenz gepackt wurde.
Gerade von McQueen sind mir einige Szenen lebhaft vor Augen geblieben. Etwa als jemand in einer gläsernen Box scheinbar an lebenserhaltende Maschinen angeschlossen oder ein Model von einem Farbe spuckenden Roboter »erschossen« wurde. Auch als das Hologramm von Kate Moss als Geist erschien. Das waren sehr direkte Anspielungen. Ganz abgesehen davon, dass der Designer selbst suizidal war und sich später tatsächlich das Leben nahm. Ich erkannte Mode als äußere Hülle, die versucht, das Gefühl individueller Zerbrechlichkeit zu mildern, indem sie diese im Design nach außen trägt. Kleidung als Schutz, als zweite Haut, als Rüstung gegen unsere Verwundbarkeit. Und gleichzeitig ein Ausdruck dessen, was wir loslassen müssen: den Körper, die Jugend, das Leben selbst.
Vielleicht war es kein Zufall, dass ich mich in dieser Welt wohlfühlte. In der Modewelt sind wir dem Tod auf gewisse Weise näher als der Jugend, obgleich diese als Ideal in der Branche geradezu zelebriert wird. Ich aber spürte den unbewussten Dialog mit der Vergänglichkeit, die Essenz menschlicher Existenz und den unaufhörlichen Rhythmus der Lebenszyklen, den wir alle durchlaufen. All das verbarg sich hinter den glanzvollen Kulissen.
In den existenziellsten Momenten gehalten werden
Die Faszination rund um den Tod begleitete mich, noch bevor ich sie benennen konnte. Es war aber nicht das Sterben selbst, das mich anzog, oder das »Totsein«. Es war die Tiefe, die dieses große Lebensthema eröffnete. Die Fragen, die keine klaren Antworten kannten. Die Gespräche, in denen niemand recht haben konnte und in denen man sich sehr schnell sehr nah kam. Es gibt in vielen Dingen kein Richtig oder Falsch, so auch, wenn es um den Tod geht. Er ist wie eine Einladung, gemeinsam zu fantasieren. Denn natürlich weiß niemand wirklich, was im Moment des Sterbens passiert, es gibt unendlich vielfältige Perspektiven darauf.
Die Entwicklung, mich intensiver als bisher mit dem Tod zu beschäftigen, fiel in die Phase der Schwangerschaft mit meiner zweiten Tochter. Ich erinnere mich an einen Tag, an dem ich mit meinem Vater – er war mit meiner Mutter angereist, um rund um die Geburt bei der Betreuung meiner älteren Tochter zu helfen – durch ein Kulturkaufhaus in Berlin schlenderte. In einer Ecke zwischen Spiritualität und Psychologie fiel mir ein Buch über Bestattungsrituale in die Hände. Ich verschlang es in wenigen Stunden. Noch wusste ich nicht, wie relevant es auch auf eigener körperlicher Ebene für mich werden würde.
Historisch und kulturell sind Geborenwerden und Sterben oft viel näher beieinander, als wir normalerweise bereit sind, emotional zuzulassen. Viele Völker wissen um diese Verbindung, viele Traditionen spiegeln sie und bringen sie in symbolhaften Ritualen zum Ausdruck. Nicht umsonst sind Hebammen auch bei uns oft dafür ausgebildet, während des Geburtsprozesses mit dem Tod umzugehen. Beide Handlungen, sei es Menschen in die Welt hinein- oder hinauszubegleiten, haben meiner Erfahrung nach eine tief feminine Qualität. Die Übergänge zwischen den Welten zu halten und zu gestalten, sind jedenfalls Qualitäten, die oft von Frauen getragen werden. Einmal in der Rolle als Gebärende, zum anderen in der Rolle derjenigen, die das Leben am Anfang und am Ende begleiten: als Hebammen oder Doulas, die werdende Mütter im Geburtsprozess unterstützen. Oder am anderen Ende des Pfades, als Death Doulas, die dabei helfen, sich auf den Tod vorzubereiten, und an der Seite von Sterbenden sind und bleiben bis zum Schluss. Genau als Death Doula ließ ich mich wenig später dann auch ausbilden.
War die Schwangerschaft mit Rita eine Art intuitives Sichbereitmachen wurde die Geburt meine tatsächliche Initiation. Der Wehensturm ließ mich ganz plötzlich in eine Zwischenwelt abrutschen. Meine Tochter war noch nicht ganz auf der Welt angekommen und ich gefühlt schon auf dem Weg hinaus. Zumindest beinahe. Ich spürte, wie seiden der Faden ist, an dem wir hängen. Und wie wichtig es ist, wer in solchen Momenten bei einem ist.
Ich hatte das Glück, gut begleitet zu sein – von der Hebamme, der Ärztin, meinem Mann. Und ich verstand bereits in diesem Moment: So, wie ich während der Geburt einen Weggefährten, eine Weggefährtin brauchte, würde ich sie auch beim Sterben benötigen. Viele Menschen kommen durch eine Verlusterfahrung zur Auseinandersetzung und vielleicht sogar künftigen Arbeit mit dem Tod. Ich bin dankbar, mit diesem neuen Lebenssinn sogar noch einen ganz besonderen Menschen, meine Tochter Rita, hinzugewonnen zu haben.
Es ist überwältigend – Respekt einflößend und vielleicht sogar beängstigend –, dass wir als Frauen in der Lage sind, Leben in uns zu tragen. Auch dass wir über Leben entscheiden können, manchmal entscheiden müssen. Und in anderen Fällen nicht entscheiden dürfen. Oder können. Ich habe mich ganz bewusst für meine beiden Töchter entschieden. Sie auf diese Welt zu bringen. Ohne die moderne Medizin hätte ich keine der beiden Geburten überlebt. Und meine Mädchen auch nicht.
Die Wegkreuzung mit dem Tod war für mich eine Entdeckung und fühlte sich zugleich wie eine Rückverbindung mit einem uralten Sinn an. Meine Arbeit sollte nicht mehr darin bestehen, Dinge zu verschönern oder Trends zu begleiten. Ich wollte Räume schaffen, in denen Menschen in den existenziellsten Momenten ihres Lebens gehalten werden.
Geburt und Tod in Händen der Frauen
Geburt und Tod galten über Jahrhunderte hinweg als zutiefst weibliche Domänen. Hebammen begleiteten das Ankommen im Leben, Totenfrauen das Gehen. In beiden Momenten war Wissen gefragt, das auf Erfahrung beruhte, auf Intuition, Fürsorge und Präsenz. Es war ein Wissen, das nicht verschriftlicht, sondern weitergegeben wurde – im direkten Kontakt, im Tun, in der Nähe zum Körper.
Mit der zunehmenden Professionalisierung und Institutionalisierung von Geburt und Tod im 19. und 20. Jahrhundert wurden beide Prozesse aus der privaten, meist weiblich geprägten Sphäre herausgelöst und in medizinische und administrative Systeme überführt. Was lange in den Händen von Frauen lag, wandelte sich an vielen Stellen zur männlich dominierten Angelegenheit: ärztliche Kontrolle über den Geburtsvorgang, klinische Sterbeprozesse unter Aufsicht von Apparaten und Formularen. Diese Entwicklung bedeutete nicht nur den Verlust einer anderen, tieferen Art von Wissen, sondern auch von Autonomie. Frauen wurde über Generationen hinweg abgesprochen, ihre Kinder selbstbestimmt zur Welt zu bringen – und später auch, im Sterbegeleit Verantwortung zu übernehmen. Geburt und Tod waren zu Ausnahmezuständen geworden, die Fachleuten vorbehalten sein sollten. Dabei verloren viele Menschen das Vertrauen in ihre eigene Fähigkeit, genau diese existenziellsten Erfahrungen zu halten und zu gestalten.
Die Bewegung aber, sich genau diese Kompetenzen wieder anzueignen, diesen urmenschlichen Instinkt wieder zum Leben zu erwecken, wächst: In Berlin zum Beispiel entscheiden sich immer mehr Frauen für hebammengeführte Kreißsäle in Krankenhäusern, für Geburtshäuser oder Hausgeburten – nicht aus Ablehnung der Medizin gegenüber, sondern weil sie mehr Selbstbestimmung und Körperverbundenheit erleben wollen.
Ähnliche Entwicklungen deuten sich in der Sterbebegleitung an: Immer mehr Angehörige entschließen sich auch in städtischen Kontexten wieder für eine Aufbahrung. Sie bereiten den Raum entsprechend vor, waschen die verstorbene Person, zünden Kerzen an, singen Lieder, halten Wache. Es ist ein zutiefst berührender, manchmal auch heilender Prozess – der Tod wird nicht ausgelagert, sondern bleibt in der Mitte des Lebens. Dazu gebe ich später im Buch noch viele Anregungen.
Auch in queeren Kontexten ist diese Wiederaneignung spürbar: Menschen, die ihr Geschlecht oder ihre Familienkonzepte jenseits klassischer Normen leben, entwickeln oft ganz eigene Formen von gewählter Familie und auch von Abschiedsritualen. Transpersonen, die im Leben oft um Sichtbarkeit und Akzeptanz kämpfen mussten, werden bei queersensiblen Bestattungen in ihrer Identität gewürdigt. Angehörige oder Freundeskreise gestalten Zeremonien, die nicht nach kirchlichem Schema ablaufen, sondern nach den Wünschen und Lebensentwürfen der Verstorbenen.
Die feministische Bewegung hat sich der gesellschaftlichen Entfremdung rund um den Tod vielfach angenommen – in der Hebammenarbeit, in der Geburtshausbewegung, in der Doula-Ausbildung, im selbstbestimmten Sterben. Die Rückeroberung dieser Schwellenräume bedeutet nicht nur, sich persönliche Handlungsmacht zurückzuholen. Sie ist auch ein Akt der politischen Repositionierung: Wer Geburt und Tod begleitet, begleitet nicht nur einen Menschen. Sondern wirkt auch auf gesellschaftliche Narrative, Normen, Exklusion – und schreibt sie um.
Wenn Menschen heute entscheiden, ihre Verstorbenen selbst zu waschen, dann ist das nicht nur eine spirituelle oder persönliche Entscheidung. Es ist eine bewusst gewählte Handlung, die bestehende Machtverhältnisse hinterfragt. Die sagt: Ich kann das. Ich darf das. Ich traue mir zu, dem Tod zu begegnen. Das ist nicht naiv oder esoterisch, sondern birgt eher ein radikales Moment, und zwar ganz sprichwörtlich, indem es an die Wurzel geht. Indem es die Grundfrage berührt, wie wir unsere Fürsorge organisieren und wem unsere Körper gehören. Und wem wir zutrauen, Verantwortung zu übernehmen – besonders in Momenten, die uns bis ins Mark erschüttern.
Gerade in diesen Räumen liegt ein enormes transformatorisches Potenzial. Wer Geburt und Tod wieder ins Leben holt, ins Sichtbare, ins Erlebbare, stellt sich gegen eine Kultur der Verdrängung. Und für eine Kultur der Verbundenheit.
Wie werde ich eine Death Doula?
Auf die Idee, mich als Death Doula ausbilden zu lassen, stieß ich während meiner Internetrecherche im Wochenbett. Eine Art Hebamme des Todes. Wir wissen nicht so richtig, wo wir herkommen – und wo wir hingehen eben auch nicht. Aber wir können uns begleiten lassen, gehalten werden. Ich spürte eine tiefe Resonanz – nicht aus einer morbiden Faszination heraus, sondern aus einem Bedürfnis nach Wahrheit, Echtheit und Nähe. Danach, das ursprüngliche Menschsein, das roh und gewaltig sein kann, das sich vermutlich gerade deshalb in unserer Gesellschaft so oft verstecken muss und dem ich gerade während der Geburt ausgesetzt gewesen war, wieder an mich heranzulassen.
Anders als beim heute so zur Norm gewordenen Sterben im Krankenhaus suchte ich nach einer sanfteren Sprache für das, was am Lebensende geschieht. Nach Möglichkeiten, Schönheit und Würde in einen Moment zu bringen, der so oft von Angst und Hilflosigkeit überschattet wird. So etwas wie Tiefe und vielleicht sogar etwas wie Magie zu empfinden, wenn Dinge passieren, die wir nur begleiten oder bezeugen, aber nicht in ihrer Gänze erklären können.
Spiritualität spielte für mich dabei eine große Rolle: die Offenheit dem gegenüber, das größer ist als wir selbst. Die Akzeptanz, dass wir nicht alles kontrollieren können – und gerade darin Trost finden, uns dieser Tatsache hingeben zu dürfen.
Wie bereits erwähnt: In vielen alten Kulturen galten Geburt und Tod nicht als Gegensätze, sondern als verwandte Schwellen – zwei Seiten derselben Tür. Die Griechen beispielsweise kannten die Moiren, jene drei Schicksalsgöttinnen, die den Lebensfaden spannen, bemaßen und schließlich durchtrennten. Klotho, die Spinnerin, brachte das Leben hervor, Lachesis maß seine Länge, Atropos vollendete es mit einem Schnitt. Der rote Faden, der bei der Geburt aufgenommen wird, reicht bis zu jenem Moment, in dem er wieder losgelassen wird.
Auch in der keltischen Welt waren Geburt und Tod untrennbar miteinander verbunden. Die Priesterinnen der alten Tradition, oft Hebammen und Totenwächterinnen zugleich, hüteten das Wissen um die Schwellenzeiten. Sie hielten den Raum, wenn eine Seele kam – und wenn eine ging. In ihren Überlieferungen galt die Geburt nicht nur als Ankunft, sondern auch als Rückkehr und der Tod nicht als Ende, sondern als Übergang in eine andere Seinsform. Der Schleier zwischen den Welten war durchlässig.
In Ägypten begleitete Anubis, der schakalköpfige Gott, die Toten durch das Jenseits. Und im alten Indien verband der Fluss Samsara alle Daseinsformen in einem ewigen Strom des Werdens und Vergehens. Geburt, Tod, Wiedergeburt – nicht linear, sondern zyklisch gedacht.
Auch im japanischen Shintoismus sind Geburt und Tod Teil desselben Naturkreislaufs. Der Tod wird dort als energetischer Wandel, als Rückführung zur Quelle gesehen. Die Kami, Naturgeister, wohnen sowohl im Wind, der den ersten Atemzug bringt, als auch im letzten Ausatmen eines Lebens. Der Mensch ist durchlässig, durchströmt von etwas, das größer ist als er selbst.
Im Judentum ist das »Elijahu Hanavi« ein Lied, das Kindern kurz nach der Geburt gesungen wird – und das Sterbende ebenfalls begleiten kann. Beide Male Ausdruck von Hoffnung auf ein Dazwischen, einen Übergang zwischen den Welten, eine Kontinuität des Geistes. Der Name des Propheten Elija steht hier für die Vermittlung zwischen Hier und Dort – für das Aufheben des Trennenden, das Verbinden des Kommenden mit dem Gehenden.
In der nordischen Mythologie ist Hel, die Göttin des Todes, kein Dämon, sondern eine Wächterin. Sie birgt die Seelen der Verstorbenen im Inneren eines Baumes oder unter den Wurzeln der Welt. Im Weltenbaum Yggdrasil wird sowohl der Ursprung des Lebens als auch seine Auflösung verortet. Die nordischen Völker glaubten, dass der letzte Weg nicht ins Nichts, sondern durch eine Landschaft führt, die man bereits aus seinen Träumen kennt – wie ein Nachhausekommen.
Und auch in christlichen Traditionen lebt das Bild von der zweiten Geburt: »Wer nicht stirbt, bevor er stirbt, der verdirbt, wenn er stirbt«, sagt Meister Eckhart. Geburt ist der erste Durchgang, der Tod der zweite – beide gelten als Tore zur Transzendenz. Es ist kein Zufall, dass in mittelalterlichen Darstellungen das Grab oft wie ein geöffnetes Tor oder wie ein Geburtskanal aussieht, aus dem die Seele emporsteigt.
Viele indigene Kulturen auf dem amerikanischen Kontinent glauben an eine Seelenwanderung, bei der verstorbene Ahnen im Körper von Neugeborenen wiederkehren können. Namen, Tätowierungen oder bestimmte Fähigkeiten gelten als Zeichen, dass die betreffende Seele nicht »neu« hier auf Erden ist, es sind Botschaften der Erinnerung an eine frühere Existenz. Ausdruck eines ewigen Zyklus. In der Tradition der Navajo etwa feiert man am vierten Tag nach der Geburt mit einem besonderen Ritual, dass ein Mensch »angekommen« ist – ebenso wie es Rituale gibt, die die Seele vier Tage nach dem Tod auf ihrer Reise begleiten.
Der Weg in diese Existenz und aus ihr hinaus war und ist in vielen dieser Kulturen von ähnlichen Zeichen begleitet: Wasser, Blut, Rufen, Wehklagen – das Öffnen und Schließen eines Tores. Vielleicht ist deshalb bei manchen indigenen Völkern der Begriff für die »Pforte des Lebens« und die »Pforte des Todes« identisch.
Beides, Ankunft und Abschied, verlangt Hingabe, Beherztheit und Begleitung. Und beides lässt uns erahnen, dass es mehr gibt zwischen Himmel und Erde als das, was wir greifen oder messen können. Geburt und Tod sind Schwesterkräfte, die sich die Hand geben. Und manchmal, wie in jener Nacht im Krankenhaus, kreuzen sie einander.
»Rites de passage« – Übergangsriten zwischen den Welten
Geburt und Tod markieren nicht nur Anfang und Ende eines individuellen Lebens, sondern gehören zu den universellsten Erfahrungen von uns Menschen. In nahezu allen Kulturen werden diese Schwellenerfahrungen von Ritualen begleitet, die schützen und auf die tiefere Bedeutung dieses Übergangs verweisen sollen. Der französische Ethnologe Arnold van Gennep prägte Anfang des 20. Jahrhunderts den Begriff solcher »rites de passage« – und stellte fest, dass sie oft einem wiederkehrenden Dreischritt folgen: Trennung, Schwellenzeit und Wiedereingliederung.
In der Trennungsphase löst sich ein Mensch oder seine soziale Rolle aus dem bisherigen Zusammenhang – etwa bei der Geburt, der Initiation ins Erwachsenenleben, der Menopause oder beim Sterben.Die Schwellenzeit (Liminalität) ist geprägt von Unsicherheit, Desorientierung und einem Zwischenzustand: Man ist nicht mehr das eine – aber noch nicht das andere.Erst in der Phase der Wiedereingliederung wird die neue Ordnung sichtbar. Ein Mensch kehrt gewandelt in die Gemeinschaft zurück: als erwachsene Person, Mutter, Witwer – oder als Verstorbene(r), eingebettet in das individuelle oder kollektive Gedächtnis.Van Gennep argumentierte, dass die westliche Moderne viele dieser Rituale abgeschwächt oder gar abgeschafft hat – mit Folgen für unser Erleben von Übergängen. Wenn Geburt medizinisch »verwaltet« und Tod institutionell »abgewickelt« wird, fehlt häufig die bewusste Begleitung des inneren Umbruchs. Die seelischen Prozesse bleiben ungerahmt, das Erleben wird vereinzelt. Viele Menschen spüren in solchen Momenten instinktiv, dass etwas fehlt – können aber oft nicht benennen, was es ist.
Rituale geben dem Unbenennbaren Form. Sie helfen, innere Prozesse äußerlich sichtbar zu machen und gemeinsam zu tragen. In traditionellen Kulturen übernahmen Schamaninnen, Hebammen oder Trauerfrauen diese Rolle – sie begleiteten mit Worten, Gesten, Gesängen, symbolischen Handlungen. In unserer Gegenwart suchen neue Berufsrollen wie Death Doulas an diesen Faden anzuknüpfen: nicht, um alte Rituale eins zu eins zu reaktivieren, sondern, um individuelle, sinnstiftende Formen zu finden, mit denen Menschen diese Übergänge gestalten können.
Leben und Tod begrüßen – ein Blick in andere Kulturen
Schon in frühen Hochkulturen wurden Geburt und Tod nicht als rein biologische Vorgänge verstanden, sondern als heilige Schwellen, die besonderer Begleitung und symbolischer Rahmung bedurften. Keltische, griechische, ägyptische und mesopotamische Kulturen kannten aufwendige Rituale, um den Übergang von einem Zustand in den nächsten zu gestalten – und damit gesellschaftlich wie spirituell einzubetten.
In der keltischen Mythologie war die Welt der Lebenden eng verwoben mit der der Ahnen und Geister. Geburt galt nicht nur als Anfang, sondern als eine Art Wiederkehr aus einer jenseitigen Sphäre. Neugeborene wurden oft in der Nähe von Quellen oder unter freiem Himmel im Leben willkommen geheißen, um den natürlichen Kreislauf zu ehren. Frauen, die gebaren, galten als heilig und gefährdet zugleich – denn sie bewegten sich im »Dazwischen«. Druidinnen segneten das Neugeborene, gaben ihm Schutzamulette mit auf den Weg und banden das Kind symbolisch an den Stamm der Lebenden.
Auch das Sterben bedeutete einen Übertritt in ein anderes Dasein. Man glaubte, dass die Seele weiterreise und dabei Geleit brauche – etwa durch Lieder, Grabbeigaben oder die Totenwache. Noch lange nach dem Tod wurden bestimmte Tage genutzt, um Kontakt mit den Verstorbenen aufzunehmen – etwa zu Samhain, dem Vorläufer von Halloween, der heutzutage auch wieder mehr Sichtbarkeit erfährt.
In der griechischen Antike stand die Geburt unter dem Schutz der Göttin Eileithyia, einer Tochter der Hera, der Schwester und Gemahlin des Zeus. Sie half beim Öffnen des Geburtskanals – ein Akt göttlicher Gunst und Gnade. Hebammen waren angesehene Personen, aber auch mit Tabus belegt – sie standen in engster Verbindung zum Heiligen. Die Geburt erlebte man als Grenzphänomen zwischen Leben und Tod, denn die Sterblichkeit der Gebärenden war hoch. Rituale rund um Reinigung, rituelle Speisung und das erste Bad des Kindes markierten dessen Eintritt in die Gemeinschaft.
Beim Tod war es der Fährmann Charon, der die Seelen über den Fluss Styx führte – aber nur, wenn die Verstorbenen eine Münze (Obolos) als Bezahlung unter der Zunge trugen. Wer keine rituelle Bestattung erhielt, galt als ruhelos. Klageweiber begleiteten die Leichenwaschung und die Prozession zum Grab. Der Körper wurde mit Öl gesalbt, mit Blumen bestreut und Parfüm besprüht, die Lider wurden geschlossen. Auch hier zeigen sich Parallelen zum Ereignis der Geburt: ein zärtlicher, würdevoller Umgang mit dem Körper, in dem eben noch das Leben wohnte.
Die altägyptische Kultur machte aus dem Tod ein ganzes Lebensprojekt. Wer es sich leisten konnte, investierte früh in einen gut ausgestatteten Sarkophag, Grabbeigaben und rituelle Dienste – eine alte Form der Bestattungsvorsorge. Die Vorbereitung auf das Ende war dabei kein Zeichen von Pessimismus, sondern Ausdruck von Weisheit und erhöhtem Bewusstsein. Der Körper wurde einbalsamiert, um für die Reise ins Jenseits »funktionstüchtig« zu bleiben. Auch die Seelenaspekte Ba und Ka mussten versorgt werden – durch Gebete, Speisen und Tempelrituale. Geburt und Tod galten als Übergänge zwischen verschiedenen Bewusstseinsebenen, nicht als Anfang und Ende.
Die Navajo oder Diné – ein indigenes Volk Nordamerikas – verstehen Geburt als »Rückkehr aus der Anderswelt«. Die werdende Mutter wird in den letzten Wochen ihrer Schwangerschaft durch ein »Blessingway«-Ritual geschützt: eine intime Zeremonie unter Frauen, bei der gesungen und die Schwangere gekämmt und gesalbt wird. Alles dient dazu, das Kind willkommen zu heißen – nicht nur als Individuum, sondern als Teil eines größeren Netzwerks aus Familie, Ahnen und Naturkräften.
Auch im Sterben richtet sich der Blick auf den größeren Zusammenhang. Der Tod ist in der Lage, Ungleichgewicht in die heilige Ordnung zu bringen, wenn er jemanden aus dem Leben nimmt. Reinigungsrituale und Abschiedszeremonien wahren die Balance des Seins. Der Körper der Verstorbenen wird mit Würde behandelt, aber auch im Bewusstsein, dass er zurückgegeben wird – an Erde, Wind, Licht.
Im Hinduismus ist Geburt nicht Anfang und Tod nicht Ende, sondern beides Teil eines ewigen Kreislaufs namens Samsara. Die Seele (Atman) durchläuft viele Leben, um zu lernen, zu wachsen und sich schließlich aus diesem Zyklus zu befreien (Moksha).
Geburt ist deshalb ein Fest – und eine Mahnung zugleich. Denn jedes Ankommen in dieser Welt bedeutet auch eine neue Bindung an das diesseitige Leid und die Aufgaben, die eine Seele auf ihrem irdischen Weg zu meistern hat. Noch bedeutungsvoller ist oft der Tod: Je bewusster man stirbt, desto günstiger für die Seele und deren weitere Entwicklung. Besondere Rituale helfen deshalb bei einer intensiven Vorbereitung: das Sprechen heiliger Verse, das Ausrichten des Körpers auf den großen Übergang, die symbolische Reinigung des Geistes, zum Beispiel durch das Rezitieren von Mantras.
Sterbende werden nicht an den Rand der Gemeinschaft gedrängt, weil man nicht hinschauen möchte, sondern bewusst begleitet, oft im Familienverbund. Die Seele soll den Körper friedlich und geführt verlassen können. Auch nach dem Tod folgen eine Phase ritueller Begleitung und Tage des Trauerns, Rezitierens, Erinnerns und Loslassens.
In der traditionellen japanischen Kultur existieren buddhistische und shintoistische, Natur und Ahnen verehrende Vorstellungen nebeneinander. Geburt gilt als natürlicher, spirituell bedeutsamer Eintritt in die Welt der Lebenden. Die ersten Tage danach sind heilig, das Neugeborene gilt als noch nicht vollständig »diesseitig«. Erst durch bestimmte Rituale wie das Miyamairi (ein Tempelbesuch nach 30 bis 100 Tagen) wird das Kind in der irdischen Welt verankert.
Im Tod wiederum betrachtet der Buddhismus die verstorbene Person als reisend: Die Seele geht durch Zeremonien wie das Otsuya (Nachtwache) oder eine siebenwöchige Gedenkphase sanft in die Welt der Ahnen über. Familien pflegen Ahnenaltäre (Butsudan), auf denen Bilder, Räucherstäbchen und Lieblingsspeisen der Verstorbenen stehen. Der Tod trennt nicht, er führt lediglich das Band zwischen den Menschen auf eine neue Ebene.
All diese Beispiele zeigen: Wo Tod und Geburt als Teil eines größeren Zusammenhangs verstanden werden, entstehen Rituale der Fürsorge, Schönheit und Klarheit. Existenzielle Übergänge der menschlichen Existenz werden nicht dem Zufall überlassen, sondern bewusst begleitet.
Deutschland braucht Death Doulas – und einen sanften Blick auf den Tod
Ich bildete mich nach meiner Geburtserfahrung beim amerikanischen Unternehmen Going With Grace aus, angeleitet von der gefühlten Mutter aller kontemporären Death Doulas: der in Los Angeles lebenden Alua Arthur. Während ich bei ihr online über emotionales Vermächtnis, Rituale am Lebensende und Möglichkeiten in der Verstorbenenversorgung lernte und an meiner ersten Todesmeditation teilnahm, begann ich, praktische Erfahrungen in deutschen Institutionen wie einem buddhistischen Hospiz und einem Bestattungsunternehmen zu sammeln, und erkannte: Diese Welten gilt es zu verbinden.
Der Tod hat ein miserables »Marketing« in Deutschland. Obwohl er in zahllosen Filmen und Serien vorkommt, fehlt uns echtes Wissen über ihn. Wissen, das Handlungssicherheit geben, Begegnung ermöglichen, uns für den Ernstfall wappnen könnte. Stattdessen fühlen wir: Angst, Unsicherheit, Distanz. So, als könnten wir ihn anlocken, wenn wir über ihn reden, scheuen die Menschen in Deutschland den Austausch über den Tod. Als könnten wir vermeiden, dass er zuschlägt, wenn wir ihn ignorieren. Aluas geflügelte Worte dazu sind mir aus meiner Online-Ausbildung noch lebhaft in Erinnerung: »Talking about sex won’t make you pregnant. Talking about death won’t make you dead.«
Die Gründe für unsere Verdrängung sitzen tief. Die Weltkriege überforderten unser Land existenziell und emotional. Um mit dem massenhaften Sterben fertigzuwerden, institutionalisierte man den Tod und ließ ihn hinter Krankenhaustüren und Bestattungsgesetzen verschwinden. Nach den Kriegen konnte man in vielen Fällen nicht mehr nachvollziehen, was mit den Toten passiert war, welche Wege sie gegangen waren. Vielleicht entstand auch dadurch die Reglementierungswut, die uns heutzutage so stark einschränkt. Das Wissen über Bräuche, Rituale und persönliche Formen des Umgangs mit dem Sterben geriet in Vergessenheit – und mit ihm das Selbstvertrauen in die eigene Ermächtigung, mit dem Tod und unseren Toten ganz direkt auf Tuchfühlung zu gehen.
Heute bin ich in der Welt der Schon-Toten und Noch-Nicht-Gegangenen zu Hause und höre von vielen Menschen die Frage: »Darf ich das?« Darf ich meine verstorbenen Angehörigen noch einmal berühren? Darf ich sie zu Hause behalten? Eigentlich absurd, wenn man sich vorstellt, dass man zum Beispiel gerade noch ein Bett mit dieser Person geteilt hat. Es ist, als könnten wir nur den »Todesprofis« vertrauen, also der Medizin, den Behörden, den Bestattungsunternehmen. Wer die institutionellen Wege verlässt, spürt schnell eine Obrigkeitshörigkeit und die eigene Unsicherheit.
Viele wissen beispielsweise nicht, dass es in Deutschland erlaubt ist, eine verstorbene Person bis zu 36 Stunden zu Hause aufzubahren, mit Genehmigung vom Ordnungsamt auch länger. Der Impuls, die Toten sofort aus dem Blickfeld zu schaffen, ist tief verankert – und oft unnötig, solange die äußeren hygienischen und rechtlichen Bedingungen stimmen.