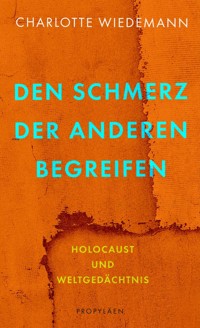
18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein eBooks
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Orientierung und Ermutigung zum Handeln: Wege zu einer neuen Gedenkkultur In einem Moment, in dem hitzige Feuilleton-Debatten den Eindruck erwecken, es ginge um einen kurzlebigen Positionsstreit, stellt Charlotte Wiedemann klar: Was wir erleben, ist eine Zeitenwende – wir müssen unsere Haltung zur deutschen Geschichte aus einer kosmopolitischen Perspektive neu begründen. Das heißt: nicht-europäische, nicht-westliche Sichtweisen ebenso einbeziehen wie die Ansprüche einer jungen, diversen Generation in Deutschland. Wie lässt sich in Zukunft an den Holocaust und an die kolonialen Verbrechen erinnern? Globalhistorisch fundiert und persönlich zugleich denkt Charlotte Wiedemann die Idee des Antifaschismus neu und entwirft ein empathisches Gedenkkonzept für unsere Zeit.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Den Schmerz der Anderen begreifen
Die Autorin
CHARLOTTE WIEDEMANN, geboren 1954, ist Publizistin und Auslandsreporterin. Sie berichtete aus Asien und Afrika und veröffentlichte zahlreiche Bücher; zuletzt erschien Der lange Abschied von der weißen Dominanz (2019). Geprägt vom Schweigen in der eigenen Familie verfolgt sie die Debatten um die Verantwortung für den Nationalsozialismus seit vier Jahrzehnten.
Das Buch
Was steuert unsere Empathie? Und was bedeutet solidarisches Erinnern? Essay, Reisereportage und Selbsterforschung verbindend öffnet Charlotte Wiedemann einen großen zeitgeschichtlichen Bogen – vom Beitrag der Kolonialsoldaten zur Befreiung Europas bis zur neuen Kultur eines geschwisterlichen Antifaschismus nach den rechtsextremen Morden der Gegenwart. Weit ab von den sonst ängstlichen Abwehrreflexen im Diskurs über Holocaust und Kolonialverbrechen entsteht das Panorama einer doppelten Zeitenwende: Die Welt von heute akzeptiert weißes Geschichtsdenken immer weniger. Und im diversen Deutschland entsteht ein vielstimmiges Wir des Erinnerns.»Wir müssen die Shoah im Zentrum unserer Verantwortung halten. Aber wer die Shoah benutzt, um anderes Leid zu degradieren, hat ihre wichtigste Lehre nicht verstanden.«Charlotte Wiedemann
Charlotte Wiedemann
Den Schmerz der Anderen begreifen
Über Erinnerung und Solidarität
Ullstein
Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein.de
Propyläen wurde 1919 durch die Verlegerfamilie Ullstein als Verlag für hochwertige Editionen gegründet. Der Verlagsname geht zurück auf den monumentalen Torbau zum heiligen Bezirk der Athener Akropolis aus dem 5. Jh. v. Chr. Heute steht der Propyläen-Verlag für anspruchsvolle und fundierte Bücher aus Geschichte, Zeitgeschichte, Politik und Kultur.
Propyläen ist ein Verlag der Ullstein Buchverlage GmbH© Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2022© Charlotte WiedemannAlle Rechte vorbehaltenAutorinnenfoto: © Anette DaugardtUmschlaggestaltung: Cornelia Niere, MünchenUmschlagmotiv: ©getty images/Peter Zelei ImagesE-Book powered by pepyrus
ISBN 9783843727549
Emojis werden bereitgestellt von openmoji.org unter der Lizenz CC BY-SA 4.0.
Auf einigen Lesegeräten erzeugt das Öffnen dieses E-Books in der aktuellen Formatversion EPUB3 einen Warnhinweis, der auf ein nicht unterstütztes Dateiformat hinweist und vor Darstellungs- und Systemfehlern warnt. Das Öffnen dieses E-Books stellt demgegenüber auf sämtlichen Lesegeräten keine Gefahr dar und ist unbedenklich. Bitte ignorieren Sie etwaige Warnhinweise und wenden sich bei Fragen vertrauensvoll an unseren Verlag! Wir wünschen viel Lesevergnügen.
Hinweis zu UrheberrechtenSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Die Autorin / Das Buch
Titelseite
Impressum
Vorwort
Unfreie Befreier
Nürnberg und die Grenzen des Universalismus
Algerien und die Geburt der Solidarität
Die Ökonomie der Empathie
Stukenbrock und die Macht des Schweigens
Das Eigene und das jüdische Andere
Ein Grab in Tansania
Schwarze Perspektiven
Treblinka im Sommer
Jüdischer Dissens
Wessen Geschichte?
Assoziationen zur Ukraine
Danksagung und Empfehlungen
Social Media
Vorablesen.de
Cover
Titelseite
Inhalt
Vorwort
Widmung
Gewidmet dem Andenken an Esther Bejarano (1924–2021).Sie dachte mit großem Herzen zusammen, was manche trennen.
Vorwort
Seien wir behutsam.
Seien wir es gerade jetzt, da die Stimmen aus der Vergangenheit zu verwehen scheinen und die Lehren aus der Geschichte überschrieben werden mit Parolen der Härte.
Erinnern bekommt nun neue Bedeutung. Ein Erinnern für eine Zukunft, die Zugehörigkeit in Diversität erlaubt und damit lebendige Gegenrede ist zum Wahn von Homogenität, Nationalismus und Aussonderung.
Ein Erinnern für eine Welt, in der es keine Hierarchie von Leiderfahrung mehr gibt und keinen Schmerz, der nicht zählt. Ein Erinnern also für eine neue Ethik der Beziehungen und einen Antifaschismus des 21. Jahrhunderts.
Dieses Buch ist entstanden aus einem inneren Dialog, aus zwei großen persönlichen Anliegen. Mögen wir als Deutsche, als neue und als alte Deutsche, den Nationalsozialismus dicht bei uns behalten, mit Sensibilität und mit Fürsorglichkeit gegenüber den Opfern. Und mögen wir als Europäer:innen ein weißes Geschichtsdenken überwinden und uns der Auswirkungen kolonialer Gewalt bewusst sein. Mit anderen Worten: die Verantwortung für die NS-Verbrechen im Zentrum halten, aber auf Grundlage eines veränderten Weltverständnisses, orientiert an Respekt und Teilhabe.
Die Opfer des deutschen Kolonialismus werden auf bis zu eine Million geschätzt; dass es für sie kein angemessenes Gedenken, keine Orte des Respekts gibt, lässt sich nicht mit einem Vorrang von Holocaust-Erinnerung entschuldigen. Die Shoah ist eine Tragödie von besonderem Rang, aber ihre Bedeutung darf nicht zur Degradierung anderer Leiden missbraucht werden. Und Deutsche müssen lernen, dass in einer globalisierten Welt aus verschiedenen Perspektiven auf die Vernichtung der Juden und Jüdinnen geblickt wird und auch auf Israel.
Nicht in Hierarchien zu denken, sondern inklusiv und solidarisch, diese Anforderung gilt aber auch im Hinblick auf die nationalsozialistischen Opfer.
Welche stehen uns nahe, etwa weil sie berühmte Literaturen hervorgebracht haben, wie westliche Auschwitz-Überlebende? Welche wurden lange übersehen, wie die dem Hungertod preisgegebenen sowjetischen Kriegsgefangenen, obwohl sie die zweitgrößte Opfergruppe sind? Und warum ähneln Roma, deren Vernichtung als vermeintliche Rasse sie in der NS-Ideologie dem Judenmord am nächsten rückte, in unserer Wahrnehmung eher kolonial-afrikanischen Opfern: entfernt, fremd, nicht sprechfähig?
Der eigene Schmerz wird meist für bedeutsamer gehalten als der Schmerz der Anderen. Aber was kollektiv als das Eigene bestimmt wird, ist Folge gesellschaftlichen Ringens. So werden in den baltischen Staaten die einstigen sowjetischen Deportationen nach Sibirien als national hochbedeutsamer Schmerz behandelt, die Vernichtung der Juden und Jüdinnen hingegen nicht.
Was steuert Empathie – und warum ist sie gegenüber kolonialen Opfern oft so verstörend abwesend? Die Shoah-Erzählung bringt auch in mir Räume zum Schwingen, die mir für koloniale Verbrechen nicht in gleicher Weise zur Verfügung stehen. Ob uns Erregung ergreift, möglicherweise sogar Scham- und Schuldgefühl, ist ein Produkt der Nähe, und das Empfinden von Nähe ist wie Mitgefühl kulturell eingeübt.
Mitgefühl ist nicht gerecht, es folgt nicht dem Grundsatz von der Gleichheit aller Menschen. Den Schmerz der Anderen zu empfinden, mag unmöglich sein, aber ihn zu begreifen und zu respektieren, ist ein realistisches und notwendiges Ziel.
Gemäß der Maßgabe aus Koran und Talmud, dass wer ein Menschenleben rette, die ganze Menschheit rettet, können in der Erinnerungskultur Einzelne durch ihr Handeln zu einem überindividuellen Prozess des Reparierens beitragen. In unterschiedlichen Kontexten fiel mir das Bemühen auf, Opfern posthum etwas von der geraubten Individualität zurückzugeben, indem ihre Namen aufgelistet werden, manchmal Abertausende. Für die Menschen, die über Jahre an solchen Listen arbeiten, ist es ein Werk der Liebe. Und sie nehmen mit den digitalen Methoden des 21. Jahrhunderts eine Dekonstruktion des Massengrabs vor, das zum Symbol der monströsen Modernität des 20. Jahrhunderts wurde.
Bei meinen Annäherungen an Menschen und Geschehnisse ist Berührung ein Leitwort in doppeltem Sinne: Als emotionales und intellektuelles Sich-berühren-Lassen, aber auch als geschichtlich-faktische Berührungen, also Verwobenheiten zwischen unterschiedlichen Kämpfen um Befreiung und Würde. Bereits der Zweite Weltkrieg und die ersten Jahre nach 1945 warfen entscheidende Fragen nach dem Verhältnis von kolonialer Herrschaft, NS-Verbrechen und Universalität auf, die uns in diesen Tagen neu beschäftigen.
Der Weg zur heutigen Gedenkkultur war lang und steinig; sie wurde von Minderheiten erkämpft, gegen die Macht des Verschweigens und Verdrängens, gegen den massiven Täterschutz der ersten Nachkriegsjahrzehnte. Seit seiner Verstaatlichung hat das Erinnern eine Speckschicht der Selbstzufriedenheit angesetzt, ist zur bürgerlichen Sitz- und Besitzkultur geworden. Es sind nun erneut Minderheiten, die um ein neues Erinnern kämpfen, in dem die Erfahrungen und historischen Traumata von Eingewanderten Stimme haben und wo Antifaschismus unter neuen Vorzeichen Handeln und Bedürfnis bedeutet.
Mich selbst haben zwei widersprüchliche Stränge von Bewusstwerdung geprägt. Geboren neun Jahre nach der Befreiung von Auschwitz; die Bestürzung, dies irgendwann zu realisieren. Aufgewachsen mit dem verstockten Schweigen der Eltern – die väterliche NSDAP-Mitgliedschaft inbegriffen – und dem allmählichen Ertasten des Abgrunds unter meinem Deutschsein. Alles, was mit Nationalsozialismus zu tun hat, wurde wie eine zweite Haut. Nichts anderes erreicht, auf Dauer, diese Nähe.
Diesem intensiv empfundenen Deutschsein haben sich dann Jahrzehnte außereuropäischer Welterfahrung eingelagert: als Auslandsreporterin in der muslimischen Welt; durch Aufenthalte in Gesellschaften West- und Ostafrikas, die von der kolonialen Erfahrung gezeichnet sind; durch Recherchen in Ländern, die eigene Traumata zu bewältigen suchen, durch Lebensjahre in Südostasien, wo das Bild des Zweiten Weltkriegs durch die japanische Besatzung geprägt ist. Und durch Freundschaft und Liebe zu Menschen, die von anderswo auf uns blicken. All dies motivierte die Suchbewegungen, entlang derer dieses Buch entstanden ist.
Es mag naheliegend sein, dass mir die europäische Selbstbezogenheit, wie sie nach dem russischen Angriff auf die Ukraine um sich gegriffen hat, fremd bleibt. Die Grenze Europas verlaufe dort, wo die Barbarei beginnt, war nun zu lesen. Eine Denkfigur, die allerdings geradewegs ins Thema führt.
Unfreie Befreier
Über Krieg und Kolonialität
Ein Foto von Schwarzen Soldaten in einem schneebedeckten Schützengraben sah ich zum ersten Mal in einem Lehmgehöft in Mali, umgeben von staubiger Hitze, pickenden Hühnern und der gleichmütigen Klangkulisse heranwehender Küchengeräusche.
Ich habe vergessen, wer mir das Bild damals zeigte, es hatte jedenfalls einen Bezug zur Familie, in deren Gehöft ich mich aufhielt, aber ich erinnere mich mit aller Deutlichkeit, dass es mir in der ebenso festen wie irrigen Annahme präsentiert wurde, ich wisse ja wohl, worum es hier gehe. Afrikanische Soldaten hatten gegen das nationalsozialistische Deutschland gekämpft – ich wusste es nicht. Ich hatte mich mit vergessenen Opfern befasst, mit osteuropäischen Juden und Jüdinnen, die lange von Entschädigungsgesten ausgeschlossen wurden, mit Zwangsarbeiter:innen, die um ihre Ansprüche kämpften. Dass es neben diesen willentlich vergessenen Opfern auch vergessene Befreier gab, erschien an diesem heißen westafrikanischen Nachmittag erstmals am Horizont meines Bewusstseins, und mich beschäftigte bald die Frage, inwiefern es sich hier gleichfalls um ein willentliches Vergessen handelte.
Wissen braucht manchmal einen langen Weg, um zu uns zu finden, und im Nachhinein fragt man sich, wie das geschehen konnte, dieses Übersehen von großen, sehr großen Dingen, direkt unter unserer Nase.
Wir Deutschen glauben gern, alles über den Zweiten Weltkrieg zu wissen, befanden wir uns doch in seinem Zentrum; unser Krieg. Womöglich verstellt genau das den Blick: unser Selbstbild, in diesem Geschehen zentral zu sein und – jenseits des unbezweifelbaren Faktums der Täterschaft im Angriffskrieg – auch die Autorität der Perspektive innezuhaben, der Deutung. Welche Perspektive mochten die beiden Männer gehabt haben, die mich auf dem Foto anblickten, ihre dunklen jungen Gesichter unterm Helm in irritierendem, bestürzendem Kontrast zur weißen Eiseskälte, die sie umgab? Niemand kann für sie antworten, aber wenn wir die Frage im Sinn behalten, kann sie helfen, ein politisches und menschliches Panorama größerer Komplexität zu erahnen.
Der Zweite Weltkrieg war im Wortsinn ein globales Ereignis, er riss vom Maghreb bis nach Polynesien viele Millionen Menschen in sein Geschehen hinein, und dieser Teil der Welt bezahlte dafür mit einem bis heute kaum anerkannten und wenig gesehenen Leid. Beim Kampf um Manila, Hauptstadt der Philippinen, starben viel mehr Menschen als bei der Bombardierung Dresdens. In Indonesien fand vermutlich eine Million Zwangsarbeiter:innen unter der japanischen Besatzung den Tod. China hatte geschätzte 21 Millionen Opfer zu beklagen, und auf den Salomon-Inseln heißt diese Ära bis heute The Big Death.
Dass ein Leid solchen Ausmaßes aus europäischer Warte übersehen wurde, lässt sich nicht allein damit erklären, dass sich unserem Empathievermögen rassistische Strukturen eingeschrieben haben, ob bewusst oder unbewusst. Vielmehr wird ausgeblendet, wie gewaltig der Kolonialismus jene Epoche noch geprägt hat. Doch so wenig sich die Shoah vom Vernichtungskrieg im Osten trennen lässt, so wenig lässt sich der Krieg gegen das nationalsozialistische Deutschland von der Kolonialität der Zeit trennen.
Als der Zweite Weltkrieg begann, umfasste das britische Empire ein Viertel der Welt, und Frankreichs Kolonialgebiete waren zwanzigmal größer als sein nationales Territorium. Die Armeen beider Mächte stützten sich entscheidend auf das Reservoir der Kolonisierten. Auf britischer Seite entstammte jeder zweite Soldat den Kolonien, insgesamt waren es fünf Millionen Menschen. Unter französischem Kommando kämpfte eine Million Afrikaner.
Das Bild, das mir an jenem heißen Nachmittag in Mali gezeigt wurde, bezeugte die Implikation meiner Gastfamilie in ein Geschehen, von dem sie und ich ein Teil waren, wenngleich in einem weitläufigen Sinne. Ein entfernter Verwandter, längst gestorben, hatte an einem Krieg teilgenommen, der sich gegen meinen Quasi-Verwandten Hitler, gleichfalls längst gestorben, richtete. Mir das Bild zu zeigen, war mitnichten Anklage, vielmehr ein Zeichen von Verbundenheit. Ich brauchte eine Weile, Monate, vielleicht Jahre, um die emotionale Großzügigkeit dieser Geste wirklich zu begreifen und zu verstehen, welche Art von Verwandtsein mir an jenem Nachmittag angeboten wurde.
Millionen von Menschen aus Europas Kolonien trugen zum Sieg über den Nationalsozialismus bei; viele von ihnen ließen dafür ihr Leben. Für unsere Freiheit kämpften, ohne selbst frei zu sein, gleichfalls Hunderttausende Schwarze Amerikaner. Gleichwohl sehen wir auf den geläufigen Darstellungen vom Kriegsende in der Regel nur Weiße, als hätten nur sie zum Ende nationalsozialistischer Herrschaft beigetragen.
In Dakar, der Hauptstadt des Senegal, erinnert an prominentester Stelle, nämlich auf dem Platz der Unabhängigkeit, eine große Inschrift an die Gefallenen. »Unseren Toten die Dankbarkeit des Vaterlandes.« Hier werden die Kolonialsoldaten sogar mit der Souveränität der Nation in Verbindung gebracht: Die Mauer mit der Inschrift ersetzt das auf solchen Plätzen anderswo übliche Denkmal der Unabhängigkeit.
Allerdings trägt der Gedenkort durchaus eine doppelte Botschaft: Er verweist im Allgemeinen auf die Kluft zwischen weißer und Schwarzer Erinnerung, aber markiert im Besonderen auch die Existenz unterschiedlicher Erinnerungspolitiken innerhalb afrikanischer Gesellschaften. Die Inschrift in Dakar trägt die Handschrift von Léopold Sédar Senghor, des ersten Präsidenten des Senegal nach der Unabhängigkeit. Er suchte die Nähe zu Europa, erhoffte sich Anerkennung durch Nähe, eine damals wie heute gleichermaßen umstrittene Position. Von einem afrikanischen Gedächtnis zu sprechen, meint also nichts Statisches, Einheitliches; auch hier gibt es Erinnerungskonflikte, generationelle Unterschiede und Machtpolitik durch Gedenken.
Für das Nachdenken über die Verwobenheiten von Nationalsozialismus, Kolonialität und Vorstellungen von Freiheit sind die afrikanischen Soldaten im Dienste Frankreichs von besonderem Interesse. Denn ohne sie hätte sich Frankreich kaum zu den Siegermächten des Zweiten Weltkriegs zählen können.
1939, nach Deutschlands Überfall auf Polen, rekrutierten die französischen Kolonialbehörden in größter Eile in Nord-, West- und Zentralafrika kriegstüchtige Männer; ähnlich wie bereits im Ersten Weltkrieg bedienten sie sich dabei einer Mischung aus Zwang und vagen Verheißungen. Zu Letzteren gehörte die Redensart, Hitler betrachte Afrikaner als Affen und sie könnten durch den Kampf gegen ihn ihr Menschsein unter Beweis stellen. Alsdann wurden Rekruten in einer heute unvorstellbar großen Zahl nach Europa geschafft – unvorstellbar deswegen, weil wir heute daran gewöhnt sind, dass vergleichsweise wenige Menschen mit großem Aufwand daran gehindert werden, von der afrikanischen Küste aus die europäische zu erreichen.
Als die Wehrmacht in Nordfrankreich einfiel, machten Afrikaner bereits einen beträchtlichen Teil der französischen Armee aus; die Infanterie bestand zu fast vierzig Prozent aus Maghrebinern. Oft als Fußtruppen an vorderster Front eingesetzt, erlitten Afrikaner die schlimmsten Verluste; etwa hunderttausend starben bereits in der ersten Phase des Kriegs, und neunzigtausend gerieten in deutsche Gefangenschaft, als die französische Armee im Juni 1940 kapitulierte.
Nach Augenzeugenberichten weißer Franzosen trieb die Wehrmacht häufig die Kriegsgefangenen gleich nach der Entwaffnung in zwei Gruppen auseinander, je nach Hautfarbe. Viele Kolonialsoldaten wurden an Ort und Stelle mit MG-Salven niedergemäht, weitere Zehntausende starben durch Misshandlungen, verdursteten oder verhungerten. In der deutschen Geschichtsschreibung hielt sich lange der Mythos von einem sauberen Westfeldzug: Anders als beim Vernichtungskrieg in der Sowjetunion habe die Wehrmacht bei der Eroberung von Belgien, Holland und Frankreich die Regeln des Kriegsvölkerrechts weitgehend berücksichtigt. Die Forschung blendete dabei allerdings den Umgang mit Soldaten nichteuropäischer Herkunft aus. Mittlerweile sind die Verbrechen der Wehrmacht an Schwarzen Kriegsgefangenen gut dokumentiert, ohne dass dies jedoch Niederschlag im allgemeinen Bewusstsein gefunden hätte.
Einige Afrikaner, denen es gelang, vor den Deutschen zu fliehen, stellten sich bewaffnet in die Reihen der Résistance. Im Detail überliefert ist die Geschichte des Guineers Mamadou Hady Bah, der unter dem Namen Addi Bâ in den Vogesen eine lokale Legende wurde. Der Sohn eines Hirten aus dem Volk der Peulh, Absolvent einer traditionellen Koranschule, kam in den 1930er-Jahren nach Frankreich, um eine Lehre zu machen. Bei Kriegsbeginn meldete er sich freiwillig an die Front, schloss sich später einer Partisanengruppe in den Wäldern von Vittel an. Addi Bâ, sehr klein von Gestalt, trug stets weiter seine Uniform, so kannte man ihn in den Dörfern. Bei einer französischen Familie, in deren Anwesen er gelegentlich Zuflucht fand, hinterließ er seinen einzigen privaten Besitz, als er von der Wehrmacht gefasst wurde: Es war ein Koran, rot eingebunden, zerlesen.
Der Enkel des Hauses fand später das geheimnisvolle Buch. Als er erwachsen war, erforschte er das Leben des Partisanen, und der Koran wurde feierlich nach Guinea zurückgebracht. Nein, das ist kein Märchen. Addi Bâ aber wurde vom Schnellgericht einer Feldkommandantur zum Tode verurteilt und am nächsten Morgen erschossen. Das war 1943, der fromme Held war gerade 27 Jahre alt.
Im selben Jahr rekrutierte General Charles de Gaulle in Nord- und Westafrika weitere Soldaten für die Truppen des Freien Frankreichs. Als die Alliierten im August 1944 an der südfranzösischen Küste landeten – das Gegenstück zur bekannteren Invasion in der Normandie –, waren auf französischer Seite einhundertzwanzigtausend afrikanische Soldaten beteiligt, aus Mali und dem Senegal, aus Algerien, Tunesien, Marokko. Es war diese sogenannte »Armée d’Afrique«, die den Franzosen später das historische Gefühl vermittelte, sich im Zweiten Weltkrieg selbst befreit zu haben. Die Befreier waren, das sei nebenbei bemerkt, ganz überwiegend Muslime.
Womöglich können wir erst heute nachvollziehen, wie innerlich zerrissen viele Afrikaner waren, als sie an der Seite einer noch tief im Rassismus befangenen Kolonialmacht ihr Leben gegen Nazi-Deutschland riskierten. Rassistische Demütigungen waren alltägliche Praxis, ob unter französischem oder unter britischem Kommando, wo zum Beispiel die Uniformen der »King’s African Rifles« keine Hosenschlitze hatten; die Männer mussten beim Urinieren stets die Hosen herunterlassen. Bei den französischen Streitkräften erfuhren die Kolonialsoldaten ihre Geringschätzung nicht allein durch minderwertige Ausstattung und schlechteres Essen, sondern sie wurden je nach Hauttönung und Herkunft verschiedenen Kasten zugeordnet. Eine Erfahrung, die bei Frantz Fanon, der später als Psychiater, Algerienkämpfer und antikolonialer Denker bekannt wurde, einen Urfunken der Empörung entfachte.
Fanon hatte sich als 17-Jähriger auf Martinique freiwillig gemeldet; er schiffte sich 1942 ein, hochmotiviert von der noblen Aussicht, mit dem Freien Frankreich gegen den Faschismus zu kämpfen. Schon in Marokko erlebte er, wie der Rassismus die Kombattanten des Fortschritts unterteilte. Schwarze afrikanische Soldaten trugen ein dem Fez ähnliches rotes Käppi statt der Feldmütze und mussten in Zelten schlafen, während hellerhäutige Soldaten von den Antillen (wie er selbst) ins Quartier der Franzosen durften.
Später schrieb Fanon zutiefst desillusioniert an seine Mutter: »Ich habe mich geirrt.« Er sei einem Ideal von Freiheit gefolgt, aber »nichts« rechtfertige, sich zum Verteidiger der Interessen des Kolonialherrn zu machen. Wenn er fallen würde, beschwor er die Mutter, »sag niemals: Er ist für die gute Sache gestorben«.1
Das war die Gegenposition zu Léopold Sédar Senghor, der die Verbundenheit mit Frankreich, mit Europa später zum Gründungsmythos des unabhängigen Senegals machte. Senghor verbrachte zwanzig Monate in deutscher Kriegsgefangenschaft und berichtete in seinen Schriften darüber fast nur Gutes. Angst, Scham und Qual schrieb er sich in den »Schwarzen Hostien« von der Seele, seinen Gedichten aus den Kriegsjahren. Die Wahrheit des Dichters war eine andere als die des Staatsmanns.
Es gibt noch einen weiteren Zugang zur existenziellen Erfahrung von Rassismus in diesem Krieg, nämlich die ethisch-universelle Betrachtung von Nachgeborenen. Der Spielfilm Indigènes (deutsch: Tage des Ruhms) des Regisseurs Rachid Bouchareb erzählt davon in beeindruckender Weise. Bouchareb wurde 1953 in Paris als Kind algerischer Eltern geboren. Sein Protagonist, der Obergefreite Abdelkader, ist ein algerischer Berber, gebildet und ehrgeizig kämpft er um soldatischen Ruhm in einer Armee, die für seinesgleichen keinen Ruhm vorgesehen hat. Vom Gemetzel am Monte Cassino bis in die winterkalten Vogesen zieht sich die Spur seiner gefallenen maghrebinischen Kameraden. Abdelkader wird zum einzigen Überlebenden seiner Einheit; die letzten Gefährten sterben, als sie ein winziges Dorf in den Vogesen gegen die Deutschen halten, bis Nachschub kommt.
Abdelkader muss dann zusehen, wie weiße französische Soldaten mit den Dorfbewohnern für die Fotos der Kriegsberichterstatter posieren, als »Befreier der Vogesen«.
Gerade weil die Armee den Kolonialsoldaten Anerkennung und Ruhm verweigert, ringt Abdelkader mit der Schuld, die er auf sich geladen hat. Als seine Kameraden zweifelten und nur noch nach Hause wollten, trieb er sie mit seinem Ehrgeiz und seinem illusionären Glauben an Frankreich voran in den todbringenden Einsatz. Unschuldig schuldig werden, das klassische Thema so vieler großer Kriegsepen mit weißen Protagonisten, kommt hier mit Wucht aus einer anderen Weltperspektive zurück.
Wie im Bergdorf der Vogesen, so war es auf der großen Bühne: Der Sieg sollte weiß sein. Als die Truppen des Freien Frankreichs durch den Triumphbogen in Paris marschierten, waren keine Afrikaner dabei. Sie waren vorher in Durchgangslager geschickt worden, um dort auf ihren Rücktransport in die Heimat zu warten. Auf dem Marsch Richtung Paris hatte de Gaulle den Befehl zum Blanchissement der Truppen gegeben; das Wetter in der Hauptstadt sei Afrikanern nicht bekömmlich.
Frankreich hatte seine Souveränität mithilfe der Kolonisierten wiedergewonnen, doch galt es diesen Umstand vor den Augen der Nation soweit möglich zu verbergen. Die Franzosen und Französinnen sollten sich an der Seite der Alliierten als Sieger der Geschichte fühlen, ungeachtet der beschämenden Kapitulation vor der Wehrmacht. Für diesen Stolz musste, was immer auch geschehen war, das Ergebnis weiß sein.
Es hat Jahrzehnte gedauert, bis die Mauer des Selbstbetrugs bröckelte. Sechzig Jahre nach der Landung in der Provence standen auf der Liste der Ehrengäste, die zur Feier geladen wurden, erstmals Repräsentanten der afrikanischen Kriegsbeteiligten: sechzehn Staatschefs, eine Zahl, die noch einmal auf die enorme geografische Ausdehnung der Rekrutierung verweist.
In der Stadt Bandol an der Côte d’Azur trägt der von Palmen gesäumte Platz vor dem Rathaus neuerdings den Namen »Platz der afrikanischen Befreier«; eine Tafel nennt die Namen von fünf Algeriern, die im Kampf gegen die deutsche Besatzung für Bandol ihr Leben ließen. Frankreichs Kommunen werden von der Regierung nun zu solchen Ehrungen ermuntert, Namenslisten von Gefallenen werden bereitgehalten, und die Schulen der Stadt sollen sich mit ihrem Schicksal befassen. Eine Geste der Aussöhnung, wenngleich im Rahmen eines patriotischen Narrativs: als seien all jene, die später fielen, der Grande Nation freiwillig zur Seite geeilt, aus Respekt und Liebe für das sogenannte Mutterland.
Im Winter 1944, vier Monate, nachdem die afrikanischen Helden der Provence das Ansehen Frankreichs gerettet hatten, trug sich etwas zu, das für die Intellektuellen des Kontinents bis heute den großen Betrug an den Veteranen symbolisiert: das Massaker von Thiaroye. In ein Lager dieses Namens nahe Dakar wurden im Dezember 1944 mehr als tausend westafrikanische Kriegsheimkehrer eingewiesen; sie warteten auf ausstehenden Sold und versprochene Prämien. Weil sie von den französischen Offizieren am Ort immer wieder hingehalten wurden, begehrten die Kolonialsoldaten schließlich auf und erzwangen Verhandlungen. Bei Nacht, als sie ihren vermeintlichen Erfolg feierten, umstellten Panzer das Lager, und die Franzosen richteten unter ihren Waffenbrüdern von gestern ein Blutbad an, mit Hunderten von Toten. Niemand wurde dafür je zur Rechenschaft gezogen.
Als ich Thiaroye besuchte, war der Ort von der wuchernden Metropole Dakar nahezu eingeholt worden. Eine gesichtslose Vorstadt am Meer, wo junge Männer und manchmal Frauen in schüttere Pirogen steigen, in der Hoffnung, damit Europas Küsten zu erreichen. Gibt es eine schmerzlichere Vorstellung als diese: dass die Enkel der Befreier nicht einmal aus Seenot gerettet werden, wenn ihre Boote kentern?
Der Opfer der Geschehnisse von 1944 wird nicht in Thiaroye gedacht, sondern tausend Kilometer weiter östlich, in Malis Hauptstadt Bamako. In der Nähe des Zentralmarkts steht dort ein Mahnmal, das in den 1990er-Jahren von Malis erster demokratischer Regierung errichtet wurde, in einer Zeit des geistigen Aufbruchs, die in der Stadt diverse Zeugnisse einer selbstbewussten, panafrikanisch motivierten Gedenkkultur hinterließ. Die Skulptur für Thiaroye zeigt eine Säule mit den Halbreliefs gefangener und sterbender Soldaten, auf die sich von allen Seiten die Rohre der Geschütze richten.
Nur wenige Schritte entfernt steht in einem Palmenhain ein französisches Kolonialdenkmal von 1924, eine Soldatengruppe aus geschwärzter Bronze in geduckter Angriffshaltung. Sie erinnert an die Gefallenen des Ersten Weltkriegs, auf dem Sockel sind die Namen der Schlachtfelder eingraviert: Marne, Reims, Verdun, Chemin des Dames. Auf der Rückseite die Widmung: »In Anerkennung den Adoptivkindern Frankreichs, gestorben im Kampf für Freiheit und Zivilisation.« Trotz dieser Anrede, die natürlich als Verhöhnung empfunden wird, hat das moderne Mali das Kolonialdenkmal nicht entfernt, es vielmehr um die Erinnerung an das Massaker von Thiaroye ergänzt. Zwei Denkmäler stehen nun in einem stummen Dialog.
Das Beispiel illustriert, dass man über afrikanische Erinnerungskulturen besser nur im Plural spricht, sind sie doch – wie sollte es anders sein – stets mit zeitgenössischen Positionierungen verbunden. Senegal scheut davor zurück, Frankreich zu provozieren; Mali ist da freimütiger. Aber auch dort ist es eher verpönt, Denkmäler aus der Vergangenheit abzureißen.
In vielen der größeren Städte Westafrikas steht bis heute ein Maison des Anciens Combattants, ein Veteranen-Clubhaus der schlichtesten Art, mit klapprigen Stühlen, durchgesessenen Sofas, vor den Fenstern als Sonnenschutz die guten alten Eisenlamellen, sie zaubern Lichtstreifen in den Raum, als solle hier gleich ein Vintage-Film gedreht werden. Früher trafen sich in diesen Clubs betagte Kriegsbeteiligte und verabredeten ihre Kämpfe für eine Gleichbehandlung bei den Kriegsrenten. Später wurden daraus Orte, an denen gewerkschaftliche Anliegen verhandelt werden. Bis heute sind die Anciens Combattants Namensbestandteil mancher Verteidigungsministerien: Die Kolonialsoldaten werden an der Seite der souveränen nationalen Armeen respektiert.
Ungeachtet einer langen Missachtung durch europäische Geschichtsschreibung entwickelten die Veteranen eine Kultur der Selbstanerkennung – Ancien Combattant zu sein, wurde eine Identität. Sie gründete im Bewusstsein, Teil eines großen historischen Geschehens gewesen zu sein, auch wenn die Teilnahme oft nicht freiwillig war. Die Kultur der Selbstanerkennung fruchtete vor allem dort, wo sie sich mit den fortschrittlichen Kämpfen der Zeit verbinden konnte. So wurde der erste Streik für gleiche Entlohnung von Schwarzen und Weißen in Westafrika im subjektiven Erleben auf die Kriegserfahrung zurückgeführt. Im Oktober 1947 traten die einheimischen Eisenbahner an der Linie Dakar-Koulikoro in einen Ausstand, der die kolonialwirtschaftlich wichtige Verbindung zwischen Atlantik und Niger lahmlegte. Weiße französische Bahnbeschäftigte verdienten damals ungleich viel mehr als ihre Schwarzen Kollegen. Die Streikenden und ihre Familien hielten fünf Monate durch, fünf harte Monate ohne Lohn, in denen die Frauen das Überleben durch solidarische Strukturen organisierten.
Einen der Protagonisten lernte ich kennen, als er bereits über achtzigjährig war, ein ehemaliger Heizer auf einer Dampflokomotive. Es handelte sich um den Vater meines damaligen malischen Lebensgefährten, eine beeindruckende Gestalt, in der sich afrikanisches Patriarchentum mit einem wachen politischen Kampfgeist verband. Père, wie ich ihn nannte, denn solche Gestalten redet man nicht mit Vornamen an, war selbst kein Soldat gewesen, aufgrund seiner Funktion war er der Zwangsrekrutierung entgangen; dennoch hatte die Kriegserfahrung sein Bewusstsein geprägt. »Wir hatten alle begriffen, welchen Beitrag die Afrikaner zur Verteidigung Frankreichs geleistet hatten«, erklärte er mir. »Und weil wir das begriffen hatten, verlangten wir Respekt und gleichen Lohn.«





























