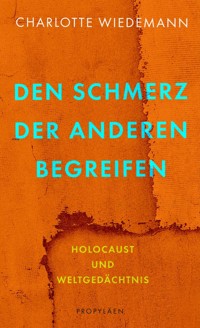6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Globalisierung und Migration: Die Zukunft ist nicht weiß Was bedeutet Deutsch-Sein, was Europäer-Sein in einer Zeit, da die Weltordnung immer weniger vom Westen und von einer weißen Minderheit bestimmt wird? Die Herausforderungen der Einwanderungsgesellschaft und die weltweiten Veränderungen haben ein gemeinsames Gesicht: Europa muss einen Statusverlust verkraften. Das Ende weißer Dominanz bedeutet: Der Westen kann anderen seine Definitionen von Fortschritt, Entwicklung oder Feminismus nicht länger aufdrängen. Dem Leben in Pluralität muss ein Denken in Pluralität folgen. Von den Ängsten, die in dieser Umbruchphase entstehen, profitieren die Rechten. Doch uns zu verändern, wird befreiend sein. Wir stehen an einer Zeitenwende. Dieses Buch ermuntert dazu, uns in der Welt neu zu verorten. Ein sehr persönliches Plädoyer gegen Angst und Abschottung der weitgereisten Journalistin. Charlotte Wiedemann ist sich gewiss: Uns zu verändern, wird befreiend sein.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 281
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Über das Buch
Die Welt von morgen wird nicht mehr von jener weißen Minderheit geprägt, die über Jahrhunderte den Ton angab. Als alteingesessene Deutsche und Europäer verlieren wir einen Status, der uns selbstverständlich erschien. Schon heute lassen sich andere unsere Definitionen von Fortschritt, Entwicklung oder Feminismus nicht länger aufdrängen. Kann es uns gelingen, von der weißen Dominanz konstruktiv Abschied zu nehmen?
Charlotte Wiedemann, weitgereiste Journalistin, bindet Heimat und Welt zusammen. Inmitten von Globalisierung und Einwanderung sucht sie nach Koordinaten, wie wir uns geistig und seelisch neu verorten können. Ein sehr persönliches Plädoyer gegen Angst und Abschottung: Uns zu verändern, wird befreiend sein.
Vorwort
Als ich vor dem Schädel stand, es war ein Totenschädel aus Namibia, von frischen weißen Lilien umrahmt für eine würdige Heimreise, sah ich die Nummer. Der Schädel hatte eine Inventarnummer auf der Stirn, eine bläuliche Ziffernfolge, Zeichen der Ordnung auf den einstigen Regalen des deutschen Kolonialismus.
Ich muss nicht erklären, wie mich eine Nummer auf einem Menschen berührt.
Aber da ist noch etwas anderes, und das möchte ich mitteilen: Welche Chancen sich auftun in einem solchen Moment. Die Chance zu verstehen, zu begreifen, uns neu zu betrachten und uns nach Möglichkeit zu befreien von dem, was wir waren und in einem gewissen Maße immer noch sind.
Dies kann nur ein langer Abschied sein. Von einer Prägung, die über Jahrhunderte entstand, kann sich niemand leichthin lösen.
Abschied also. Das Wort setzt voraus, dass es Abschiednehmende gibt, Handelnde. Andernfalls wäre nur von der Vertreibung aus der weißen Dominanz zu reden, ein Prozess, der ohnehin im Gange ist. Ich möchte zu einem tätigen, reflektierten Abschiednehmen ermuntern und zum Annehmen von Neuem, ohne Furcht.
Weiß ist mehr als eine Hautfarbe, es handelt sich um eine soziale Position, um Haltungen und Deutungsmuster. Weiße Dominanz zeigt sich im Verbrauch von Ressourcen, in Wirtschaftsmacht und Finanzströmen, in der Deutung von Konflikten, in der Geschichtsschreibung. Auf all diesen Feldern bricht ein neues Zeitalter an. Der Westen bestimmt nicht mehr die Ordnung der Welt, und wir können anderen unsere Definitionen von Fortschritt, Entwicklung oder Feminismus nicht länger aufzwingen.
In diesem Buch wird das Innere und das Äußere, Heimat und Welt, zusammen gedacht. Was wir gegenwärtig als turbulente Entpuppung einer Einwanderungsgesellschaft erleben, steht in Zusammenhang mit größeren Fragen, die unser Weltbild und unser Bild von uns selbst betreffen. Wer wir sind und wie wir das »Wir« bestimmen, das lässt sich nicht mehr allein in den Grenzen des Nationalstaats beantworten. Die Vorstellungen vom Eigenen und vom Fremden sind gleichermaßen Phantasien über unseren Platz auf dieser Erde, ob bewusst oder unbewusst.
Weiße Europäer und Europäerinnen müssen heute einen historischen Abstieg verkraften, und sie werden das hoffentlich tun, ohne in Faschismus zu verfallen. Aber man muss die Angst vor diesem Machtverlust berücksichtigen, um zu verstehen, warum Migration und kulturelle oder religiöse Verschiedenheiten immer schwerer akzeptiert werden.
Die alteingesessenen Deutschen entscheiden nicht mehr allein, worüber das Land spricht. Es entsteht eine neue migrantische Elite und erstmals seit 1945 wieder eine kosmopolitische Intelligenzija, zu der Muslime ebenso gehören wie eingewanderte Juden der jüngeren Generation.
Wer diese Vielfalt zurückdrehen will, redet Bürgerkrieg das Wort. Aber Vielfalt ist nicht einfach zu leben; sie darf auch als Zumutung empfunden werden. Entscheidend ist letztlich nicht Herkunft, sondern Haltung. Niemand muss Rassist sein, und niemand ist dagegen bereits durch eine nicht-weiße Hautfarbe gefeit.
In einer sich rasant wandelnden globalen Landschaft ist nur eines gewiss: Wir im alten Europa werden teilen müssen. Nur durch Teilen können wir einen Wohlstand aufrechterhalten, der sich nicht allein materiell definiert, sondern durch die weitgehende Abwesenheit von Gewalt im alltäglichen Leben. Die Alternative wäre ein Europa als gated community, an deren Grenzen scharf geschossen wird und in deren Innerem wir uns selber hassen.
Wie meine früheren Bücher hat auch dieses eine persönliche Note. Ich reflektiere die Veränderungen Deutschlands in der Spanne meines eigenen Lebens, seit den Fünfzigerjahren, und ich blicke auf Europas Ängste und seine Einmauerung im Licht meiner Erfahrungen in Gesellschaften Asiens und Afrikas. Und ich sehe mit Hoffnung, wie aus einer veränderten Betrachtung von Shoah und Kolonialverbrechen eine neue Ethik des Respekts entsteht, ein Humanismus für eine Welt, deren Zukunft nicht weiß ist.
Aus all dem ist ein Mosaik von Gedanken, Erinnerungen, Begegnungen geworden. Die kurze Form der Texte lädt ein zum Innehalten und zum vernetzten Lesen – und auch dazu, dem einen zuzustimmen und dem anderen nicht. Nur so kann Gesellschaft heute funktionieren. Wir müssen Unverständnis, Nicht-Verstehen-Können aushalten.
Das »Wir« in diesem Buch meint übrigens nicht immer haargenau dieselben. Es gibt eben kein Zurück in die gemütlichen Eindeutigkeiten.
1Wie wir waren. Wie wir sein werden
Über das eigene Land zu schreiben, das ist heute anders als früher.
Es hat mich viel in die Ferne gezogen in den vergangenen zwei Jahrzehnten, und über die Ferne schreiben bedeutet: nichts voraussetzen können. Über das Eigene schreiben, das hieß früher: Da ist ein Rahmen, in dem du dich bewegst, ebenso wie jene, an die du dich wendest. Aber so ist das nicht mehr. Nichts kann vorausgesetzt werden.
Wir genießen gegenwärtig das Privileg, auf vieles neu blicken zu können. Dies sind Zeiten des Umbruchs, sie statten uns mit Hellsicht aus, sofern wir es zulassen. Hellsicht entsteht, wenn wir um Ecken blicken und in Winkel spähen, die einer starren Blickachse früher verborgen blieben.
Womöglich können wir jetzt sogar Vergangenheiten, besonders die deutschen, neu zusammensetzen, ohne davon erschlagen zu werden. Wer einmal beginnt, auf Altes neu zu blicken, gerät leicht in einen Sog.
#Kindheit 1960
Vor mir liegt eine Fotografie in Schwarz-Weiß. Wir waren sechsundfünfzig in der ersten Klasse; Volksschule, so hieß das damals, 1960.
Wenn ich das Bild betrachte, wie es von uns aufgenommen wurde, alle ordentlich aufgereiht zu einem kleinen Regiment, dann wundert es mich, dass Deutschland (in meinem Fall Westdeutschland) wirklich einmal so war – so homogen. Wir hießen Erika, Hildegard, Sigrid, Peter, Norbert, Eberhard. Haarfarbe meist zwischen blond und hellbraun. Die Familiennamen alle langheimisch deutsch, nicht einmal etwas polnisch Klingendes darunter, das mag in einer Großstadt des Rhein-Ruhr-Gebiets ein Zufall gewesen sein.
Es ist fast überflüssig zu erwähnen, dass wir alle der herrschenden Norm von Gesundheit und altersgerechter Entwicklung entsprachen; Kinder mit einer Einschränkung waren vorher aussortiert worden. Inklusion, die Idee war noch nicht geboren.
Und doch gab es eine Differenz, nicht innerhalb unserer Kinderschar, sondern nach außen: Dies war eine katholische Volksschule. Die evangelische war nebenan, von uns durch einen Zaun getrennt, der auch den Pausenhof durchzog. Nicht einmal im Spiel sollten wir uns mischen. Und ich erinnere mich, wie wir manchmal an diesem Zaun standen und »Effkes! Effkes!« hinüberriefen, in der Lautmalerei der örtlichen Mundart eine Kombination von Äffchen und Evangele. Obwohl meine Eltern kaum religiös waren und ganz gewiss nicht militant katholisch, erschien es mir natürlich, die Kinder auf der anderen Seite des Zauns mit diesem Ausdruck zu bewerfen, mit kindlicher Lust an einem höhnischen und ulkigen Wort. Denn wir, die Katholiken, waren die Mehrheit; nicht, dass ich das rational gewusst hätte. Aber ich kannte kein einziges evangelisches Kind.
Sie waren »die anderen«, würde man heute sagen.
Auch dies ist im Rückblick schwer vorstellbar: Die Unterschiede zwischen den christlichen Bekenntnissen wurden vor gut einem halben Jahrhundert noch für so gewaltig gehalten, dass Sechsjährige nicht auf einer gemeinsamen Schulbank sitzen sollten. Konfessionslos waren im deutschen Westen jener Zeit die allerwenigsten; auch dies mutet uns heute befremdlich an, da ihr Anteil einer Vierzig-Prozent-Marke entgegeneilt.
Immerhin saßen in meiner Klasse bereits die Norberts und Eberhards, durch einen halben Meter Mittelgang von den Hildegards und Erikas auf Abstand gehalten. Die Geschlechtertrennung war aufgehoben, eine formidable Neuerung in jenen Jahren.
Für die Erziehung in einem ethnisch weitgehend homogenen Nachkriegsdeutschland waren Konfession und Geschlecht die beiden großen Merkmale der Unterscheidung. Wir können daraus lernen, wie zeitgebunden das ist, was wir als trennend empfinden. Und wie sich damit auch das Verständnis dessen ändert, was wir das Eigene nennen.
Wenn wir die Dinge im gewöhnlichen Tempo des eigenen kleinen Lebens betrachten, im schleppenden Takt zurückgelegter Schulwege und abgeleisteter Arbeitsstunden, dann bleibt uns die Geschichtlichkeit dessen, was gerade passiert, in der Regel verborgen. Nur gelegentlich vermögen wir wie ein Vogel hinab auf die Landschaft unserer Lebenszeit zu sehen, der Blick ausnahmsweise nicht getrübt vom Dunst subjektiven Erlebens.
Als ich zur Welt kam, lag es erst neun Jahre zurück, dass Auschwitz befreit worden war. Die schlichte Erkenntnis traf mich irgendwann wie ein Schlag. Obwohl mich bereits als Heranwachsende beschäftigt hatte, was aus dem Holocaust folgte (oder was ihm nicht folgen durfte), erreichte mich erst sehr viel später ein Gefühl dafür, wie kurz die Spanne war zwischen dem Ende des Nationalsozialismus und dem Beginn des eigenen Daseins.
Aus eben dieser Vogelperspektive betrachtet, wurden während meiner Kindheit und Jugend, die ich in einem Kosmos von Homogenität verbrachte, die Fundamente der deutschen Einwanderungsgesellschaft gelegt. 1955, kurz nach meiner Geburt, das erste Anwerbeabkommen. Als ich in der vierten Klasse saß, 1964, bekam der millionste Gastarbeiter seinen Blumenstrauß. Als ich 1973 Abitur machte und ein Anwerbestopp verhängt wurde, hatten vierzehn Millionen Migranten kürzer oder länger in Westdeutschland gearbeitet. Welch eine Zahl!
Konnte es verwundern, dass ein Teil von ihnen blieb und Ehepartner und Kinder nachholte?
Während meiner Schulzeit wurde also der Boden bereitet für die heutige Vielfalt, mit einem Heer arbeitsamer Männer und Frauen, die Westdeutschland brauchte für sein Wirtschaftswunder.
In der homogenen Welt von uns Kindern mit den hellbraunen Haaren war die entstehende Vielfalt nicht sichtbar und nicht fühlbar, denn die Gastarbeiter und -arbeiterinnen kamen ohne Kinder, hatten sie schweren Herzens bei anatolischen und apulischen Großeltern zurückgelassen.
Meine Generation, das sind die geburtenstarken Jahrgänge – 1954 kam außer mir noch eine Million Kinder mit bevorzugt hellbraunen Haaren zur Welt. Wir sind die vielen, die vielen jetzt Alternden und auch die vielen Verdränger, die erst spät und manchmal widerwillig begreifen, wie sich das Land geändert hat und dass diese Veränderung in unserer Jugend begann, zu unserem Nutzen.
In der politischen Landschaft des heraufziehenden Kalten Krieges waren wir, weiß und westdeutsch, gleich mehrfach privilegiert. Unsere Eltern waren nicht gezwungen, Arbeit anderswo zu suchen. Wir wurden weitgehend verschont von Reparationsforderungen und kaum behelligt von dem Grauen, das die Generation unserer Eltern und Großeltern angerichtet hatte.
Privilegiert zu sein durch die Umstände der Geschichte und den Ort der Geburt ist nichts, was zu einem individuellen Schuldbewusstsein führen sollte. Wohl aber zu Bewusstsein, zu Bewusstheit.
Eine Grundschulklasse von heute hat mit meiner Volksschulklasse nicht mehr viel gemein. Nicht nur das Panorama der Haarfarben und Herkünfte ist vielfältig geworden; auch die Lebensstile der Eltern und die Unterschiede zwischen arm und reich klaffen ungleich weiter auseinander. Markenklamotten, das war 1960 noch kein Begriff. Auf der alten Fotografie kann man sehen, dass vieles handgemacht war, gestrickt, umgearbeitet. Allerdings gab es, mehr gefühlt als gewusst, den Unterschied zwischen bürgerlichen und nichtbürgerlichen Familienkulturen.
Eine Szene hat sich mir unauslöschlich eingeprägt. Als mich eine Klassenkameradin nach der Schule ein Stück Weges begleitete, schwenkte sie ihre Strickjacke nonchalant durch den Staub in der Gosse neben dem Trottoir. Ich war bis ins Herz schockiert und empfand zugleich einen wilden Neid, für den ich noch keine Worte hatte. Vielleicht hatte ich gerade durch die Gitterstäbe meiner Wohlerzogenheit zum ersten Mal einen Eindruck davon erhascht, was Freiheit bedeutet.
#Ruby
Sie war genauso alt wie ich, Ruby Bridges, eingeschult 1960, ein kleines Mädchen in New Orleans. Sie wurde zum ersten afroamerikanischen Kind, das im Süden der USA eine bis dahin ausschließlich weiße Schule besuchte.
Als Ruby sechs Jahre alt wurde, hatte sich gerade die Rechtslage geändert: Der Staat Louisiana erlaubte schwarzen Kindern, in bisher rassisch segregierte weiße Schulen zu gehen, sofern sie einen anspruchsvollen Eignungstest bestanden. In New Orleans war Ruby eines von sechs Kindern, denen das gelang. So kam der große Tag: Mit einer weißen Blume im Haar, weißen Söckchen und einer karierten Tasche traf Ruby bei der William Frantz Elementary School ein. Sie wurde von einem aufgebrachten weißen Mob empfangen, angeschrien und mit Gegenständen beworfen. Obwohl sie einen Geleitschutz von vier Bundesbeamten hatte.
Als Ruby endlich die Schule betrat, machte sie die Entdeckung, dass das Gebäude verwaist war: Die weißen Kinder waren auf Anweisung ihrer Eltern zu Hause geblieben oder an andere Schulen geschickt worden. Und die Lehrer waren nicht bereit, Ruby zu unterrichten, mit einer Ausnahme, einer Zugezogenen aus dem Norden. Vor dieser Lehrerin saß Ruby fast ein Jahr lang ganz alleine, auf dem Schulweg immer noch von Beamten eskortiert. Ihre Eltern waren Drohungen und Beschimpfungen ausgesetzt; der Vater, ein Tankwart, verlor seine Arbeit. Ruby hatte Albträume, bekam Essstörungen und ging doch weiter in diese Schule.
Nach und nach beruhigte sich die Lage. Die weißen Eltern ließen ihre Kinder zurückkehren, im zweiten Schuljahr wurde die Eskorte aufgelöst, weitere afroamerikanische Kinder wurden eingeschult.
Ist diese Geschichte nur zufällig mit meinen Lebensdaten verbunden? Nicht ganz. Sie zeigt die dunkle Seite einer Weltmacht, die den Westdeutschen damals Vorbild für Demokratie war. Und sie gibt einen ersten Hinweis, wer nicht mitgedacht wurde, wenn von der »freien Welt« die Rede war. Aber da ist noch etwas. Der Mob aus bürgerlichen weißen Eltern, der vor Rubys Schule stand, verstand sich als white resistance. Der Slogan steht heute auf den T-Shirts junger Männer, die auf deutschen Straßen einen Rassenkrieg herbeiphantasieren. Wer sie sieht, möge an Ruby denken.
#Homogenität
War die Homogenität meiner Schulklasse künstlich, ein bloßes Resultat des Vorangegangen? Diese Frage habe ich mir früher nicht gestellt. Wir halten für normal, wovon wir die Vorgeschichte auslassen.
Die deutsche Gesellschaft hatte in der Zeit vor 1933 durchaus eine Diversität gekannt; nun war sie ausgelöscht. Der Nationalsozialismus, von außen besiegt, hatte im Inneren erreicht, worauf er abzielte. Wie viele Juden, Roma/Sinti, Polen, Russen, Afrodeutsche in meiner Heimat gelebt hatten, war niemals Gegenstand des Unterrichts. Überhaupt wurde uns nicht vermittelt, was Deutschland eigentlich war, jenseits vom Mythos rassischer Reinheit, der zumindest offiziell verworfen war. Niemand sagte uns, dass wir phänotypisch die Promenadenmischung Europas sind. Die deutschen Lande lagen stets dort, wo sich alle Wege und Kriegszüge kreuzten, in der Mitte des Kontinents; viele Völker Europas hinterließen in unserem Genpool ihre Spuren. Carl Zuckmayer nannte den Rhein die »große Völkermühle«, die »Kelter Europas«.
Diese ältere, uns lange schon eingeschriebene Heterogenität erkennen wir heute nicht mehr, vor lauter Aufregung über die Einwanderung jüngeren Datums. Der Berliner Bezirk Neukölln, bekannt als Stadtteil türkischer und arabischer Migranten, birgt eine vergessene Kontinuität. Neukölln geht auf die Gemeinden Deutsch-Rixdorf und Böhmisch-Rixdorf zurück, letztere 1737 von geflüchteten Protestanten aus Böhmen gegründet. Manche Rixdorfer sprachen in Berlin noch im frühen 20. Jahrhundert tschechisch.
Die sichtbare und an Namen ablesbare Homogenität, wie sie meine Schulklasse kennzeichnete, war also keineswegs natürlich. Sie währte nach Kriegsende zwei Jahrzehnte, bis Einwanderung erneut einen Zustand herstellte, der an frühere Epochen anknüpfte. Gleichwohl wird die Pluralität heute als neu empfunden, als sei sie eben erst angekommen.
Vielleicht ist es ja so: In jenem Maße, wie das Gesicht der Pluralität ein Kind der jeweiligen Zeit ist, hat auch die Abwehr immer neue Züge.
#Brown babies
Die Allerersten, die nach 1945 als sichtbar andere in das künstlich homogenisierte Deutschland kamen, trugen keinen Koffer. Es waren Babys; sie hatten schwarze Väter, Soldaten der Besatzungsmächte.
Auf diesen Kindern, die Negermischling oder Halbblut genannt wurden, lag die ganze Last des Neuanfangs.
Nicht dass ihre Zahl so groß gewesen wäre, etwa fünftausend unter den siebzigtausend nicht ehelichen Kindern, die in den Westzonen aus Verbindungen mit ausländischen Soldaten hervorgingen. Doch sie stellten ein Politikum dar, wurden im Bundestag als »rassisches Problem« debattiert, und Schulbehörden wie Jugendämter prophezeiten, diese andersartigen Kinder würden niemals integrierbar sein. Deshalb wäre es zu ihrem Besten, sie aus Deutschland zu entfernen und zur Adoption ins Ausland zu geben, wo sie Schwarze unter Schwarzen sein könnten.
So erging es Rudi Richardson. Als wir uns begegnen, ist er bereits ein Mann in fortgeschrittenen Jahren, 1955 geboren, annährend mein Alter. Alles an Richardson, der ein deutsches Kind war, wirkt nun amerikanisch, Name, Sprache, Auftreten – das ist die Hülle, die ihn zusammenhält, wenn auch schlecht. Seelisch ist er ein Wrack, gestrandet in einem Männerwohnheim der deutschen Heilsarmee, wo Menschen landen, die nirgends hingehören, und genauso fühlte er sich. Nach und nach, aus seinen Erzählungen und meinen Recherchen, entstehen die Konturen seiner Geschichte.
Bayern, Mai 1955: Im Frauengefängnis Aichach bringt die ledige Lieselotte Ackermann, 22 Jahre, einen Jungen zur Welt. Die Geburtsurkunde verzeichnet in Sütterlin-Schrift den Namen Udo; in der Zeile für den Namen des Vaters ein Strich. Lieselotte Ackermann hatte ihren schmalen Lohn als Hausgehilfin an Wochenenden aufgebessert, indem sie nach Kitzingen fuhr, zu den amerikanischen GIs. Schwanger mit Udo wird sie wegen Prostitution inhaftiert.
Das Jugendamt gibt den Säugling zu einer Pflegefamilie. Lieselotte Ackermann besucht Udo später ein einziges Mal; geht mit dem Zweijährigen spazieren, ihre Schultern verkrampfen sich unter den Blicken der Passanten.
Das Wort Rassenschande ist noch im Umlauf, lautlos gesprochen. Und Lieselotte Ackermann entstammt selbst einer nach NS-Begriffen geächteten Verbindung. Ihr Vater war Jude; seine eigene Frau lieferte ihn aus. Die Tochter war als sogenannte Halbjüdin gleichfalls eine unerträgliche Belastung; Lieselotte wurde verstoßen, landete im Heim. Von früh an seelisch beschädigt, setzt sie nun den Kreislauf von Scham, Abwehr und Verstoßung fort, vermutlich kann sie nicht anders.
Bei den Pflegeeltern wird Udo misshandelt. Später, als erwachsener Mann, sieht er sich in seinen Albträumen immer wieder als nackten, schmutzigen Säugling.
Mit knapp fünf Jahren wird er in die USA abgeschoben, es ist eine der letzten Verschickungen dieser Art. Kinder, an deren Deutschsein rechtlich kein Zweifel besteht, werden per Sonderregelung zu schwarzen Adoptiveltern nach Amerika gegeben. Als 1951 die ersten beiden Kinder, sie waren aus Mannheim, abreisten, von der Stadt mit neuen Teddybären ausgestattet, texteten die Redakteure des ›Mannheimer Morgen‹ aufgeräumt: »Zwei kleine Negerlein, die fahren über’n Teich«.
Es ist 1960, als Udo in Kalifornien eintrifft und aus ihm der Amerikaner Rudi Richardson wird. Erneut sind wir im Jahr meiner ereignislosen Einschulung, in jenem Jahr, als die kleine Ruby vor der Schule von einem Mob empfangen wird. Die brown babies kommen in ein Land, das noch tief von Rassekategorien geprägt ist. Und sie wechseln dort gleichsam die Farbe, nun fällt nicht auf, wie schwarz, sondern wie hell sie sind. Für ihre afroamerikanischen Adoptiveltern verkörpern sie die Vision einer Gesellschaft ohne Rassendünkel; in den meisten Bundesstaaten der USA sind Ehen zwischen Schwarzen und Weißen noch verboten.
Rudi, das entwurzelte, gleichsam umgetopfte Kind, findet keinen Ort in dieser Utopie, keinen Halt. Stets irrlichtert er zwischen schwarz und weiß, den einen ist er zu hell, den anderen zu dunkel. An der Schule hänseln schwarze Kinder, er rede wie ein Weißer, weil er keine schwarze Stimme hat. Er wechselt Klamotten und Musikvorlieben je nach Community, tut alles, um Applaus zu bekommen. In der Armee tritt er als Pianist auf, in einer Kirchengemeinde als Prediger. Und doch bricht sein Leben immer wieder ein; Drogen, Diebstähle, Gefängnis. »So lange ich mich erinnern kann, hatte ich diese Leere im Herzen«, sagt er zu mir.
Erst spät wird er sich seiner deutschen Herkunft neu bewusst und er beginnt von den USA aus, nach der leiblichen Mutter zu suchen. Über Jahre tut sich nichts, bis eine Hilfsorganisation für ihn Lieselotte Ackermann ausfindig macht, in Würzburg. »Ich will keinen Kontakt«, schreibt sie. Schließlich schickt sie ihm ein Jugendbild, doch bleibt reserviert, möchte ihn nicht sehen. Sie wohnt in einem großen Mietshaus, fürchtet das Gerede.
Richardson reist trotzdem nach Deutschland, wild entschlossen, »jemandes Sohn zu sein«. Seine deutsche Staatsangehörigkeit wird nicht mehr anerkannt, er kämpft mit den Ämtern, hat einen Nervenzusammenbruch, wird in die Psychiatrie eingewiesen. In einem Kreislauf aus Ablehnung und Selbsthass macht er sich schwärzer, als er ist. »Schau dir mein Foto in der Akte an«, sagt er zu mir, »ich bin schwarz wie Kohle.« Als ich an seinem Geburtstag mit einem Blumenstrauß gratulieren will, verbarrikadiert sich Richardson in seinem Zimmer.
Irgendwann geht er nach London, dort wird alles besser, er fühlt sich nicht ausgegrenzt. Als Betreuer von Straßenkindern wird er zum Vorbild für andere, die nach Halt suchen. Er bekommt Auszeichnungen, sein Leben wird verfilmt.
Als Person habe ich Rudi Richardson, Sohn einer deutschen Mutter, Enkel eines ermordeten Juden, schon lange aus den Augen verloren. Aber seine Geschichte ist nicht zu Ende erzählt. Wie tief saß der Gesellschaft das Rassedenken noch in den Kleidern, als meine Generation auf der Schulbank saß – und wo ging das hin?
Nur etwa die Hälfte jener fünftausend Kinder, die man heute afrodeutsch nennen würde, landete am Ende tatsächlich in einer Auslandsadoption. Keine Geschichte hat nur eine Seite, auch diese nicht. Es gab Mütter, die ihre Babys nicht herausrückten. Es gab Mütter, die ihre Kinder zwar auf Drängen des Umfelds nicht behielten, aber sich immerhin weigerten, ihre Unterschrift auf ein Papier zu setzen, das aus dem Kind eine displaced person machte, ein staatenloses Treibgut, das am anderen Ende der Welt angespült würde.
Die größte Frage aber bleibt, warum Menschen mit einem schwarzen oder afrikanischen Anteil in ihrem Äußeren als so ganz besonders anders empfunden werden, bis heute?
#Unsere Integratoren
Wann ist Deutschland ein Einwanderungsland geworden? Es ist seltsam, dass wir das nicht wissen. Weil das, was entstand, lange geleugnet und nicht getauft wurde, sind wir uns des Großartigen, was allmählich innerhalb unserer Grenzen heranwuchs, nicht bewusst geworden. Und großartig muss man es wohl nennen, wenn Menschen aus mehr als hundertachtzig Nationen in einem Deutschland Heimat gesucht haben, das zuvor seinen Hass auf Andersartige so gründlich unter Beweis gestellt hatte.
Sie haben uns integriert, haben uns der Welt weniger verdächtig gemacht. Die Zahlungen an Israel zur sogenannten Wiedergutmachung waren ein synthetischer staatlicher Akt, um die Bundesrepublik optisch aus dem Dunkeln zu holen. Die Einwanderung aber war die individuelle Entscheidung vieler Einzelner, diesen Deutschen wieder eine Chance zu geben – aus welchen Motiven auch immer.
Nur wollte niemand das feiern. Niemand hat je, begleitet vom hellen Klirren der Sektgläser, einen Grundstein für ein Museum der Einwanderung legen wollen, denn in einem solchen Museum wäre die Migration als Faktum anerkannt worden, als eine nicht mehr vergehende Tatsache. Der Migration eine sichtbare Vergangenheit geben, würde ihrem Platz in der Gegenwart Wurzeln verleihen. Das gilt auch umgekehrt: Die Vergangenheit nicht abzubilden nährt die Illusion, Einwanderung ließe sich wieder aus unserer Mitte entfernen – oder es sei jedenfalls natürlich, dass ihre Präsenz etwas Prekäres und Kontroverses hat.
Woher rührt diese fast tölpelhaft wirkende innere Bockigkeit, das Deutschsein nicht mit anderen teilen zu wollen?
Es tut gerade heute gut, sich zu erinnern, wie viele Ankömmlinge beigetragen haben zu dem, was nun Deutschland ist.
Zunächst kamen zwölf Millionen Geflüchtete und Vertriebene aus dem ehemaligen Osten des Deutschen Reichs. Die nächste ethnisch deutsche Großwanderung ging noch einmal von Ost nach West: Drei Millionen Menschen aus der DDR und Ostberlin zog es zur Arbeit nach Westdeutschland. Dann folgten die sogenannten Gastarbeiter, Männer wie Frauen: Griechen, Spanier, Portugiesen, Jugoslawen, Südkoreanerinnen, Italiener, Marokkaner, Türken. Die DDR holte sich Vertragsarbeiter, von denen vor allem Vietnamesen blieben. Anschließend die Aussiedler: drei Millionen aus der Sowjetunion respektive ihren Nachfolgestaaten, neunhunderttausend aus Polen und Rumänien. Als Nächstes zweihundertzwanzigtausend Juden und Jüdinnen aus der Ex-Sowjetunion. Dann bosnische Kriegsflüchtlinge. Und viel später die Syrer.
Aus all diesen Herkünften und noch einigen mehr wurde eine Einwanderungsgesellschaft der vielen Facetten, ohne eine dominierende Gruppe. Die größte Minderheit sind zwar die Türkischstämmigen, doch machen sie nur vierzehn Prozent der Migranten aus. Jeder dritte Zugewanderte kommt aus einem anderen Land der Europäischen Union, mit all ihren Schattierungen von Reichtum und Armut.
#Die tiefe Gleichgültigkeit
Als ich in den 1970 er-Jahren studierte, waren aus meiner westdeutschen Warte Türken so etwas Ähnliches wie die DDR: irgendwo am Horizont meiner Wahrnehmung, ohne Belang für mein Leben. Diese tiefe Gleichgültigkeit, das vollkommene Desinteresse ist vielleicht für unser Verhältnis zu den Deutsch-Türken bezeichnender als Rassismus. Oder ist die Gleichgültigkeit nur dessen bleiche Schwester, die sich nicht einmal erschüttern ließ durch die Mordserie des Nationalsozialistischen Untergrunds, des NSU, weil sie eben vorwiegend nur türkische Leben traf?
Im Sommer 1983, ich war Lokalreporterin in Buxtehude, besuchte ich erstmals eine türkische Familie in ihrem Zuhause. Gani Demirel war seit einem Jahrzehnt Kotflügellackierer in einem Buxtehuder Werk, wie zuvor schon sein Vater. Auf seinen Spind im Betrieb hatte nun jemand geschrieben: Türken raus. Solche Vorfälle häuften sich, darum war ich gekommen.
Zu der Zeit bot die Regierung eine finanzielle Prämie an, damit türkische Migranten zurück in die Türkei gingen. Die Kampagne beflügelte den Neid auf jene, die das Geld nahmen und abreisten, und gleichermaßen den Hass auf jene, die blieben. Es gab Tausende von Übergriffen, Gewalt gegen Personen wie gegen türkische Geschäfte, sogar Todesopfer.
Die Demirels, Gastarbeiter in zweiter Generation, lebten in einer möblierten Mietwohnung wie auf dem Sprung. Und sie waren noch nie von einer deutschen Familie in eine deutsche Wohnung eingeladen worden. Auf dem Foto, das ich seinerzeit machte, fällt mir heute auf, was mir damals keineswegs auffiel: im Wohnzimmer nichts erkennbar Muslimisches. Frau Demirel trägt ein Sommerkleid mit kurzen Ärmeln, das Haar unbedeckt. Auf dem Tisch eine Plexiglaskanne mit einem erkalteten Rest Filterkaffee. Hinter dem Tisch stehen zwei kleine Mädchen, die Augen weit aufgerissen vor Aufregung über den seltenen Besuch.
Eines der Mädchen hätte Serap Güler sein können: geboren 1980, allerdings nicht in Buxtehude, sondern in Marl. Die Tochter eines Anatoliers, der vierzig Jahre unter Tage im deutschen Bergbau arbeitete, zählt heute zum Führungspersonal der CDU. Serap Güler erinnert sich, wie es war, als ihre Mutter mit der Tochter loszog, um für den Musikunterricht eine Flöte zu kaufen. Die Verkäuferin im Laden fragte als Erstes, ob die Mutter wegen der Stelle als Putzfrau gekommen sei.
Es sind diese erfolgreichen Kinder von Migranten, die heute angemessen scharf auf Zumutungen reagieren. Als der vormalige Bundespräsident Joachim Gauck einmal kundtat, es sei »nicht hinnehmbar, wenn Menschen, die seit Jahrzehnten in Deutschland leben, sich nicht auf Deutsch unterhalten können«, wies ihn die Tochter des Bergmanns öffentlich zurecht. Der minimale Deutschunterricht, der für ihren Vater wie für alle anderen Gastarbeiter ausreichen musste, lehrte das Vokabular für Maschinen und Werkzeug. Schon die Worte für einen Arztbesuch waren nicht mehr vorgesehen. »Du besser reden mit Tochter«, sei der typische Satz seiner Generation gewesen. Ihr Vater habe genau das getan, wofür er gerufen worden war: hart arbeiten, zehn bis zwölf Stunden am Tag. Nach vier Jahrzehnten unter Tage war er stolz, kein einziges Mal wegen Krankheit gefehlt zu haben.
Nicht hinnehmbar, sagte die Bergmanns-Tochter, seien nicht die mangelnden Deutschkenntnisse des Vaters, sondern die Geringschätzung seiner Generation und ihrer Leistung.
#Zukunftsfähigkeit
Junge und Alte leben in Deutschland, was Einwanderung betrifft, in völlig verschiedenen Erfahrungswelten. Bei den 85-Jährigen gibt es gerade einmal sieben Prozent Migranten, bei den unter Fünfjährigen sind es vierzig Prozent, in einzelnen Städten noch weitaus mehr. In vielen Klassenzimmern westdeutscher Metropolen sind Kinder aus Migrantenfamilien in der Mehrheit.
Das Alter hat also einen enormen Einfluss darauf, ob Multikulturalität als normal empfunden wird oder nicht. Wer heute fünfzehn Jahre ist, wurde bereits in eine Gesellschaft hineingeboren, die sich nicht mehr gegen die Vorstellung sträubte, Einwanderungsland zu sein. Nahezu die Hälfte aller Jugendlichen kennt im engeren oder weiteren familiären Umfeld Menschen mit Migrationsgeschichte. Die Vorstellung davon, was deutsch ist, fällt bei den Jüngeren viel flexibler aus.
Dazu tragen die Universitäten bei. Weil dort in wachsendem Maße Kommilitonen mit Zuwanderungsgeschichte sitzen. Und weil die Universitäten heute kosmopolitische Orte sind: Jeder Fünfte, der sich zum ersten Mal einschreibt, kommt aus dem Ausland, darunter sind viele Chinesen.
Kaum verwunderlich, dass sich in der Akzeptanz von Flüchtlingen gleichfalls eine Kluft zwischen den Generationen auftut. Bei Älteren ist sie nach 2015 drastisch gesunken, sagen Studien, während bei den Befragten unter dreißig jeder Zweite meint, Deutschland könne und solle mehr Schutzsuchende aufnehmen. In den Befunden der Meinungsforschung wirkt sich natürlich der generationell so unterschiedliche Migrantenanteil aus – das heißt: von den Ansichten »der Deutschen« zu sprechen und damit nur Alteingesessene zu meinen, wäre nur in Seniorenheimen angebracht.
Selbst wenn die Grenzen heute geschlossen würden und kein einziger Zuwanderer, kein einziger Flüchtling mehr hereindürfte: Das künftige Deutschland wäre gleichwohl sichtbar und fühlbar diverser als das heutige. Die Migrantenkinder werden als Erwachsene einen Teil ihres kulturellen Erbes an ihre Nachkommen weiterreichen. Und sie werden als Lehrer, als Politikerinnen oder Journalistinnen das Land vermehrt prägen.
In einigen westdeutschen Großstädten wie Stuttgart und Frankfurt wird künftig nur noch die Hälfte der Einwohner langheimisch deutsch sein. Es gibt keinen Weg zurück in die gemütliche Homogenität von gestern. Dies als Tatsache anzuerkennen, muss jedem Streit vorausgehen – dem Streit, ob und wie Zuwanderung steuerbar ist oder wie Deutschland seine humanitäre Verpflichtung gegenüber Schutzsuchenden wahrnimmt.
Im Durchschnitt sind Migranten zehn Jahre jünger als die langheimisch Deutschen, und obwohl sie deutlich weniger verdienen, haben sie mehr Nachwuchs (wenngleich nicht in jenem Maße, wie ihnen das Klischee gern unterstellt: nur sechzehn Prozent dieser Familien haben drei oder mehr Kinder). Ginge es nach ihnen, wäre das deutsche Rentensystem haltbarer, was Politiker selten erwähnen, wenn sie wieder einmal Kinderlosigkeit rügen.
Wie ungleich sich die migrantische Bevölkerung innerhalb Deutschlands verteilt, ist grotesk: Nur drei Prozent leben in den östlichen Bundesländern. Auffallend ist gleichfalls der Unterschied zwischen Stadt und Land: je größer die Gemeinde, desto mehr Migranten. Im Umgang mit Zugewanderten ist das Stadt-Land-Gefälle entscheidender als das Einkommensgefälle, sagt die Migrationsforscherin Naika Foroutan: Arme Großstädter seien offener für Pluralität als wohlhabende Kleinstädter.
Nimmt man den Ost-West-Unterschied hinzu, dann wirken eine westdeutsche Großstadt und eine ostdeutsche Kleinstadt, als lägen sie in verschiedenen Staaten. Und man muss sich nicht lange fragen, wo mehr Zukunft ist. Ostdeutschland droht aufgrund seines geringen Migrantenanteils wirtschaftlich weiter abgehängt zu werden: Der Mangel an Fachkräften ist dort besonders groß, und die Bevölkerung altert schneller. Im Jahr 2030 könnte jeder Dritte im Osten im Rentenalter sein.
#Aufstieg und Abwehr
Wenn wir unter weißer Dominanz verstehen, dass die alteingesessenen Deutschen das Privileg beanspruchen, alleine zu entscheiden, worüber das Land spricht, dann wird Deutschland gegenwärtig weniger weiß. Die später Gekommenen beginnen sich aus der Rolle zu befreien, nur Objekte des öffentlichen Diskurses zu sein. Sie reden mit, sie werden laut. Und das ist ein Umbruch, der ein ideelles Machtgefüge erschüttert.
Anders als Frankreich und Großbritannien ist Deutschland ungeübt darin, mit einer multiethnischen Intelligenzija umzugehen. Auch dies ist eine Folge des Zivilisationsbruchs von 1933 bis 1945, eine Folge von Auslöschung und Vertreibung. Es hat aber auch damit zu tun, dass Deutschland seine Kolonien früh verlor. In Paris trafen sich in den 1950 er-Jahren ehrgeizige Vordenker aus Afrika und der Karibik, sie befruchteten einander, und Franzosen, die dazu bereit waren, konnten an ihrem Weltdenken teilhaben. Es entstanden Zeitschriften und Verlage.
Für die Deutschen gab es lange nur eine Blickrichtung, von oben nach unten. Migranten waren die Ungebildeten, sie hatten die anatolischen Dörfer mitgebracht, was für die erste Generation häufig auch zutraf, sie waren die stumme Reinigungskraft und wurden bestenfalls Gemüsemann, und immer blieben sie aus Sicht des Bürgertums ein unterer Stand. Nun ist etwas Erstaunliches passiert: Migrantenkinder durchbrechen Klassenschranken. Ausgerechnet in einem Land, wo Bildungschancen normalerweise so hartnäckig innerhalb der Zäune von Schicht und Klasse verbleiben, wo in der Regel nur Bürgerkinder Bürgerärzte werden, gelingt jungen Migranten der Aufstieg.
Natürlich nicht allen: Der Anteil derer, die keinerlei Schulabschluss schaffen, schrumpft nur langsam und ist immer noch viel höher als bei den Kindern der Alteingesessenen. Aber weit mehr als früher besuchen Gymnasien und machen Abitur. In einem heutigen Jahrgang junger Erwachsener hat bei den Migranten fast jeder Zweite eine Fachhochschul- oder Hochschulreife, bei den Altersgenossen ohne Zuwanderungsgeschichte sind es nur geringfügig mehr. Das ist ein spektakulärer Erfolg, oft errungen gegen Entmutigungen von Seiten der Lehrerschaft und ohne dass die Eltern aufgrund eigener Bildungsdefizite in der Lage gewesen wären, bei den Hausaufgaben zu helfen. Es gibt heute muslimische Doktorandinnen mit analphabetischen Müttern.
Dies ist also eine Zäsur. Und es ist kein Zufall, dass in dieser Zeit des beginnenden Aufstiegs von Migranten Hass und Abwehr so groß geworden sind. Erfolgreiche Migranten sind sichtbar.
Die Putzfrau mit Kopftuch hat niemanden gestört, sie war Bestandteil einer quasi unterirdisch tätigen Arbeitsarmee. Die Lehrerin, die mit Kopftuch unterrichten möchte und dafür vor Gericht zieht, ist hingegen Bürgerin. Sie reklamiert Gleichberechtigung, mehr noch: Sie will sogar Vorbild sein, soweit ihr Beruf das vorsieht. An ihr scheiden sich die Geister, sie erregt Verdruss. Und sie wehrt sich, anders als ihre putzende Mutter oder Großmutter.
Der Soziologe Aladin El-Mafaalani, ein 1978 im Ruhrgebiet geborener Sohn syrischer Einwanderer, nennt dies das Integrations-Paradox: »Wenn Integration gelingt, wird die Gesellschaft nicht harmonischer, nicht konfliktfreier. Im Gegenteil.« Er benutzt dafür die Metapher eines Tischs, an dem früher nur einer redete, obwohl immer mehr dort Platz nahmen. Nun wollen alle mitreden und mitbestimmen. Und mehr Teilhabe weckt die Erwartung auf gleiche Teilhabe. Wenn sich heute viele über Diskriminierung beschweren, sei das ein Zeichen von Fortschritt, argumentiert El-Mafaalani. Denn nur wer eine Ungleichbehandlung als illegitim erachte, fühle sich diskriminiert.
Die Entstehung einer kulturell flexiblen und mehrsprachigen neuen Elite macht dieses Land schlichtweg ein wenig normaler. Denn im Vergleich mit weitaus ärmeren und fragileren Gesellschaften, die ich außerhalb Europas kenne, fehlt es dem reichen, stabilen Deutschland auf beunruhigende Weise an Gelassenheit im Umgang mit ethnischen, kulturellen, sprachlichen Verschiedenheiten.
Gegenwärtig sind aufgestiegene Migranten häufig noch in Berufen, die nicht direkt mit alltäglicher Macht über andere assoziiert werden; sie sind Freiberufler und Ärzte, arbeiten in Forschung und Lehre, Design, Schauspiel, Kunst. Doch auch in Führungspositionen der privaten Wirtschaft sind Migranten und Migrantinnen bereits angemessen vertreten. Und im Jobcenter entscheidet manchmal ein Schwarzkopf, ob sich der arbeitslose Langheimische durch eine weitere Fortbildung quälen muss.
Ja, das ist weißer Machtverlust, und er kommt manche bitter an. Er nährt die Angst vor Konkurrenz und Abstieg, und diese Angst ist nicht ohne realen Kern. Weil eine junge mehrsprachige und bikulturell geprägte Migrantin für den Arbeitsmarkt der Zukunft viel besser gerüstet ist als ein altdeutscher Ostthüringer. Und weil die neue migrantische Elite ein fernes, aber doch vernehmbares Echo auf weltweite Veränderungen darstellt: den Rückgang weißer Macht.
Vordergründig richtet sich der rechte Kulturkampf gegen die erst kürzlich Angekommenen, gegen Kriegsflüchtlinge und Asylbewerber. Doch immer öfter bricht durch, wer noch alles gemeint ist. Die Angriffe auf prominente Persönlichkeiten mit nichtdeutschen Namen transportieren eine Botschaft der Säuberung. Sie lautet: Uns sind auch jene zu viel, die mit deutschem Pass und Steuerkarte und Diplom hier leben, die hier geboren sind, womöglich einen deutschen Elternteil haben. Wie Isabel Schayani vom WDR, der gesagt wird: »Geh zurück in deinen Islam.«