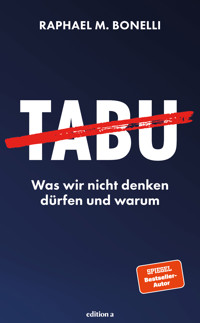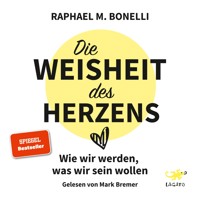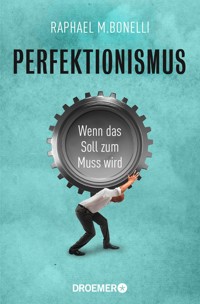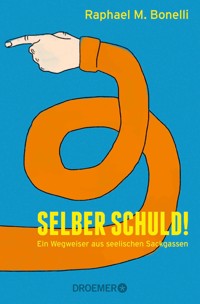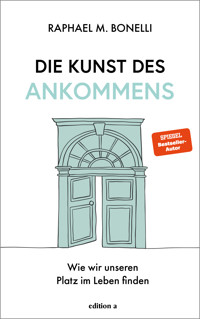
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
Wie kommen wir an: in der Liebe, im Beruf und im Leben? Wie finden wir unseren Platz in einer Welt, die zunehmend aus den Fugen gerät? Warum fällt uns das gerade heute so schwer? Warum fühlen sich so viele Menschen heimatlos und verloren? Spiegel-Bestseller-Autor Raphael M. Bonelli weiß aus langjähriger Erfahrung als Psychiater, Neurowissenschaftler und Psychotherapeut, dass jeder Mensch ankommen kann. In seinem neuen Buch analysiert er die zwölf Hindernisse auf dem Weg zum Ankommen. Er zeigt, wie wir sie überwinden können, um eine tiefe Zufriedenheit zu erreichen und unsere innere Heimat in einer heimatlosen Moderne zu finden.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 249
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
DIE KUNST DES ANKOMMENS
Raphael M. Bonelli:
Die Kunst des Ankommens
Alle Rechte vorbehalten
©2024 edition a, Wien
www.edition-a.at
Cover: Anna-Mariya Rakhmankina
Satz: Bastian Welzer
Gesetzt in der Premiera
Gedruckt in Deutschland
1 2 3 4 5 — 27 26 25 24
ISBN: 978-3-99001-747-0
eISBN: 978-3-99001-748-7
Gewidmet meiner Frau Vici
Durch sie und bei ihr bin ich angekommen
INHALT
TEIL I Das Problem: Warum das Ankommen zum Thema wurde
KAPITEL 1 Entfremdet durchs Leben: Das permanente Gefühl, »lost« zu sein
Die große Sehnsucht
Was die Schwarmintelligenz zusammentrug
Auch Promis kommen nicht an
KAPITEL 2 Zuhause im Jetzt: Wohin wir wollen, wohin wir sollen
Warum Ankommen meist unspektakulär ist
Die Schwarmintelligenz ist wieder am Wort
Aus der Geschichte lernen
Seine Berufung finden
KAPITEL 3 Im Sog der Ungewissheit: Die verlorene Heimat
Die neue Heimatlosigkeit
Heimatlos durch Bindungsunfähigkeit
Heimatlos durch eine herzlose Gesellschaft
Heimatlos durch Vertrauensmissbrauch
Heimatlos durch spirituelle Impotenz
TEIL II Die Hindernisse: Warum wir nicht ankommen können
KAPITEL 4 Angst, Gier und Geilheit: Gefühle als Hindernis
Hindernis #1: Affirmative Gefühle wollen alles, und zwar sofort!
Hindernis #2: Aversive Gefühle verhindern das Leben
Hindernis #3: Perfektionismus als Spielverderber
Hindernis #4: Die verkitschte Vorstellung von Liebe
KAPITEL 5 Ideologie und Manipulation: Gedanken als größeres Hindernis
Hindernis #5: Die intellektuelle Faulheit
Hindernis #6: Das Denkverbot. Es kann nicht sein, was nicht sein darf
Hindernis #7: Wie Ideologien den Verstand verdrehen
KAPITEL 6 Ego-Trip und pure Bosheit: Der Wille als ultimatives Hindernis
Hindernis #8: Das verstockte Herz
Hindernis #9: Die Willensschwäche
Hindernis #10: Die trügerisch-triviale Trias
Hindernis #11: Der Werteschwund
Hindernis #12: Der versteckte Narzissmus
TEIL III Der Weg: Wie wir die Hindernisse überwinden
KAPITEL 7 Den Stier bei den Hörnern packen: Wie wir die Gefühle kultivieren
Über Freiheit und Unfreiheit
Die Befreiung von der Gier
Sich an die Freiheit gewöhnen
Die Befreiung von der Angst
Die kultivierte Emotion: Das Schöne wollen
KAPITEL 8 Vom Mitläufer zum Vorreiter: Wie wir unsere Gedanken ordnen
Die Charakterstärke der Klugheit: Die Welt sehen, wie sie ist
Psychologie des Mitläufers
Der geordnete Verstand: Das Wahre erkennen
KAPITEL 9 Befreit aus der Ego-Falle: Wie wir uns richtig entscheiden
Die Charakterstärke der Gerechtigkeit: Sich selbst relativieren
Das offene Herz: Das Gute tun
Selbstvergessenheit als Eigenschaft des Ankommens
TEIL IV Endstation Sehnsucht: Endlich angekommen!
KAPITEL 10 Beruf als Berufung: Ankommen im Tun
Von der negativen zur positiven Freiheit
Kairos: Worauf es beim Ankommen ankommt
Hingabe: Mehr als ein Gefühl
Dreimal Endstation Sehnsucht
Ankommen im Beruf
Die drei Schlüsselfragen
KAPITEL 11 Partnerschaft als Erfüllung: Ankommen in der Liebe
Die fünf Sprachen der Liebe
Ankommen in der Zärtlichkeit
Ankommen in der Anerkennung
Ankommen in der Zweisamkeit
Ankommen im Schenken
Ankommen in der Hingabe
KAPITEL 12 Himmel auf Erden: Ankommen in der geistlichen Heimat
Neurobiologie des Heimatgefühls
Von der spirituellen Intelligenz
Aus der Krise in die Fülle
Wie wir erkennen, ob wir angekommen sind
Endlich angekommen – und jetzt?
PROLOG
Forrest Gump möchte ankommen. Sein ganzes Leben lang. Von Kindesbeinen an erlebt er, was es bedeutet, nicht am richtigen Platz zu sein. In der Schule wird er wegen seiner körperlichen Einschränkungen gehänselt. Er liebt seine einzige Freundin Jenny, aber diese Liebe ist von Beginn an von einem Gefühl der Unstimmigkeit überschattet. Forrest gehört nicht dazu, er kommt schlecht an.
Forrest Gump stolpert durch die Welt, stets auf der Suche nach einem Platz, wo er ankommen kann. Nach seinem Platz. Er durchlebt außergewöhnliche Abenteuer, die ihn in den Augen anderer zu einem Helden wider Willen machen, doch die Gewissheit des Ankommens bleibt ihm verwehrt. Am College wird er zwar zum Football-Star, dennoch bleibt er ein Außenseiter. Er ist entwaffnend ehrlich – aber auch ein bisschen blöd. Er ist ein guter Freund, er hat ein gutes Herz. Die Menschen bewundern seine Fähigkeiten und seine Erfolge. Doch es ist wie Nähen ohne Faden: Die innere Ruhe, das tiefe Gefühl des Ankommens, erfährt er nicht.
Als Forrest in den Vietnamkrieg zieht, landet er wieder in einer Welt, in die er nicht wirklich hineinpasst. Der Krieg bringt Schmerz und Verlust, und obwohl er sich als tapferer Soldat beweist, bleibt in ihm das diffuse Gefühl des Nicht-angekommen-Seins. Selbst als er nach dem Krieg mit Auszeichnungen geehrt wird, spürt er, dass dies letztlich nicht das ist, wonach er strebt.
Nach dem Krieg versucht Forrest, in der zivilen Welt anzukommen. Er wird unerwartet zum erfolgreichen Unternehmer, baut ein Shrimp-Imperium auf und verdient ein Vermögen. Aber auch hier, im Glanz des Erfolges, bleibt das Gefühl, dass etwas fehlt, dass er noch nicht seine wirkliche Berufung gefunden hat. Das Geld, der Ruhm, die materiellen Erfolge – all das bringt ihm nicht das tiefe innere Ankommen, nach dem er sich sehnt.
Sein Leben nimmt eine entscheidende Wende, als Jenny plötzlich und unerwartet zu ihm kommt. Kurze Zeit lang ist er selig! Ihre Beziehung war immer kompliziert gewesen, von Höhen und Tiefen geprägt. Doch für Forrest war Jenny insgeheim stets das Zentrum seiner Welt gewesen. Dort wollte er eines Tages ankommen. Leider ist das Glück nicht von Dauer: Jenny, die ebenfalls ihren Platz im Leben nicht finden kann, verlässt ihn wieder, was Forrest in tiefe Verzweiflung stürzt.
Er beginnt zu laufen, jahrelang, ziellos, erregt öffentliche Aufmerksamkeit, inspiriert Menschen … und kommt doch nicht an. Erst am Ende, als sich Jenny todkrank per Brief meldet und ihm offenbart, dass sie beide zusammen einen Sohn haben, erfolgt der Durchbruch. Forrest nimmt die beiden zu sich nach Hause und erlebt endlich ein Gefühl von innerer Heimat. Sein Herz blüht auf. Er darf Jenny – endlich, endlich! – heiraten, kurz vor ihrem Tod. Sie stirbt, doch ihr fünfjähriger Sohn Forrest Junior wird zu seiner Berufung, zu seiner Aufgabe, zu seinem Platz.
Forrest Gump ist in aller Einfachheit angekommen. In seiner Schlichtheit, in seiner Beschränktheit: einfach angekommen. In der Rolle des Vaters, in der Verantwortung für dieses kleine, hilfsbedürftige Wesen, findet Forrest die Erfüllung, die ihm all die Jahre zuvor verwehrt blieb. Jetzt kann er sich hingeben, kann seine Liebe schenken: dem geliebten Kind seiner geliebten Jenny. Er ist endlich da, wo er hingehört. Der Film endet, wie er begonnen hat: Forrest Gump steigt in den Schulbus. Nur ist es diesmal Forrest Gump Junior, und Forrest Gump Senior begleitet ihn, liebevoll, zärtlich und glückselig.
Forrest Gump zählt zu den erfolgreichsten und einflussreichsten Filmen der Filmgeschichte. Etwa eine Milliarde Menschen hat den Film bis heute gesehen. Er wurde mit sechs Oscars ausgezeichnet und hatte einen erheblichen Einfluss auf die Popkultur. Zahlreiche Zitate aus dem Film sind heute fester Bestandteil des allgemeinen Sprachgebrauchs. Psychologisch betrachtet ist der Film ein Phänomen: Was berührt die Menschen bis heute an diesem einfachen, naiven, gutmütigen, ja unterdurchschnittlichen Mann? Die Antwort lautet: Seine beharrliche, ehrliche und letztlich erfolgreiche Suche nach seinem Platz, nach seiner Bestimmung, nach … dem Ankommen. Weil es das ist, was der Mensch im tiefsten Innern möchte: einfach ankommen.
Die fiktive, verletzliche Figur des Forrest Gump steht für das kleine, hilflose Selbst des modernen Menschen. In der geschützten Intimität der Psychotherapie bricht das Thema immer öfter auf. Tiefe, authentische Sätze wie diese häufen sich in den Sitzungen, oft von Tränen begleitet:
»Ich will einfach nur ankommen ...«
»Ich fühle mich auf dem falschen Platz …«
»Ich fühle mich entfremdet und heimatlos …«
oder
»Da muss es doch noch mehr geben …«
Es ist ein Aufschrei unserer Innerlichkeit. Was verbirgt sich hinter diesem wachsenden Bedürfnis? Welche Sehnsüchte werden damit zum Ausdruck gebracht? Ist es nur eine zeitkonforme Formulierung für die übliche Suche nach einem schönen, erfolgreichen Leben oder steckt mehr dahinter? Auf jeden Fall besteht hinreichender Grund, sich mit dem Ankommen zu beschäftigen.
Wir müssen dabei auch analytisch vorgehen. Wenn wir den Satz: »Ich möchte ankommen« zunächst sprachlich betrachten, fällt auf, dass er ohne Ziel formuliert ist. Das ist paradox, denn wenn man sich irgendwo hinbegibt, hat man normalerweise ein Ziel vor Augen. Das fehlt hier. Die Frage, wo man ankommt, spielt also erst mal eine untergeordnete Rolle. Vielmehr geht es darum, überhaupt irgendwo anzukommen. Zwar ohne das Ziel zu kennen, aber sehr wohl mit dem Ziel, ein Ziel zu haben. Ein Ziel, das das Herz erfüllt, das man vielleicht die innere Heimat nennen kann. Und wenn es diese Heimat geben soll, ergibt sich dadurch zwangsläufig die Notwendigkeit, eine gewisse Richtung dorthin einzuschlagen, die dieses Ankommen überhaupt ermöglicht. »Ich möchte ankommen« ist also erheblich viel mehr als »Der Weg ist das Ziel«. Forrest Gump weiß: Irgendwo auf dieser Welt ist mein Platz, dort gehöre ich hin.
Der Wunsch impliziert unbewusst also auch, dass nicht jeder Ort ein gutes Ankommen ermöglicht. Besser gesagt, dass nicht jeder Ort meinem persönlichen Ankommen entspricht, nicht jeder Ort meine innere Heimat ist, obwohl er vielleicht das Herz eines anderen erfüllen würde. Das Ziel muss beim Ankommen so beschaffen sein, dass der Weg für mich gut endet, dass man ein Leben lebt, von dem man sagen kann, dass es sinnvoll ist, dass es einen erfüllt, und dass man es mit Gelassenheit genießen kann. Ankommen ist also mehr als ein bloßes Gefühl.
Man kann sich also auch verirren und verrennen, kann sein Ziel verfehlen oder auf der Strecke bleiben. Und vor allem: Man kann auch am Startpunkt hängen bleiben.
Dabei geht es auch um eine Befreiung, nicht nur von den äußeren Zwängen und Beengungen, sondern auch von den inneren: Es geht darum, alte Vorstellungen hinter uns zu lassen, die wir uns unbewusst und oft unbemerkt angeeignet haben, alte Konditionierungen auf der Suche nach Anerkennung, Erfolg oder Bedeutsamkeit. Es geht darum, den inneren goldenen Käfig, in den wir uns im Laufe unseres Lebens begeben haben, zu verlassen. Ankommen ist in diesem Sinne das Aufgeben der eigenen Illusionen und Traumschlösser, die uns am Leben hindern.
Interessanterweise scheint es beim Ankommen nicht um eine vorzeigbare Leistung im Sinne von »Ich möchte mehr erreichen« zu gehen. Der kompetitive Charakter ist außen vor, der Vergleich (andere in irgendetwas zu übertreffen) spielt keine Rolle mehr. Man ist beim Ankommen ganz bei sich und mit sich selbst im Reinen. Es geht um das Bedürfnis, etwas zu finalisieren und einen persönlichen Weg abzuschließen – und idealerweise dabei seine Berufung zu finden, um so die angelegten Talente und Begabungen zur Entfaltung zu bringen. Mit dem Ankommen verbindet sich der Wunsch, das Gefühl der Getriebenheit abzuschütteln. Man will die dynamische, hektische Seite des Lebens gegen eine eher statische tauschen und in ruhigeres Fahrwasser gelangen. Wenn man so möchte, ist es die Suche nach einem Ziel, das man nicht genau kennt, das sich aber anfühlt wie ein Stück Heimat. Die wachsende Sehnsucht nach dem Ankommen ist aus psychologischer Perspektive der Wunsch nach einer heilen Welt, nach Beständigkeit, Dauer und Konstanz, einem Zustand, der den Schwankungen ein Ende setzt. In extremis extrapoliert: die tiefe innere Sehnsucht nach Ewigkeit, nach Zeitlosigkeit, nach Unverrückbarkeit, nach Endgültigkeit.
Überhaupt scheint das Bedürfnis nach innerer und äußerer Ruhe ein zentraler Aspekt des Ankommens zu sein. Eine zunehmende Zahl an Menschen fühlt sich irgendwie heimatlos, fehl am Platz. Das neudeutsche Wort »lost« beschreibt es gut: Es ist das Gefühl, hin und her geworfen zu sein von Zwängen, Emotionen und Lebensmöglichkeiten, was zu einer Art kollektiver Orientierungslosigkeit geführt hat. Einerseits sehen wir eine schier endlose Zahl an beruflichen und partnerschaftlichen Optionen, andererseits aber auch die Aufweichung von Werten, veränderte Ideale und neue gesellschaftliche Vorgaben.
Wir leben in einem Zeitalter zunehmender Beschleunigung und ständiger Forderung nach Wachstum. In diesem Prozess ändert sich auch das Lebensgefühl: Wir müssen alles gleichzeitig sein und haben – und das sofort. Morgen ist es zu spät. Wir dürfen ja nichts versäumen! Pausenlos jagen Menschen umher auf der Suche nach Glück.
Der gesunde Grundsatz des Nacheinanders wurde durch das Prinzip der Gleichzeitigkeit ersetzt. Bei der Arbeit schreiben wir SMS, beim Sightseeing facetimen wir, um anderen zu zeigen, wo wir sind … man lässt sich nicht mehr auf seine Umgebung ein, man nimmt sich selbst nicht mehr zur Gänze wahr. Die Smartphone-Pandemie verhindert Vertiefung und Verinnerlichung. Unsere Zeit leidet an Entgrenzung und Maßlosigkeit.
Damit wird auch klar, warum der Wunsch des Ankommens bei vielen Menschen immer größer wird: Weil es immer schwieriger wird, ihn heutzutage zu verwirklichen. Unsere moderne Gesellschaft lebt von Dynamik und Veränderung, und das steht der Idee des stabilen Ankommens diametral entgegen. Der Zeitgeist weht immer stärker aus wechselnden Richtungen und die Verrenkungen werden immer mühsamer, um ihm ständig und widerstandslos zu entsprechen. Verschärft wird die Entwicklung durch die jüngsten Großprojekte: Digitalisierung und künstliche Intelligenz. Es gab vermutlich noch nie ein Jahrhundert, das so sehr vom Veränderungsdrang angetrieben wurde wie das jetzige. Mehr noch, der Zeitgeist der »Disruption« stiftet uns täglich dazu an, unsere Gedanken und unser Leben ständig zu hinterfragen, zu zerstören und wieder neu zu erfinden. Für das Seelenleben ist diese Entwicklung sehr belastend, denn mit ihr ist auch ein rasanter Wandel der Werte verbunden, bei dem viele Wurzeln gekappt und traditionelle Fundamente vernichtet werden.
In der heutigen Hektik kommen wir nicht dazu, uns die Frage zu stellen: »Wie begegnen wir dem Leben?« Wir haben gar keine Zeit, im Chaos des Alltags in die Stille zu gehen, »auf die Ebene des Seins«, weg von Körper und Materie.
In so einem Umfeld ist es ausgesprochen schwer, konsistente Ziele zu entwickeln, Ruhe zu finden und anzukommen. Daher stellt sich die Frage, ob unsere moderne Gesellschaft ein »Ankommen« im eigentlichen Sinn überhaupt noch zulässt. Nehmen Sie einen älteren Menschen, der gerade in die Pension eintritt. Er beendet im Idealfall ein erfülltes Berufsleben, hat erfolgreiche und gesunde Kinder, eine Ehe, die seit Jahrzehnten hält, ist mit sich und der Welt im Reinen. Eigentlich müsste er vom Gefühl des Ankommens nur so erfüllt sein und sich entspannt zurücklehnen können. Doch er fühlt sich entfremdet: Seine persönlichen Werte, die er immer für richtig und wahr gehalten hat, werden von der Gesellschaft inzwischen geächtet. Stattdessen werden neue Werte postuliert, die ihm fremd sind. Er muss seine Sprache und sein Denken einem neuen Diktat unterwerfen, er muss Denkverbote und Tabus beachten, die ihm widerstreben. Er hat in gewisser Weise seine Heimat verloren. Verschließt sich dieser ältere Mensch zudem der Digitalisierung, wird es für ihn immer schwieriger, am Leben überhaupt noch teilzunehmen, Arzttermine auszumachen, Bahntickets zu erwerben oder mit der Krankenkasse zu korrespondieren. Er wird immer mehr ausgegrenzt.
Wir lernen aus diesem Beispiel aber: Unter einem gesunden Ankommen kann nicht das komplette Aussteigen aus dem gesellschaftlichen Leben gemeint sein, nicht das Selbstversorgen und Schafe-Züchten in einer menschenleeren Prärie, nicht das Erreichen eines statischen Zustandes inmitten eines pulsierenden, sich ständig verändernden Lebens. Vielleicht bezeichnet es eher so etwas wie ein Darüberstehen, statt eines vollständigen Aussteigens und Abmeldens. Auch der Angekommene ist in dieser Welt gegen Anpassungen nicht gefeit, weil das diesseitige Ankommen immer vorläufig ist. Ankommen ist hier keine Endgültigkeit, keine Zielhaltestelle, an der wir aussteigen und es uns dann bequem machen. Vielmehr müssen wir darunter einen Weg verstehen, der uns Stück für Stück dem Ziel immer näherbringt, eine Entwicklung hin zu einem »steady state«, wo wir offenbleiben für das Neue, ohne in Chaos und Orientierungslosigkeit zu versinken. Ankommen ist das Surfen mit den Wellen und nicht gegen sie. Es ist ein vitaler und kein verschlafener Zustand. »Im Flow« sein statt »lost«.
Wer seinen Platz einnimmt, weil er seinen wahren Beruf, seine Beziehung und seinen Glauben gefunden hat, der ist wahrhaft angekommen. Ruhe, Gelassenheit und eine konstante innere Freude ziehen in ihn ein, die ihn nicht so leicht erschüttern lassen. Sein Herz ist erfüllt. Ein solcher Mensch wartet nicht mehr auf etwas, lugt nicht neidvoll in Nachbars Garten, passt sich nicht ängstlich jedem Zeitgeist an, sehnt sich nicht mehr nach etwas Neuem, verspürt kein Drängen nach Veränderung mehr in sich. Er ist, wo er sein soll.
Ankommen ist keine Sache von Augenblicken. Manche brauchen Jahre oder Jahrzehnte dazu, viele schaffen es nie. Wer die Psychologie des Ankommens verstanden hat, der ist aber im Vorteil. Ankommen passiert uns nicht einfach so. Es ist ein langer Prozess, kein kurzer Augenblick. Wir wachen nicht eines Tages auf und stellen fest, dass wir dort sind, wo wir hingehören. Zumindest kann ein solches Gefühl genauso schnell verschwinden, wie es aufgetaucht ist. Ankommen erfordert einen langen Atem und ist mit Arbeit an uns selbst sowie mit einer gehörigen Portion Selbstdisziplin verbunden. Es ist aber eine Kunst, die erlernt werden kann.
Dieser Kunst, die man als eine Fähigkeit des richtigen Steuerns und Navigierens verstehen kann, ist dieses Buch gewidmet. Es wird sich im ersten Teil auf die Frage konzentrieren, warum in dieser rast- und orientierungslosen Zeit plötzlich das Ankommen für so viele zum essenziellen Problem geworden ist. Da es in der Fachliteratur (noch) an validen Definitionen fehlt, werden wir uns an das Thema anhand von vielen Einzelschicksalen von Angekommenen und Nicht-Angekommenen langsam herantasten.
Im zweiten Teil geht es um die Hindernisse, die uns vom Ankommen abhalten. Wer ankommen will, der muss irgendwann aufbrechen. Doch viele grobe Steinbrocken, die uns blockieren und ausbremsen, stehen diesem Aufbruch im Wege. Sie sind der Grund, warum so viele Menschen sitzen bleiben auf ihrer Couch, in ihrer Komfortzone, und niemals ankommen. Diese Hindernisse zu identifizieren und zu analysieren wird dabei helfen, den Aufbruch zu wagen.
Der dritte Teil des Buches wird sich mit der Reise beschäftigen. Es geht um die Fertigkeit, die auftauchenden Steine beständig aus dem Weg zu räumen, um in Bewegung zu bleiben. Der Mensch auf dieser Reise gewinnt an Stärke, Ausdauer und Sicherheit, je länger er auf dem Weg ist. Er reift an Schwierigkeiten und Widerständen und wächst durch Erfahrung und Übung in der Klugheit.
Im vierten und letzten Teil des Buches schließlich wollen wir uns dem Zustand des Ankommens widmen. Wie eine lebensechte Statue aus Marmor, die aus einem formlosen Block entsteht, konnte die Vorstellung des Ankommens allmählich Form annehmen. Man weiß, was es braucht, um aufzubrechen. Was notwendig ist, um die Reise zu meistern. Und wie es sich anfühlen könnte, diesen Zustand des Ankommens zu erreichen.
Ein wichtiger Hinweis für das Lesen dieses Buches: Die Termini »Angekommen-Sein« und »Nicht-angekommen-Sein« sind keine Diagnose, die der Psychiater wertend verteilt wie der Schiedsrichter die gelben Karten. »Nicht-angekommen-Sein« ist vielmehr eine leidvolle Selbstdiagnose. Die Kunst des Ankommens hingegen ein langfristiger innerer Prozess, ein Erblühen der Innerlichkeit. Dieser wird erst mit der Zeit auch äußerlich wahrnehmbar. Gute Psychotherapie nimmt dabei eine dienende Funktion ein. Sie ist streng auftragsorientiert: Das Problem – also der »Auftrag« an den Therapeuten – wird dabei allein vom Patienten (oder Klienten) wahrgenommen und formuliert. In der psychotherapeutischen Arbeit wird auf dieser Basis mithilfe des Psychiaters eine Lösung gesucht. »Ankommen« oder das Fehlen davon ist also ein Ziel oder ein Defizit, das allein der Betroffene selbst bestimmt.
TEIL IDas ProblemWarum das Ankommen zum Thema wurde
KAPITEL 1Entfremdet durchs Leben: Das permanente Gefühl, »lost« zu sein
Jay Gatsby erschafft sich im New York City der 1920er-Jahre eine neue Identität und arbeitet unermüdlich daran, seine Träume von Reichtum, Ansehen und Liebe zu verwirklichen. Er ist ursprünglich als James Gatz in einfachen Verhältnissen in North Dakota geboren und aufgewachsen, doch keiner weiß das. Er hat immensen Erfolg und steigt groß auf – aber trotzdem bleibt er innerlich unvollständig und unerfüllt. Er findet seinen Platz nicht.
Gatsbys Leben wird von einer einzigen tief verwurzelten Sehnsucht bestimmt: der Liebe zu Daisy Buchanan, einer Frau aus der oberen Gesellschaftsschicht, mit der er vor vielen Jahren eine romantische Beziehung hatte. Diese Beziehung, die ihm damals als Inbegriff des Glücks erschien, wurde durch seine bescheidene Herkunft und Daisys Streben nach gesellschaftlicher Sicherheit zerstört. In den Jahren danach richtet Gatsby sein ganzes Leben darauf aus, das Vergangene zurückzuholen und Daisys Liebe wiederzugewinnen. Er häuft ein immenses Vermögen an, erwirbt ein prächtiges Anwesen in der Nähe von ihrem Haus und veranstaltet opulente Partys, in der Hoffnung, dass sie eines Tages wieder zu ihm findet.
Doch Gatsbys Streben nach dem Ankommen in Daisys Welt ist von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Trotz seines Reichtums bleibt er ein Außenseiter in den Kreisen, die er so sehr beeindrucken will. Die Menschen, die seine Partys besuchen, respektieren ihn nicht wirklich, für sie ist er lediglich eine Kuriosität, ein reicher Mann ohne echte gesellschaftliche Wurzeln. Seine Beziehung zu Daisy wird immer mehr von Illusionen geprägt. Gatsby idealisiert sie und ihre gemeinsame Vergangenheit so sehr, dass er die Realität ihrer gegenwärtigen Situation nicht sehen kann. Er hofft, die Zeit zurückdrehen zu können, doch Daisy ist längst weitergezogen und in eine Ehe mit Tom Buchanan gebunden, die sie trotz aller Probleme nicht aufgeben will.
Gatsbys unerfüllte Sehnsucht nach dem Ankommen manifestiert sich auch in seiner obsessiven Fixierung auf das grüne Licht am Ende von Daisy’s Dock, das er von seinem Anwesen aus sehen kann. Dort will er ankommen. Dieses Licht symbolisiert für ihn den unerreichbaren Traum, den er sich selbst geschaffen hat – einen Traum, der ihn antreibt, aber gleichzeitig unerreichbar bleibt. Es steht für das Ziel, das immer in greifbarer Nähe zu sein scheint, aber nie wirklich erreicht wird.
Im Laufe der Handlung wird deutlich, dass Gatsbys Traum von einem glücklichen, erfüllten Leben mit Daisy reiner Selbstbetrug ist. Die Gesellschaft, in die er verzweifelt aufgenommen werden möchte, ist oberflächlich und korrupt, und Daisys Gefühle für ihn sind nicht stark genug, dass sie dafür ihren sozialen Status riskieren würde. Trotz seiner Bemühungen gelingt es Gatsby nicht, die Schranken der Klassengesellschaft zu durchbrechen und einen echten Platz in Daisys Leben zu finden. Seine Partys, sein Reichtum, seine ganze Existenz – alles ist darauf ausgerichtet, einen Traum zu verwirklichen, der niemals Wirklichkeit werden kann. Er ist nie gelandet, hat nie seine innere Heimat gefunden.
Gatsbys Scheitern wird schließlich mit seinem tragischen Tod besiegelt. Nachdem er fälschlicherweise für den Tod von Myrtle Wilson verantwortlich gemacht wird, erschießt ihn deren Ehemann George Wilson. In seinem Tod offenbart sich die ganze Tragik seines Lebens: Niemand, außer seinem Freund Nick Carraway, zeigt echtes Mitgefühl oder Trauer. Das Leben, das er sich aufgebaut hat, fällt in sich zusammen wie ein Kartenhaus. Jay Gatsby ist niemals angekommen, hat niemals Heimat gefunden, weder im Leben noch im Tod.
Der große Gatsby von F. Scott Fitzgerald gilt heute als eines der bedeutendsten US-amerikanischen Werke des zwanzigsten Jahrhunderts, obwohl es zu Lebzeiten des Autors eher ein Ladenhüter war. Die Verfilmung aus dem Jahr 2013 mit Leonardo DiCaprio in der Hauptrolle war ein Riesenerfolg und wurde zudem mit zwei Oscars bedacht.
Die große Sehnsucht
Begriffe wie »Ankommen« oder »Heimat finden« sind zuallererst die große Sehnsucht derer, die sich nicht angekommen fühlen. Leute wie Jay Gatsby. Sie assoziieren damit das Gegenteil des Gefühlszustandes, in dem sie sich momentan befinden. Man könnte es eine negative Projektion nennen. Das Positive dabei? Aus diesem Leidensdruck entsteht die Bereitschaft, etwas zu verändern, um anzukommen. Doch häufig enden solche Bemühungen in einer Sackgasse, weil man sich mit der falschen Wanderkarte auf den Weg gemacht hat.
Das ist auch nicht weiter verwunderlich, denn der Begriff des Ankommens ist unpräzise. Ihn umgibt ein nebulöser Schleier. Was der Kirchenvater Augustinus über die Zeit sagte, gilt auch für das Ankommen: »Wenn ich nicht gefragt werde, was die Zeit ist, dann weiß ich es. Wenn ich aber gefragt werde, dann kann ich es nicht sagen.« Jeder hat intuitiv eine Empfindung dazu, aber eine präzise Definition kann niemand geben. Die Begrifflichkeiten liegen im Dunkeln. Selbst in der psychologisch-psychiatrischen Fachliteratur finden sich keine klaren Definitionen des »Ankommens« oder des »Nicht-angekommen-Seins«, obwohl diese Gefühlszustände in der Zwischenzeit in aller Munde sind. Ein Defizit, das das Thema noch attraktiver macht. Das »Nicht-angekommen-Sein« ist jedenfalls der Ausgangspunkt, von dem aus man die Sehnsucht nach dem Ankommen entdecken kann. Hier muss unsere Suche beginnen.
Sich einer unbekannten Sache durch die Betrachtung seines Gegenteils zu nähern, hat durchaus Tradition. Im Mittelalter versuchten Theologen wie Nikolaus von Kues, Gott zu beschreiben, und standen ebenso vor dem Problem, etwas so Gewaltiges begrifflich zu bestimmen. Sie entwickelten daraufhin das Konzept der Negativen Theologie, das versucht, zu definieren, was Gott nicht ist. Ähnliches gilt für das Ankommen: Es ist leichter, zu erfassen, warum Menschen nicht ankommen, als eine allgemeingültige Definition dafür zu geben, was das Ankommen nun genau ist. Diesen analytischen Weg werden wir beschreiten.
Am besten entwickelt man dieses unentwickelte Thema – ein neues Forschungsgebiet – durch die präzise Beschreibung der Seelenzustände der Betroffenen. Grundlage dieses Kapitels ist dabei ein YouTube-Aufruf, einen persönlichen Fall und seine Gedanken einzureichen, dem Hunderte Menschen gefolgt sind. Der Sinn dahinter war, eine breite Basis zu schaffen, um die diffusen Gefühle authentisch einzufangen.
Was die Schwarmintelligenz zusammentrug
Wie beschreiben Menschen, die sich nicht angekommen fühlen, ihren Zustand? Wörter, die bei der Selbstbeschreibung in den Zuschriften immer wieder fielen, sind: heimatlos, rastlos, zerrieben, desillusioniert, schwankend, verloren, ruhelos, entwurzelt, zerrissen durchs Leben gehen, keinen festen Halt haben, Enttäuschung über gescheiterte Beziehungen erleben, in ständiger Unruhe nach dem nächsten Kick suchen, das Fehlen eines festen Zuhauses spüren, ungeborgen und ziellos umherwandern, sich selbst von wichtigen Lebensereignissen ausschließen, die traurige Einsicht, dass flüchtige Vergnügungen keine Erfüllung bringen, nirgendwo wirklich dazugehören, das schmerzhafte Bewusstsein, wahre Nähe und Geborgenheit zu vermissen, unsicher und heimatentfremdet sein, von Schuldgefühlen gegenüber den Kindern geplagt werden, oberflächliche Beziehungen ohne tiefere Verbindung einzugehen, sich unwohl in der eigenen Haut zu fühlen, den Verlust von Vertrauen und Respekt der Familie spüren, die Angst, im Alter allein und ohne Unterstützung dazustehen, Leere nach vergänglichen Affären, unruhig und haltlos sein, Schuldgefühle, die Kindheit der eigenen Kinder verpasst zu haben, Einsamkeit trotz vieler Bekanntschaften, sich unerfüllt, unbeständig, suchend, getrieben, isoliert, desorientiert, verunsichert, unverbunden, unvollständig, fremd, unstet, orientierungslos, ruhelos, entfesselt, beziehungslos fühlen …
Die Sammlung dieser emotionalen Farbkleckse zeichnet schon einmal gleich dem Rohrschach-Test ein erstes intuitives Bild, ein sehr stimmiges Bauchgefühl. Es wird in der Folge Aufgabe des Verstandes sein, diese erste intuitive Wahrnehmung zu analysieren und zu einer konkreten Idee zu verdichten.
Doch suchen wir weiter: Wer sind diese Menschen, die das Gefühl haben, in vielfacher Weise nicht anzukommen? Die das quälende Gefühl haben, verloren zu sein, emotional heimatlos, fehl am Platz, eben »lost«? Wie zeigt sich dieses »Lost-Sein« heutzutage im konkreten Leben? Was sind die Sehnsüchte dieser Personen, wie haben sie sich verstrickt? Wo haben sie sich verheddert?
Beispielhaft soll das an einigen realen Zeitgenossen anonymisiert beschrieben werden.
Der überforderte Vater
Abgesehen von den üblichen Ups and Downs führt der 45-jährige Christoph eine gute Ehe mit seiner Frau Kristin. Die beiden haben einen achtjährigen Sohn, mit dem es keine größeren Schwierigkeiten gibt. Nach außen sind sie eine richtige Vorzeigefamilie. Das einzige Problem: Der Vater weiß nicht, was er mit seinem Sohn anfangen soll. Es fällt ihm schwer, mit ihm zu spielen und sich auf ihn einzulassen. Er kann einfach nicht kindgerecht Vater sein. Kindergeburtstage sind ihm ein Graus und auf dem Spielplatz kommt er sich ziemlich deplatziert vor. Gesellschaftsspiele, die seine Frau hin und wieder auspackt, spielt er widerwillig mit, um nicht als Spielverderber dazustehen. Aber eigentlich ist das nichts für ihn. Aus diesem Grund hat er sich auch dem großen Wunsch seiner Frau versperrt, ein weiteres Kind zu bekommen. Das führt zu nicht unerheblichen Konflikten mit ihr, bei denen Christoph manchmal emotional wird und ihr bitter entgegenwirft: »Vielleicht hast du den falschen Mann geheiratet?«
Seine Welt sind Bücher, Reisen, Weltpolitik und intellektuelle Gespräche. Er wäre so gern wie andere Väter, die unbeschwert mit ihren Kindern toben und die Zeit mit ihnen genießen. Aber er kann es nicht. Er fühlt sich unzulänglich. Einmal war er mit seinem Sohn im Zirkus und blickte in dessen strahlende Kinderaugen. Natürlich ließ er seinem Kleinen die Freude, aber eigentlich fand er die drittklassigen Scherze des Clowns nur peinlich.
An einem Wochenende ist er schließlich mit seinem Sohn allein. Seine Frau hat sich mit ihrer Freundin in einem Wellnesshotel verabredet. »Das ist doch toll, dann habt ihr zwei mal ein richtiges Papa-Wochenende«, sagt sie, bevor sie fährt. Am Samstagnachmittag greift er zum Handy, ruft einen seiner Freunde an und fragt, ob er nicht mit seinen Kids vorbeikommen möchte. »Wir machen eine schöne Flasche Wein auf, unterhalten uns, und die Kids können in der Zwischenzeit zusammen spielen.«
Christoph merkt, dass er sich seinem Sohn immer mehr entfremdet und dass sein Sohn die Distanz des Vaters spürt. Der Kleine erwartet schon keine väterliche Aufmerksamkeit mehr, wendet sich seinen Freunden und dem Spielzeug zu. Um den Sohn zu beschäftigen, hat Christoph ihm ein Smartphone gekauft und erlaubt dem Kind großzügig, Filme zu sehen und Onlinespiele zu spielen. Alles, nur keine Zuwendung! Gleichzeitig fühlt sich Christoph erbärmlich: So hat er sich sein Vater-Sein nicht vorgestellt. Wenn das alles nicht so anstrengend wäre!
Analyse: Christoph ist biologisch Vater geworden, aber er ist in dieser Aufgabe niemals angekommen. Er spürt den Mangel und leidet darunter, kann es aber scheinbar nicht ändern, weil er weder Neigung noch Eignung zur Vaterschaft verspürt. Er versperrt sich aus dieser Erfahrung des Scheiterns auch einem weiteren Kind. Dass man Vaterschaft durch Einüben lernen kann, ist ihm fremd.
Die Frau, die sich ständig neu definiert
Julia (41) hat in ihrem Leben unzählige Berufe angefangen, ist aber bei keinem geblieben. Nach ihrem Realschulabschluss in Hamburg will sie zunächst Fremdsprachenkorrespondentin für Spanisch werden, scheitert aber an den hohen Anforderungen. Danach beginnt eine Odyssee durch alle möglichen Berufe und Aushilfsjobs.
Ihr großes Ziel ist immer die Selbstständigkeit. Sie will sich nicht ihr ganzes Leben lang sagen lassen, was sie zu tun und zu lassen hat. Sich irgendwo einzuordnen, war noch nie ihr Ding. Sie nimmt einen Kredit auf, beginnt eine Ausbildung zur Heilpraktikerin und richtet sich eine Praxis ein. Der Erfolg bleibt aus. Für ihre Konzepte der Entgiftung und basenbasierten Ernährung interessiert sich kaum jemand. Das kann doch nicht sein, denkt sie immer, die Menschen müssen doch erkennen, dass sie sich anders nur ihre Gesundheit ruinieren. Nach zwei Jahren gibt sie die Praxis wieder auf und sattelt auf Fitnesstrainerin um – wenigstens irgendetwas mit Gesundheit! Das Geld für die Ausbildung leiht sie sich dieses Mal von ihren Eltern. Auch dieser Traum zerplatzt. Diesmal ist Corona schuld.