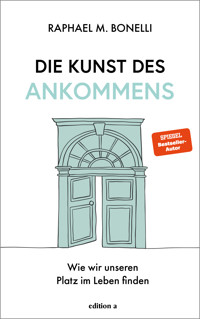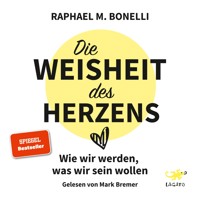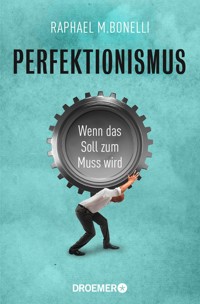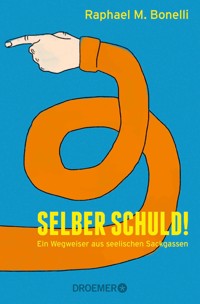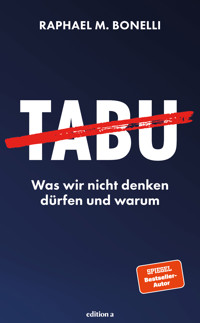
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: edition a
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Wer entscheidet, was tabu ist? Wenn ein Tabu gebrochen wird, reagiert die Gesellschaft oft mit Empörung und Wut. Unbewusste Abwehrmechanismen spielen dabei eine zentrale Rolle. Warum ist es plötzlich verboten, das Offensichtliche zu denken? Mit erhellenden Analysen deckt Psychiater und Neurowissenschaftler Raphael M. Bonelli die Bruchlinien einer Gesellschaft auf, die sich selbst als frei und tolerant versteht und doch keinen Raum für abweichende Meinungen lässt. Eine Gesellschaft, die damit Gefahr läuft, genau jene Freiheit zu verlieren, die sie zu verteidigen vorgibt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 149
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Beliebtheit
Ähnliche
TABU
Raphael M. Bonelli:
Tabu
Alle Rechte vorbehalten
©2025 edition a, Wien
www.edition-a.at
Cover: Thomas Breit
Satz: Bastian Welzer
Gesetzt in der Premiera
Gedruckt in Deutschland
1 2 3 4 5 — 28 27 26 25
isbn: 978-3-99001-826-2
eisbn: 978-3-99001-827-9
Raphael M. Bonelli
TABU
Was wir nicht denken dürfen und warum
edition a
INHALT
KAPITEL 1 Der Fall der woken Mauer
Angst vor den eigenen Wählern
Die Weisheit der Bürger
KAPITEL 2 Was ein Tabu ausmacht
Die archaischen Tabus
Die Psychoanalyse des sinnlosen Tabus
Tabus: Nützlich, aber auch absurd
Wann Tabus hinterfragt werden müssen
Tabus und die Sakralisierung von Herrschaft
Das Tabu als Instrument der Herrschaft
KAPITEL 3 Tabus, die keiner braucht
Das Migrations-Tabu
Das demografische Tabu
Das Gender-Tabu
Das Klima-Tabu
Das Abtreibungs-Tabu
Das Corona-Tabu
Das Gottes-Tabu
KAPITEL 4 Wie Tabus tabu bleiben
Verdrängung, Verschiebung und Verleugnung: Die Rolle des Unbewussten bei der Erhaltung von Tabus
Rationalisierung und Intellektualisierung
Moral Licensing und kognitive Dissonanz
Täter-Opfer-Umkehr
Framing, Gatekeeping und kognitive Verzögerungstaktik
Der neue Anstand: Wie aus wenigen viele Tabus wurden
KAPITEL 5 Wie Tabus tabu werden
Logische Fehler
Ablenkung und Vermeidung
Appell an Gefühle
Falsche Tatsachen und Irreführung
Ausnutzung menschlicher Verhaltenstendenzen
Stil im Sprechen und Schreiben
Berufung auf den »gesunden Menschenverstand«
KAPITEL 6 Dysfunktionale Tabus identifizieren und mit ihnen umgehen
Der heilige Ursprung der funktionalen Tabus
Wem nützt ein Tabu?
Tabus schützen das innere Heiligtum
Ein Heilmittel gegen falsche Tabus: Der offene Dialog
KAPITEL 7 Paradigmenwechsel: Die Tabu-Gesellschaft verabschiedet sich
Die Gesinnungsethik
Das Paradigma wandelt sich: Gefahren und Chancen der Tabubrüche
Für meine Vici
…die beste Ehefrau, die ich mir vorstellen kann
VORWORT
Die Heiligkeit des Verbots
Es war das Jahr 1777. Das Segelschiff »Resolution« schaukelte im nächtlichen Blau der Südsee, während dessen Kapitän, James Cook, sich seinem Tagebuch widmete. Die Eindrücke, die er beim letzten Zwischenstopp auf den Tonga-Inseln sammelte, waren ihm noch in lebhafter Erinnerung. Beim dämmrigen Licht einer Öllampe setzt der britische Weltumsegler seine Feder auf das Papier und schreibt: »Taboo in general signifies forbidden« – »Tabu bedeutet im Allgemeinen verboten«. Für die Tongaer bedeutete »tabu« allerdings mehr als ein schlichtes Verbot. Tabu bezeichnete etwas als unantastbar und heilig – sei es aus hygienischen, sozialen oder religiösen Gründen. So begann die Reise des polynesischen Wortes in unsere europäischen Sprachen.
Wie es mit geflügelten Worten so ist, verlieren sie schnell ihren tieferen Sinn. Der Alltagsgebrauch macht sie profan und oberflächlich. Ein Tabu zu brechen, wurde gleichbedeutend mit Fehltritt, Fauxpas oder Ungeschicklichkeit. Mehr als hundert Jahre nach dem Einzug des Begriffs in unsere Sprache herrschte die Tabuisierung der Sexualität durch den Viktorianismus. Als Reaktion darauf machte sich Sigmund Freud, der Begründer der Psychoanalyse, tiefere Gedanken über den psychologischen Hintergrund des Tabus.
Freud war sein Leben lang von Tabus fasziniert, weil sie unbewusste Begierden repräsentieren, sein ausgesprochenes Steckenpferd. 1913 erschien seine Schrift Totem und Tabu. In dieser Sammlung von Essays spricht Freud den Tabus kategorisch jegliche Nützlichkeit ab:
»Die Tabuverbote entbehren jeder Begründung, sie sind unbekannter Herkunft; füruns unverständlich, erscheinen sie jenenselbstverständlich, die unter ihrer Herrschaftleben.«
Kurz: Tabus sind irrational und sinnlos. Wir werden sehen, dass er hier zu wenig differenzierte.
Freud erfasst aber ein entscheidendes Merkmal: Das Tabu bezeichnet zwar das strikt Verbotene, unterscheidet sich aber von schriftlichen Gesetzen oder Verhaltensnormen. Im Kern deutet Tabu auf etwas Unaussprechliches hin – etwas, das aus instinktiven, vorrationalen Haltungen des Ekels oder auch der Ehrfurcht hervorgeht. Damit zeichnet sich das Tabu durch eine seltsame Ambivalenz aus: Zum einen meint es das Heilige, Reine und Erhabene, zum anderen das genaue Gegenteil, nämlich das zu Meidende, Unreine und Falsche. Beiden Wahrnehmungen gemeinsam ist, dass sie Abstand zum tabuisierten Objekt verlangen.
Unmittelbar nach Freud kam es zu einem historisch unvergleichlichen Tabubruch durch das Dritte Reich. Der Holocaust, die Vernichtung des jüdischen Lebens in Europa, brach das Tötungsverbot in einer noch nie dagewesenen Weise. Hitler hasste die bürgerliche Moral und die religiöse Tradition. Der radikale Tabubruch durch das entmenschlichende Euthanasieprogramm musste von den NS-Machthabern sogar geheim gehalten werden. Als der tapfere Bischof von Münster, Clemens August Graf von Galen, das Verbrechen 1941 aufdeckte, musste Hitler trotz seiner gigantischen Propagandamaschinerie die eugenischen Morde einstellen, weil er eine Abwendung der Bevölkerung fürchtete. Trotz des faschistischen Zeitgeistes behielten noch viele Menschen ihr Gespür für das absolut Verbotene, das Tabu. Aber die Nazis brachen nicht nur herkömmliche Tabus, sie erfanden und propagierten neue Tabus, um das Volk zu manipulieren und zu unterwerfen: Rassenwahn, Gleichschaltungspolitik, eine entartete Kunst-Ideologie und die Inhaftierung Andersdenkender waren an der Tagesordnung. Der NS-Staat versuchte, durch diese Tabuisierung das Denken seiner Untertanen bis in ihre kleinste Idee zu kontrollieren.
In der Nachkriegszeit wurden die traditionellen bürgerlichen Tabus zunächst rehabilitiert und die Gesellschaft damit stabilisiert. Europa besann sich wieder der christlichen Werte. Doch bald regte sich erneut Widerstand: Die 68er-Generation war bestrebt, jegliche gesellschaftlichen Konventionen, die sie als »bürgerlich« und »spießig« erachtete, zu zertrümmern. Dazu gehörten auch zahlreiche Tabus rund um Höflichkeit, Treue, Sexualität und Anstand. Doch verschwunden sind Tabus mit der sexuellen Revolution mitnichten. Sie wurden nur ausgetauscht. Die wenigen alten Tabus, die lange Zeit als unverrückbar galten, wichen einer Vielzahl neuer, wiederum irrationaler Denkverbote.
Es wurde dann zwar möglich, paraphile Sexualitäten im öffentlichen Raum ungehemmt auszusprechen und freizügig darzustellen, aber Blackfacing, Vaterlandsliebe, Deadnaming, Misgendern, »Leugnen« des Klimawandels, Zigeunerschnitzel, Bodyshaming, der Unterschied zwischen Mann und Frau, Mohr im Hemd, religiöse Einstellungen oder das »N-Wort« sind in der Zwischenzeit dermaßen schambehaftet, dass Letzteres selbst in einem Buch über Tabus nicht ausbuchstabiert werden kann.
Und es werden täglich mehr. Wie das ungeordnete, dysfunktionale Wachstum eines Krebsgeschwürs wuchern die neuen Tabus zu erdrückender Größe und beeinträchtigen zunehmend den Alltag des Normalbürgers.
Tatsache ist: Wir stehen heute vor einer Überfülle von unnötigen Tabus.
Tabus, die keiner braucht.
Alle Machthaber bedienen sich heute der Manipulationstechnik der Tabuisierung, von Putin bis Erdogan, vom chinesischen Reich der Mitte bis zu den liberalen Demokratien Europas. Ein Kampf tobt um Desinformation, Framing, Fake News, Mind Control, Denkverbote und Meinungsfreiheit. Nüchterne Beobachtungen, logische Schlussfolgerungen und das Aussprechen des Offensichtlichen fallen oft der inneren Zensurschere anheim: Man verbietet sich im vorauseilenden Gehorsam das Wahrnehmen und Denken. In Russland ist ein Angriffskrieg kein Krieg, sondern eine »militärische Spezialoperation«. Nach Kindsmorden und Gruppenvergewaltigungen durch Asylwerber reagiert in Deutschland die Masse reflexartig mit Protesten gegen rechts. Wir empfinden zwar ein Störgefühl, wenn Männer beim Frauenboxen Frauen verprügeln, aber das Gefühl unterdrücken wir – weil wir Angst haben, der »Transphobie« bezichtigt zu werden. Tabuisierte Meinungen werden nicht kritisiert, sondern pathologisiert.
Wir sind im postfaktischen, im postrationalen Zeitalter angekommen und historisch sind solche Zeiten immer die Brutstätte für neue irrationale Tabus gewesen.
Menschen, die unbedacht oder unwissentlich den stark angewachsenen »Index Librorum Prohibitorum« verletzen, sehen sich mit Aggression, Diffamierung und Ausgrenzung konfrontiert. Der übergriffige Moralismus unserer Zeit fühlt sich immer mehr an wie der Gesinnungsterror der Jakobiner.
Doch es scheint, dass jetzt endlich der Mehrheit der normalen Bürger das Korsett zu eng geschnürt wurde, sodass das Pendel nun in die andere Richtung schwingt: Sprachverbote ziehen nicht mehr. Die Nazi-Keule glaubt keiner mehr. Der kritische Geist erwacht. Wir erleben soeben die Implosion der überflüssigen Tabus!
Dieses Buch nimmt sich kein Blatt vor den Mund. Es geht darum, die »Mechanismen« des Tabus aufzudecken und herauszufinden, wie sie in der Gegenwartskultur wirken. Tabus – egal ob tradiert oder trendig – können und müssen kritisch hinterfragt werden. Das Ziel ist aber nicht, alle Tabus über Bord zu werfen. Keine Gesellschaft kommt ohne Tabus aus. Doch es soll der Versuch gewagt werden, die Spreu vom Weizen zu trennen – die nützlichen von den überflüssigen Tabus.
Lasst uns endlich die Tabus entlarven, die keiner braucht.
KAPITEL 1 Der Fall der woken Mauer
»Die Bedrohung, die mich in Bezug auf Europa am meisten beunruhigt, ist nicht Russland, nicht China. Was mich beunruhigt, ist die Bedrohung von innen: der Rückzug Europas von einigen seiner grundlegendstenWerte.«
Als diese Worte von J. D. Vance am 14. Februar 2025 über Internet und Medien durch ganz Deutschland verbreitet wurden, reagierten die Menschen erst einmal mit Schock. Einige dachten empört: Das darf man doch nicht sagen! Das ist unerhört! Die Politiker und etablierten Medien überschlugen sich in einhelliger Entrüstung.
Doch die meisten Menschen dachten lächelnd: Das darf man doch nicht sagen! Das ist großartig! Endlich sagt es einer! Wenn ich das sage, steht die Polizei vor meiner Tür … Für diese Leute war die Rede des Amerikaners wie ein unerwarteter strahlend blauer Himmel nach wochenlangem dichtem Nebel. Was war passiert?
Auf der Münchner Sicherheitskonferenz sprach der US-Vizepräsident über die aus seiner Sicht größte Bedrohung für Europas Frieden. Und das seien nicht äußere Gefahren, sondern der Verlust der Meinungsfreiheit, für deren Etablierung Europa viele Jahrhunderte lang kämpfte. Ohne das Wort zu benutzen, beschrieb Vance genau das, wovon dieses Buch handelt: die Tabuisierung der anderen Meinung und die systemische Ausgrenzung von Andersdenkenden. Dass Vance möglicherweise im Glashaus sitzt und mit Steinen wirft, liegt auf der Hand: Man sieht zwar den Splitter im Auge des Bruders, aber den Balken im eigenen Auge erkennt man nicht. Dass in den USA auch nicht alles perfekt läuft, schmälert allerdings nicht den Wahrheitsgehalt seiner Aussage. Betrachten wir für einen Moment diesen Splitter, denn als Europäer sind wir ja unmittelbar davon betroffen. Bezüglich der Einmischung anderer Staaten in europäische Wahlkämpfe sagte Vance:
»Wenn Ihre Demokratie von ein paar hunderttausend Dollar digitaler Werbung aus einemfremden Land zerstört werden kann, dannwar sie von Anfang an nicht sehr stark. Diegute Nachricht ist, dass ich glaube, dass IhreDemokratie weit weniger zerbrechlich ist, alsviele zu befürchten scheinen. Und ich glaube, dass sie noch stärker wird, wenn wir unserenBürgern erlauben, ihre Meinung zu äußern.«
Dieser letzte Satz ist besonders bedeutsam, denn darin impliziert Vance, dass es den Bürgern Europas eben nicht erlaubt ist, ihre Meinung frei zu äußern. Er selbst brachte einige Beispiele für Meinungen, die auf die eine oder andere Weise ausgeschlossen werden. Da wäre das Beispiel von Adam Smith-Connor, der in Großbritannien vor einer Abtreibungsklinik ein stummes Gebet verrichtete, um seinem Sohn Jacob zu gedenken, der nie das Licht der Welt erblickte, weil seine frühere Freundin sein Kind abgetrieben hatte. Die britische Polizei nahm ihn fest, da er mit seinem stillen Gebet die Entscheidung einer Frau, ihr Baby abzutreiben, beeinflussen könnte. Dabei hatte Smith-Connor keine Transparente, Schilder oder Sprechchöre mitgebracht, sondern bloß seine Gedanken, die um sein eigenes Schicksal und das seines ungeborenen Sohnes kreisten. Doch bereits dies war, wie Vance es in Anlehnung an den großen britischen Dystopen George Orwell nannte, ein »Gedankenverbrechen«, das geahndet wurde. Denn es waren Gedanken, die im herrschenden gesellschaftlichen Klima ein Tabu berührten: »Abtreibung tötet einen ungeborenen Menschen.«
Es geht wohlgemerkt nicht darum, ob Smith-Connor richtig oder falsch liegt. Es geht einzig um die Frage, ob er diese Meinung vertreten darf. Und offenbar durfte er sie nicht vertreten, zumindestens nicht dort. So wie zahlreiche schottische Haushalte, die im Umkreis von zweihundert Metern (»Pufferzone«) um eine Abtreibungsklinik leben und die vor kurzem einen Brief der Regierung erhielten. In dem Brief wurden die Bewohner aufgefordert, Aktivitäten innerhalb ihrer eigenen vier Wände zu unterlassen, die von außen hörbar seien – zum Beispiel ein Gebet – und so eine abtreibungswillige Passantin zum Nachdenken bringen könnten. Auf diese Weise werden Tabus aufgestellt, um die Meinungs- und Glaubensfreiheit radikal zu unterdrücken.
Angst vor den eigenen Wählern
Ein weiteres unaussprechliches Tabu sprach Vance ganz ungeniert an – das vielleicht größte, das ebenfalls zurzeit zu bröckeln beginnt:
»Und von allen dringenden Herausforderungen, denen sich die hier vertretenen Nationengegenüberstehen, ist meines Erachtens keinedringender als die Massenmigration.«
Vance berührt hier das Problem, dass die etablierten Parteien »Angst vor den Wählern« hätten. Denn deren Meinungen verletzten Tabus, die über Jahrzehnte in die Gesellschaft eingesickert waren. Viele fühlen sich durch diese willkürlichen Tabus verunsichert. Was darf ich eigentlich noch sagen? Worüber sollte ich lieber nicht sprechen? Was sollte ich am besten gar nicht denken? So kam es, dass Vance Themen aufgriff, die den meisten Menschen völlig logisch erschienen, über die sie sich aber nicht zu sprechen trauten. Noch nicht. Denn die Zeiten ändern sich, dafür ist nicht zuletzt der Wahlsieg von Donald Trump und J. D. Vance ein Symptom. Sie gewannen ihre Wähler, weil sie jene überfälligen Tabus, die sich zwischen politische Eliten und die Bürger geschoben hatten, durchbrachen. Vance versprach in München:
»Unter der Führung Donald Trumps werdenwir vielleicht nicht mit Ihren Ansichten übereinstimmen, aber wir werden für Ihr Rechtkämpfen, Ihre Meinung öffentlich zu äußern, egal ob wir miteinander übereinstimmenoder nicht.«
Ob Vance tatsächlich Wort halten wird, wird die Zeit zeigen. Die Beschneidung der Behörden durch Elon Musk, das Aussperren kritischer Presse oder der Eklat rund um den Besuch des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj am 28. Februar 2024: Es gibt einige umstrittene Maßnahmen der Trump-Regierung, die dem Selbstanspruch nicht zu genügen scheinen.
Was allerdings nicht ausschließt, dass Vance’ Argumente in München zutreffen. Es scheint so: Als Facebook in den USA die Zusammenarbeit mit externen »Faktencheckern« beendete, empörten sich hierzulande viele. Aber nicht etwa darüber, dass sie selbst ihre Meinung dort nicht mehr sagen konnten, sondern dass die Meinung von Andersdenkenden wieder sichtbar sein sollte, die doch verboten gehört.
Um den Verlust der Meinungsfreiheit zu unterstreichen, machte Vance provokant auf eine terminologische Anleihe Europas von der früheren Sowjetunion aufmerksam:
»[…] Wenn Sie sich jene Seite in diesem Kampfanschauen, die Dissidenten zensierte, dieWahlen annullierte, dann waren sie sicherlichnicht die Guten. Und Gott sei Dank haben sieden Kalten Krieg verloren.« Er fügte hinzu:»[…] Manchmal ist nicht so klar, was mit einigen der Gewinner des Kalten Kriegs passiertist. […] Ob sich hinter den hässlichen Wörternaus der Sowjetzeit wie ›Desinformation‹ und›Fehlinformation‹ alte festgefahrene Interessen verbergen, die es einfach nicht mögen, wenn jemand mit einer alternativen Sichtweise eine andere Meinung äußert oder – Gottbewahre – anders abstimmt oder – schlimmernoch – eine Wahl gewinnt.«
In diesem Buch soll es nicht darum gehen, die politischen Positionen dieser Rede zu bewerten. Vielmehr soll aus psychologischer Sicht analysiert werden, warum die deutsche Presse mit so heftiger Empörung und Ablehnung reagierte. Die »Tagesschau« schrieb: »Eine beispiellose Abrechnung mit Europa«. Ex-Kanzler Olaf Scholz von der SPD sagte kurz darauf: »Was dort gesagt wurde, ist völlig inakzeptabel.« Der Kanzlerkandidat der Union, Friedrich Merz, sagte: »Ich verbitte mir solche Einmischungen in die deutsche Bundestagswahl und auch in die Regierungsbildung danach! Ich lasse mir doch nicht von einem amerikanischen Vizepräsidenten sagen, mit wem ich hier in Deutschland zu sprechen habe.«
Offenbar traf Vance einen wunden Punkt. Er berührte mit seiner unverblümten Rede zentrale Tabus des europäischen Establishments. Jene, die über die Deutungshoheit dieser Tabus verfügen, die regierenden Politiker und die Leitmedien, reagierten darauf mit Entrüstung und Ablehnung. Sogar von einem Ende der amerikanischdeutschen Freundschaft war die Rede. Die aggressive Abwehr der Medien zeigt, dass die woke Mauer zu bröckeln beginnt. Die Cancel Culture frisst ihre Kinder.
Denn Vance ist mit seiner Meinung nicht allein. Vor kurzem errang der ehemalige Talkshow-Star Thomas Gottschalk mit seinem Buch, das den passenden Titel »Ungefiltert« trägt, landesweit Aufmerksamkeit. Darin schreibt er, das Gefühl zu haben, vieles nicht mehr offen sagen zu dürfen. Dass er sich einer Vielzahl von neuen gesellschaftlichen Regeln und Fallstricken gegenübersieht. Dass man heutzutage nicht mehr alles sagen könne, ohne gesellschaftliche Ächtung zu riskieren. Die Reaktionen fielen aus, als hätte Gottschalk im Buch mit Mord gedroht. Ein »alter weißer Mann« sei er, sexistisch sowieso, seine Zeit schon längst vorbei, am besten er hätte gar nichts gesagt. Was sein Gefühl, vieles nicht mehr sagen zu dürfen, wohl bestärkt hat.
Eine Episode der CBS-Dokuserie »60 Minutes« begleitete ein Team von deutschen Beamten, die Razzien bei Personen durchführten, die online der Hassrede verdächtigt wurden. Staatsanwalt Frank-Michael Laue erklärt darin, dass es eine größere Strafe sei, das Handy – ohne Verurteilung, wohlgemerkt! – an die Behörden zu verlieren, als später möglicherweise verurteilt zu werden und eine Strafzahlung leisten zu müssen. In den USA herrschte in der öffentlichen Diskussion Entsetzen darüber, wie unverblümt sadistisch die drei Beamten sich über das Erschrecken der Opfer lustig machten, wenn sie wegen einem harmlosen Online-Posting einschritten.
Solch eine Razzia wurde unter anderem im November 2024 bei einem Rentner in Deutschland durchgeführt, der den damaligen Minister Robert Habeck (Grüne) online als »Schwachkopf« bezeichnet hatte. Habeck hatte zuvor eine KI-Firma beauftragt, alle Beleidigungen gegen ihn systematisch zu suchen und anzuzeigen. So tauchte eines Tages die Polizei vor der Haustür des Rentners mit einem Durchsuchungsbeschluss auf und nahm seine digitalen Geräte mit, um sie zu überprüfen. Daraufhin gab es in Deutschland heftige Kritik an der Verhältnismäßigkeit solcher Hausdurchsuchungen und Razzien. Dienen diese Razzien bei nichtverurteilten Personen wirklich der Beweissicherung – wie vorgegeben wird – oder nicht vielmehr der Bestrafung und Einschüchterung, wie diese Staatsanwälte unvorsichtigerweise andeuteten? Wo ist die Grenze dessen, was man sagen darf? Und wie hart sollten Strafen ausfallen gegen jene, die sich nicht an diese Grenzen halten?
Ein weiterer Fall eines Tabubruchs stellte ein Banner der Fans von Bayer Leverkusen dar. Der Fußballclub wurde 2024 deutscher Meister. In einem Spiel gegen Werder Bremen im November 2023 war ein Banner in der Fankurve hochgezogen worden, auf dem folgende Provokation – weil Tabubruch – zu lesen war: »Es gibt viele Musikrichtungen, aber nur 2 Geschlechter!«
Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) verhängte daraufhin eine Geldstrafe von 18.000 Euro gegen den Bundesligisten. Offenbar fällt bereits die biologische Binsenweisheit, es gebe nur zwei Geschlechter, unter das Antidiskriminierungsrecht.
Was für seltsame Blüten dieses Gesetz treibt, zeigt auch der Fall Liebich. Sven Liebich ist ein bekanntes Mitglied der rechtsextremen Szene in Sachsen-Anhalt. Als er von zwei Gerichten zu einer Haftstrafe ohne Bewährung verurteilt wurde, unter anderem wegen Volksverhetzung und einem Angriff auf einen Fotografen, änderte er sein Geschlecht kurzerhand in weiblich und nennt sich nun Marla-Svenja Liebich. Durch das von der Ampelkoalition eingeführte Selbstbestimmungsgesetz ist eine behördliche Änderung des Namens wie des Geschlechts seit November 2024 möglich, ohne medizinische Gründe angeben zu müssen. Damit hofft »Frau« Liebich offenbar, in ein Frauengefängnis verlegt zu werden.