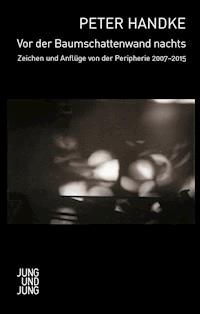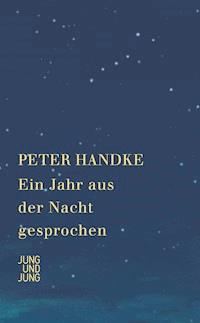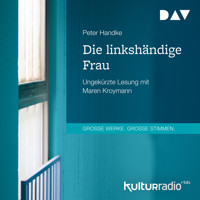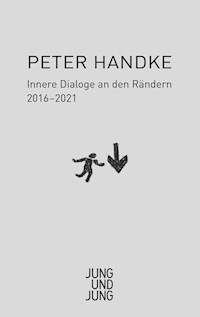7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
Die Erzählung Langsame Heimkehr endet, als das Flugzeug zur Landung auf dem Kontinent ansetzt. Der erste Satz der Lehre der Sainte-Victoire lautet: »Nach Europa zurückgekehrt, brauchte ich die tägliche Schrift und las vieles neu.« Aus Sorger, dem »Helden« der Langsamen Heimkehr, ist der Autor geworden, der sich nach dem Recht zu schreiben fragt. Nicht in Form eines Traktates, sondern als eine Erzählung von Wanderungen in der Provence – von den Auseinandersetzungen mit dem Mont Sainte-Victoire und dessen Abbildern, »Verwirklichungen«, auf den Gemälden Cézannes –, zum Mont Valérien in Paris oder »auf« den Havelberg in Berlin und – schließlich – im Morzger Wald bei Salzburg. Die zweite Begegnung mit der Sainte-Victoire und Cézanne, »dem Menschheitslehrer der Jetztzeit«, erlaubt es Handke, eine Poetik, seine Poetik, zu schreiben als die »Lehre« der Sainte-Victoire. Das »Recht, zu schreiben« gründet sich für ihn auf die Erfahrung des Zusammenhangs, der Verwandtschaft, zwischen dem Ich und den Dingen; Ziel des Autors Peter Handke ist es, »diesen Zusammenhang, in einer treuestiftenden Form!, weiterzugeben«.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 104
Ähnliche
Peter Handke
Die Lehre der Sainte-Victoire
Suhrkamp Verlag
für Hermann Lenz und Hanne Lenz, zum Dank für den Januar 1979
»Diesen Abend verspreche ich Ihnen ein Märchen, durch das Sie an nichts und an alles erinnert werden sollen.«
Goethe, Das Märchen
Der große Bogen
Nach Europa zurückgekehrt, brauchte ich die tägliche Schrift und las vieles neu.
Die Bewohner des abgelegenen Dorfes in Stifters Bergkristall sind sehr stetig. Wenn ein Stein aus einer Mauer fällt, wird derselbe wieder hineingesetzt, die neuen Häuser werden wie die alten gebaut, die schadhaften Dächer werden mit gleichen Schindeln ausgebessert. Augenfällig und einleuchtend erscheint solche Beständigkeit in dem Beispiel von den Tieren: »die Farbe bleibt bei dem Hause«.
Einmal bin ich dann in den Farben zu Hause gewesen. Büsche, Bäume, Wolken des Himmels, selbst der Asphalt der Straße zeigten einen Schimmer, der weder vom Licht jenes Tages noch von der Jahreszeit kam. Naturwelt und Menschenwerk, eins durch das andere, bereiteten mir einen Beseligungsmoment, den ich aus den Halbschlafbildern kenne (doch ohne deren das Äußerste oder das Letzte ankündigende Bedrohlichkeit), und der Nunc stans genannt worden ist: Augenblick der Ewigkeit. ‒ Das Gebüsch war gelber Ginster, die Bäume waren vereinzelte braune Föhren, die Wolken erschienen durch den Erddunst bläulich, der Himmel (wie Stifter in seinen Erzählungen noch so ruhig hinsetzen konnte) war blau. Ich war stehengeblieben auf einer Hügelkuppe der Route Paul Cézanne, die von Aix-en-Provence ostwärts zum Dorf Le Tholonet führt.
Das Unterscheiden und, noch mehr, das Benennen von Farben ist mir seit je schwergefallen.
Der ein bißchen mit seinem Wissen prunkende Goethe der Farbenlehre erzählt da von zwei Subjekten, in denen ich mich zum Teil wiedererkenne. Zum Beispiel verwechseln diese beiden »Rosenfarb, Blau und Violett durchaus«: nur durch kleine Schattierungen des Helleren, Dunkleren, Lebhafteren, Schwächeren scheinen sich solche Farben für sie voneinander abzusondern. Der eine bemerkt bei Schwarz etwas Bräunliches und bei Grau etwas Rötliches. Überhaupt empfinden die zwei die Abstufung von Hell und Dunkel sehr zart. ‒ Sie sind wohl krank, aber Goethe betrachtet sie noch als Grenzfälle. Freilich: Wenn man die Unterhaltung mit ihnen dem Zufall überlasse und sie über vorliegende Gegenstände befrage, so gerate man in die größte Verwirrung und fürchte, wahnsinnig zu werden.
Durch diese Anmerkung des Wissenschaftlers hat sich mir, über das bloße Wiedererkennen hinaus, ein Bild der Einheit zwischen meiner ältesten Vergangenheit und der Gegenwart gezeigt: In einem weiteren Augenblick des »stehenden Jetzt« sehe ich die Leute von damals ‒ Eltern, Geschwister, und sogar noch die Großeltern ‒ vereint mit den heutigen, wie sie sich über meine Farbenangaben zu umliegenden Dingen belustigen. Es erscheint geradezu als ein Familienspiel, mich die Farben raten zu lassen; wobei freilich nicht die anderen die Verwirrten sind, sondern ich.
Zum Unterschied von Goethes beiden Subjekten aber handelt es sich demnach bei mir nicht um eine Erbkrankheit. Ich bin in meinem Umkreis ein Einzelfall. Trotzdem habe ich mit der Zeit erfahren, daß ich nicht bin, was man gemeinhin farbenblind nennt, und auch nicht an einer besonderen Form dieser Störung leide. Manchmal sehe ich meine Farben, und es sind die richtigen.
Vor kurzem stand ich im Schnee auf dem Untersberggipfel. Knapp über mir, fast zum Angreifen, schwebte im Wind eine Rabenkrähe. Ich sah das wie ins Inbild eines Vogels gehörende Gelb der an den Körper gezogenen Krallen; das Goldbraun der von der Sonne schimmernden Flügel; das Blau des Himmels. ‒ Zu dritt ergab das die Bahnen einer weiten luftigen Fläche, die ich im selben Augenblick als dreifarbige Fahne empfand. Es war eine Fahne ohne Anspruch, ein Ding rein aus Farben. Durch sie sind aber die stofflichen Fahnen, die bisher den Anblick meist nur verhängt hatten, zumindest etwas Betrachtbares geworden; denn in meiner Phantasie steht ihre friedliche Ursache.
Vor zwanzig Jahren bin ich auf meine Wehrfähigkeit geprüft worden. Dabei hat der sonst so farbunsichere Bursche, der ich war, beim Farbtafeltest die gefragten Zahlen ziemlich genau aus dem Punktgewirr herausgefunden. Als ich dann zu Hause das Ergebnis der Untersuchung mitteilte (»tauglich zum Dienst mit der Waffe«), meldete sich der Stiefvater ‒ wir sprachen sonst nicht mehr miteinander ‒ und sagte, jetzt sei er zum ersten Mal stolz auf mich.
Ich schreibe das auf, weil meine mündlichen Erzählungen davon immer unvollständig und zudem falsch eindeutig waren. Im Reden nannte ich den Mann jedesmal »leicht betrunken«. Dieses an sich richtige Detail macht jedoch die ganze Geschichte unstimmig. Entspricht es der Wirklichkeit nicht eher, daß ich an jenem Tag das Haus und den Garten mit einem seltenen Ankunftsgefühl sah? Die Bemerkung des Stiefvaters war mir sofort zuwider. Aber warum ist sie im Gedächtnis verbunden mit dem frischen Rotbraun des von dem Mann gerade umgegrabenen Gartens? War nicht auch ich zu einem Teil stolz mit der Nachricht heimgekommen?
Die Farbe des Bodens ist jedenfalls das an dem Vorfall Nachwirkende. Wenn ich den Augenblick jetzt suche, stehe ich nicht mehr als der Jugendliche davor, sondern finde mich zeitlos, ohne Umriß, als mein Wunsch-Ich ganz in dem Rotbraun drin, als einer Klarheit, durch die ich mich und auch den ehemaligen Soldaten verstehen kann. (Zu Stifters ersten Erinnerungen gehörten die dunklen Flecken in ihm. Später wußte er, »daß es Wälder gewesen sind, die außerhalb waren«. Jetzt öffnen mir seine Erzählungen immer wieder farbige Stellen in gleichweichen Wäldern.)
Während des deutsch-französischen Krieges 1870/71 ließ sich Paul Cézanne durch seinen Vater, den reichen Bankier, vom Waffendienst loskaufen. Er verbrachte die Kriegszeit malend in L'Estaque, das damals ein Fischerdorf in einer Bucht westlich von Marseille war und heute zur industrialisierten Großstadt-Banlieue gehört.
Ich kenne den Ort nur von Cézannes Bildern. Doch schon der bloße Name L'Estaque macht mir eine Friedensvorstellung räumlich. Die Gegend, was auch aus ihr geworden ist, bleibt »der Ort und die Stelle der Verborgenheit«; nicht nur vor jenem Krieg von 1870, nicht nur für den Maler von damals, und nicht nur vor einem erklärten Krieg.
Cézanne hat ja in den Jahren danach noch oft dort gearbeitet, mit Vorliebe in der starken Hitze und einer »so fürchterlichen Sonne«, daß ihm schien, »als ob alle Gegenstände sich als Schatten abhöben, nicht nur in Schwarz oder Weiß, sondern in Blau, Rot, Braun und Violett«. Die Bilder der Versteckzeit waren fast schwarzweiß gewesen, hauptsächlich Winterstimmungen; danach aber wurde ihm der Ort, mit den roten Dächern vor dem blauen Meer, allmählich zu seinem »Kartenspiel«.
In den Briefen aus L'Estaque kam es dann auch das erste Mal vor, daß er seinem Namen das Wort »pictor« hinzufügte, wie einst die klassischen Maler. Es war der Ort, »von dem ich mich so spät als nur irgend möglich entfernen werde, denn es gibt hier einige sehr schöne Aussichten«. Keine Stimmungen mehr sind in den Nachkriegsbildern, und keine besonderen Tages- oder Jahreszeiten: energisch zeigt die Form immer wieder das Elementardorf am Ruhigblauen Meer.
Gegen die Jahrhundertwende entstanden um L'Estaque die Raffinerien, und Cézanne hörte auf, den Ort zu malen; in ein paar hundert Jahren werde es überhaupt völlig sinnlos sein, zu leben. ‒ Nur auf den geologischen Karten erscheint die Region noch unversehrt im Farbenspiel, und eine kleine resedagrüne Fläche hat sogar, wohl auf Dauer, den Namen Calcaire de L'Estaque.
Ja, dem Maler Paul Cézanne verdanke ich es, daß ich an jener freien Stelle zwischen Aix-en-Provence und dem Dorf Le Tholonet in den Farben stand und sogar die asphaltierte Straße mir als Farbsubstanz erschien.
Ich bin aufgewachsen in einer kleinbäuerlichen Umgebung, wo es Bilder fast nur in der Pfarrkirche oder an den Bildstöcken gab; so habe ich sie wohl von Anfang an als bloßes Zubehör gesehen und mir von ihnen lange nichts Entscheidendes erwartet. Manchmal verstand ich sogar Einrichtungen wie die religiösen oder staatlichen Bilderverbote, die ich dann auch mir, dem bloß abgelenkt Hinblickenden, gewünscht hätte. War ein in das Endlose fortsetzbares Ornament, indem es mein Unendlichkeitsbedürfnis ansprach, weiterleitete und bekräftigte, nicht das richtigere Gegenüber? (Angesichts eines altrömischen Mosaikfußbodens gelang mir so einmal die Phantasie vom Sterben als einem schönen Übergang, ohne die übliche Verengung »Tod«.) ‒ Und ist es nicht überhaupt erst die vollständige, farben- und formenlose Leere, die sich am wunderbarsten beleben kann? (Ein Satz eines Priesters aus einem anderen »abgelegenen Dorf« ‒ kein Laie dürfte sich eine solche Verkündung erlauben ‒ gehört hierher, und sei nicht vergessen, wegen des weggelassenen Artikels vor dem letzten Wort: »Unendliches Liebesschwingen zwischen der Seele und Gott, das ist Himmel.«)
So verhielt ich mich zu den Bildermalern eher undankbar; denn das vermeintliche Beiwerk hatte mir doch nicht selten zumindest als Sehtafel gedient, und nicht weniges war wiederkehrendes Phantasie- und Lebensbild geworden. Die Farben und Formen wurden dabei freilich für sich kaum wahrgenommen. Was zählte, war immer der besondere Gegenstand. Farben und Formen, ohne Gegenstand, waren zu wenig ‒ die Gegenstände in ihrer Tagvertrautheit zu viel. ‒ »Besonderer Gegenstand« ist noch nicht das richtige Wort; denn geltend waren gerade die Normalsachen, die aber der Maler in den Schein des Besonderen gestellt hatte ‒ und die ich jetzt kurz die »magischen« nennen kann.
Die Beispiele, die mir einfallen, sind sämtlich Landschaften: und zwar solche, die den entvölkerten, schweigendschönen Drohbildern des Halbschlafs entsprechen. Auffällig an ihnen ist, daß sie jeweils eine Serie darstellen. Oft verkörpern sie sogar eine ganze Periode des Malers: die leeren metaphysischen Plätze De Chiricos; die verödeten mondüberstrahlten Dschungelstädte Max Ernsts, deren jede einzeln Die ganze Stadt heißt; Magrittes Reich der Lichter, jenes wiederholte Haus unter den Laubbäumen, das im Finstern steht, während rundum ein weißblauer Taghimmel strahlt; und endlich, vor allem, die in den Föhrenwäldern von Cape Cod/Massachusetts verborgenen Holzhäuser des amerikanischen Malers Edward Hopper, mit Namen wie Straße und Häuser und Straße und Bäume.
Hoppers Landschaften aber sind weniger traumdrohend als verlassen-wirklich. Man kann sie an Ort und Stelle, im vernünftigen Tageslicht, wiederfinden; und als ich vor ein paar Jahren nach Cape Cod fuhr, wo es mich schon länger hingezogen hatte, und dort seinen Bildern nachging, fühlte ich mich, überall auf der Landzunge, erstmals im Reich eines Künstlers stehen. Die Kurven, Hebungen und Senkungen der Dünenstraße könnte ich jetzt nachziehen. Die Einzelheiten, oft ganz andere als die von Edward Hopper gemalten, befinden sich im Gedächtnis links und rechts, wie auf einer Leinwand. In der Mitte eines solchen Nachbildes steckt ein Schilfkolben im dicken Eis eines Teiches und gehört zu einer Blechbüchse daneben. ‒ Für mich dort hingekommen, fuhr ich dann schon weg in dem Bewußtsein, draußen, in der Praxis eines Malers und der Landschaftsformen Neu-Englands, die Vorbereitungen eines Reiseführers getroffen zu haben: Nachts hatte ich die gar nicht verlassenen, vielmehr eine Wunschwohnung darstellenden Holzhäuser zwischen den Kiefern blinken sehen und da das Heim für den Helden einer noch zu schreibenden Erzählung gefunden.
Die Dichter lügen, steht bei einem der ersten Philosophen. Es herrscht also vielleicht schon seit jeher die Meinung, das Wirkliche, das seien die schlechten Zustände und die unguten Ereignisse; und die Künste seien dann wirklichkeitstreu, wenn ihr Haupt- und Leitgegenstand das Böse ist, oder die mehr oder weniger komische Verzweiflung darüber. Doch warum kann ich von all dem nichts mehr hören; nichts sehen; nichts lesen? Warum wird mir, sowie ich selber auch nur einen einzigen mich beklagenden, mich oder andere beschuldigenden oder bloßstellenden Satz hinschreibe ‒ es sei denn, es ist der Heilige Zorn dabei! ‒, buchstäblich schwarz vor den Augen? Und werde andrerseits nie vom Glück schreiben, geboren zu sein, oder vom Trost in einem besseren Jenseits: das Sterbenmüssen wird immer das mich Leitende, doch hoffentlich nie mehr mein Hauptgegenstand sein.
Cézanne hat ja anfangs Schreckensbilder, wie die Versuchung des Heiligen Antonius, gemalt. Aber mit der Zeit wurde sein einziges Problem die Verwirklichung (»réalisation«) des reinen, schuldlosen Irdischen: des Apfels, des Felsens, eines menschlichen Gesichts. Das Wirkliche war dann die erreichte Form; die nicht das Vergehen in den Wechselfällen der Geschichte beklagt, sondern ein Sein im Frieden weitergibt. ‒ Es geht in der Kunst um nichts anderes. Doch was dem Leben erst sein Gefühl gibt, wird beim Weitergeben dann das Problem.
Was fing mit mir an, als wir, die Frau und ich, damals, noch in der Zeit der magischen Bilder, durch eine andere südfranzösische Landschaft fuhren?