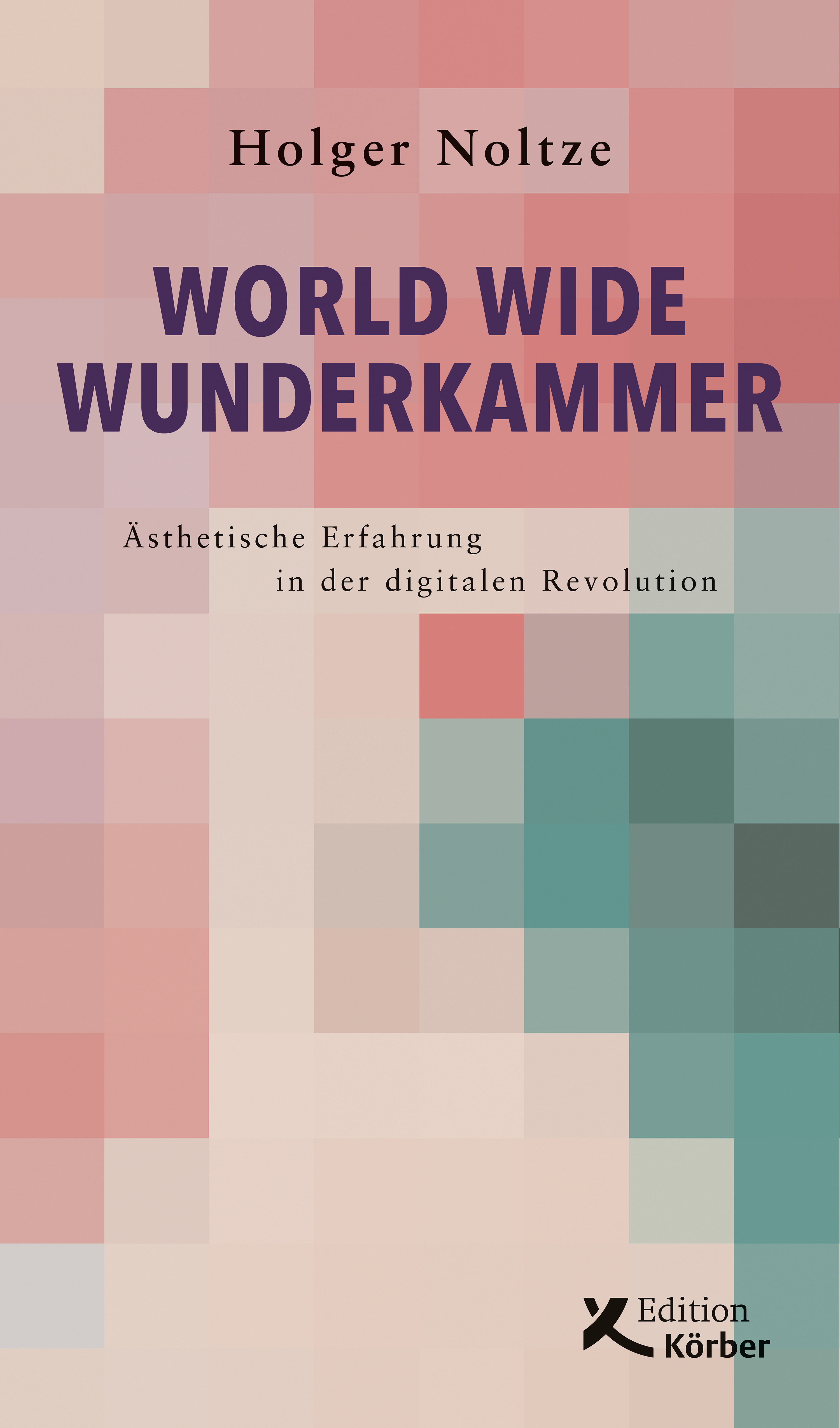Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: edition Körber-Stiftung
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Beethoven, Bach oder Boulez sind schwierig. Im Kulturbetrieb gilt diese Musik als »E« wie ernst und anspruchsvoll - und damit fast schon als unzumutbar. Jedenfalls für ein Publikum, dem man jede Anstrengung ersparen möchte. Medien, die ihre Wirksamkeit in Quoten messen, haben es am liebsten eingängig. Aber selbst da, wo es um Bildung geht, regiert die Devise »keep it short and simple«. Ob im Radio oder Fernsehen, bei Konzerteinführungen oder in Education-Programmen - die Furcht, die Zuhörer zu überfordern, ist fast mit Händen zu greifen. So gerät der gute Gedanke der Vermittlung nicht selten zur furchtbaren Vereinfachung. Verpasst wird dabei nicht nur die Kunst, sondern am Ende auch das Publikum. Gegen die Abspeisung mit Häppchen schlägt Holger Noltze vor, die Nährwerte von Kunst und ästhetischer Erfahrung neu zu entdecken. Gerade Musik vermag es, Gefühl und Verstand kurzzuschließen. Dabei können Funken sprühen, die mehr in Herz, Hirn und Leben verändern, als der Routinebetrieb ahnen lässt. Wer sich auf Musik als Kunst einlässt, wird erfahren, wie vielschichtig selbst das scheinbar Leichte ist. So kann man an Bach, aber auch an Björk und den Beatles, spielerisch-sinnlich und höchst unterhaltsam etwas Wesentliches üben: den furchtlosen Umgang mit Komplexität.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 290
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
»… ja daß man, um jenes politische Problem in der Erfahrung zu lösen, durch das ästhetische den Weg nehmen muß, weil es die Schönheit ist, durch welche man zu der Freiheit wandert.«
Friedrich Schiller, »Über die ästhetische Erziehung des Menschen, Zweiter Brief«
Vorwort
Lügen vom Leichten
Es wird ja viel gelogen. Wer das laute Wort Lüge in den Mund nimmt, findet sich auf der Seite der Entlarver und Bescheidwisser. Auch von denen gibt es viele; keine angenehme Nachbarschaft. Die Lautstärke, die sich der Titel leistet, muss dennoch sein, weil das Thema, um das es gehen soll, meist nur sehr leise angesprochen wird. Wer also lügt worüber?
»Leichtigkeitslüge« meint, dass der grundsätzlich richtige Gedanke, Kunst bedürfe, weil sie ihrem Wesen nach komplex ist, der Vermittlung, in unguter Praxis dazu geführt hat, Vermittlung mit Vereinfachung zu verwechseln. Kunst – mit der Musik als Hauptbeispiel – ist aber alles andere als einfach; sie kann zwar ›leicht‹ wirken, aber ihre Leichtigkeiten sind in der Regel nicht leicht zu haben. Wer es behauptet, verschweigt Wesentliches – und jetzt noch mal forte: lügt.
Das Folgende handelt daher von Anstrengungen. Es handelt aber auch von dem, was durch Anstrengungen zu gewinnen ist. Es geht von dem Gedanken aus, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen dem, was man an Aufmerksamkeit, Übung, Liebe einem Gegenstand (wie einem Menschen) zuwendet, und dem, was man empfängt. Der Gegenstand, der unter diesem Aspekt betrachtet wird, ist vor allem und immer wieder beispielsweise die Musik; man kann es auch noch weiter fassen: Kultur. Wer Kultur sagt, muss erklären, was gemeint ist, weil es von der Kaffeekultur bis zur Unternehmenskultur unterschiedlich gut begründet so viele Kulturen gibt.1 Dieses Buch beschäftigt sich mit Gegenständen, die am ehesten der Sphäre der »Hochkultur« zugerechnet werden.
Das Wort enthält die Voraussetzung eines Ordnungsprinzips, nämlich die kulturellen Angelegenheiten so zu sortieren, dass es ein Oben und ein Unten gibt und dass »oben« jedenfalls besser ist als »unten«. In dieser Vorstellung stünde der Hochkultur etwa das »Unterschichtenfernsehen«2 als das Andere gegenüber. Wer Hochkultur sagt, meint auch nicht »Spaßkultur«, vielleicht nicht einmal »Pop«.
Im Folgenden wird also (mit einem gewissen Unbehagen an der Unschärfe des Begriffs) von Gegenständen der Hochkultur die Rede sein, vor allem vom Umgang mit diesen Gegenständen im Kulturbetrieb selbst, in den Medien und im Bereich der Bildung. Die Zusammenschau dieser drei Bereiche ist nicht ohne die Anstrengung von gelegentlichen Parforceritten zu haben. Die Perspektive ist die einer Vogelschau. Den Beispielen – zum großen Teil aus dem laufenden Betrieb – mag man im Einzelnen Zufälligkeit entgegenhalten; auch, dass eine Argumentation, die nach mehr Differenzierung ruft, aus solchem notwendigen Abstand auch einmal pauschal geraten kann. Diesem Dilemma ist im Rahmen einer eher essayistischen Betrachtungsweise kaum zu entgehen. Schaut man aber einmal Medien, Kultur- und Bildungsbetrieb vergleichend in Bezug auf ihre Vermittlungs-Choreografien (im Umgang mit Hochkultur und Musik im Besonderen) an, schärft sich der Blick für eine Degressionsbewegung, die Teil und zugleich Motor der skizzierten Leichtigkeitslüge ist. Die – angreifbare – Perspektive versteht sich als Versuchsaufbau, um etwas zu erkennen, das mit den Teleskopen einer getrennten Medien- oder Kulturbetriebskritik leicht übersehen wird. Der Begriff Hochkultur wird dennoch wenn möglich vermieden, denn für die Überlegungen, die hier angestellt werden sollen, erweist er sich als Teil des Problems, nicht der Lösung.
Problematisch ist schon die ideologische Entgegensetzung von Hoch- und Populärkultur. Mit der herkömmlichen Annahme, Beethoven sei besser, mehr, wie auch immer hochwertiger als die Beatles, kommt man nicht weit. Seit den 1960er Jahren, in der von den Verteidigern des kulturellen Abendlandes die »Beatlemania« als Symptom einer verlorenen, weil von aller höheren Kultur verlassenen Generation diagnostiziert wurde, hat sich die Welt gedreht: Heute sind die Beatles ein kaum bestrittener Teil des Kanons der Musik des 20. Jahrhunderts,3 und dies nicht als Dokument einer Verirrung. Es hat sich offenbar etwas in der Einschätzung der Musik der Beatles geändert, längst ist sie allgemein akzeptiert, ja »klassisch«; das Verhältnis zu der Musik des Klassikers Beethoven hat sich dagegen – zumindest was dessen grundsätzliche, »gefühlte« Hochschätzung angeht – wenig geändert.4 Schwer zu sagen, ob in ein paar Jahren gegenwärtige Erscheinungen wie Tokio Hotel oder Lady Gaga ähnlich wahrgenommen werden wie heute die Beatles oder ob die Kanonisierung bei der experimentierfreudigen isländischen Sängerin Björk oder der multimedialen New Yorker Konzept-Band Sonic Youth enden wird. Letztere wurden von der taz zuletzt eben darum scharf kritisiert: »2009 ist das Jahr, in dem Sonic Youth in der Hochkultur, im Museum und in der Klassik verenden.«5
Die Welt ist so viel komplexer geworden, doch an dieser Stelle wäre einmal eine Ersparung möglich und können wir uns die Dinge ein wenig einfacher machen: Solche Grenzverlaufs-Gefechte um die Zugehörigkeit zu high oder low, Klassik oder Pop erweisen sich als ebenso aufreibend wie überflüssig. Sie müssen nur da geführt werden, wo Hochkultur eine Wagenburg meint, die von den Besitzern des Wahren-Schönen-Guten gegen die Anfechtungen einer sie frech leugnenden Popkultur verteidigt werden soll. Das brauchen wir nicht, also dürfen wir es uns schenken: Von solchen Anstrengungen ist in diesem Buch gerade nicht die Rede. Wovon aber?
Geschenke, aber man bekommt sie nicht geschenkt
So unbestritten die Musik von Bach, Beethoven, Boulez der Hochkultur zuzurechnen ist, so fatal erweist sich dies für ihre Vermittlung einem Publikum gegenüber, das den Glauben an ein »Oben«, das Höhere eben, weitgehend verloren hat. Die Zeiten, in denen es zur bürgerlichen Bildungsgrundausstattung gehörte, seine Beethoven-Symphonien-Platten im Regal stehen zu haben, sind vorbei. Heute können selbst angehende Musiklehrer die Beinamen Eroica und Pastorale kaum noch den Nummern 3 oder 6 zuordnen, manche nicht einmal mehr einem Komponisten. Man kann das beklagen. Doch der stereotyp beschwörende Hinweis an Studierende: Sie müssen das doch kennen! wird wenig ändern.
Die Anstiftung zu Anstrengungen, wie sie hier gemeint sind, zielt nicht auf die wissensmäßige Aneignung von Bildungsgut, sondern auf den Gegenstand selbst: Dass Beethovens Dritte Symphonie in Es-Dur steht und den Beinamen Eroica trägt, seine Sechste in F-Dur und Pastorale genannt wird, ist so lange totes Wissen, wie man nicht hörend erfahren hat, was in diesen Musikstücken verhandelt wird, mit welchen Mitteln dies geschieht und was die hier zu gewinnenden ästhetischen Erfahrungen mit uns, mit einem selbst zu tun haben – das musikalische Ringen um eine Idee des Heroischen, um dessen Höhen und Abgründe in der Dritten; eine Ahnung davon, was vollkommener Frieden sein könnte, Einklang mit der Natur etwa, in der Sechsten. Ihre Botschaften – nicht weniger als Ansprachen an die Menschheit – sind in einer Weise codiert, nämlich als »Ideenkunstwerke«6, die sich durchaus entschlüsseln lassen. Daneben, dahinter, darunter aber liegt noch eine andere Kraft, ihre eigentümliche »Gewalt«: nämlich das Potenzial, sehr besondere Erfahrungen zu ermöglichen und in den menschlichen Hirnhälften, die wir so sauber getrennt als »Gefühl« und »Verstand« zu bewirtschaften gelernt haben, eine Art von Kurzschlüssen auszulösen. Die Funken, die daraus springen, können – so eine These dieses Buches – mehr im Hirn, Herz und Leben eines Hörers anregen, als es der Routinebetrieb der Bildung, der Medien, der Kultur auch nur ahnen lässt. Beethovens Symphonien (hier nur als Beispiel genommen, von anderer Musik wird noch die Rede sein, denn es gibt viel andere Musik, die dieses Potenzial besitzt) sind Geschenke, aber – dies die zweite These – man bekommt sie nicht geschenkt. Anstrengungen sind vonnöten.
Wirklich? Strengen wir uns nicht schon genug an?
Anstrengungen sind unpopulär. Wer Anstrengendes fordert, macht sich nicht beliebt. Weil aber Beliebtheit ein entscheidendes Kriterium für die Marktfähigkeit einer Sache ist und weil der Markt die größeren, jedenfalls wahrnehmbaren Teile des kulturbetrieblichen Geschehens bestimmt, deshalb gehört das Wissen um den Zusammenhang von Anstrengung und Belohnung zu den gut gehüteten Geheimnissen auch der kulturaffinen Waren- und Angebotswelt. Der Kritiker Joachim Kaiser plauderte dieses Geheimnis vor einer größeren Öffentlichkeit aus, als er 2008 bei der vom ZDF übertragenen Echo Klassik-Preisverleihung den Dank für die Anerkennung seines Lebenswerks mit ein paar Sätzen über den Etikettenschwindel verband, den er zumal in der eben erlebten Veranstaltung deutlich empfand: »Die Hohe Musik ist keine leichte Kost, sie ist anders, wir müssen ihr Zeit opfern, Konzentration, sie verlangt Investition.«
Kaiser, nicht eigentlich ein Feind des Marktes, den er selbst virtuos zu bespielen versteht, gab sich hier als Schüler des strengen Marktverächters Adorno zu erkennen. Dieser sprach, und das Jahrzehnte vor Einführung des Privatfernsehens und der Verwandlung von »Kultur« in »Events«, sogar von Betrug: »Immerwährend betrügt die Kulturindustrie ihre Konsumenten um das, was sie immerwährend verspricht.«7 Ist dies ein Widerspruch? Wenn hier von Anstrengungen die Rede sein wird, dann erstens unter der gedanklichen Voraussetzung, dass es kaum ein Jenseits des Marktes gibt, so wie es kein Jenseits der Medien gibt. Zweitens, dass es sich deshalb nicht empfiehlt, Markt und Medien und ihren Einfluss zu ignorieren, also im Sinne einer splendid isolation eine immer wieder neu als »wahrer« zu behauptende Abschottung einer wahren Kultur vor den erheblichen Korruptions- und Verunreinigungsrisiken der modernen Welt vorzunehmen. Es meint drittens, sich dieser Welt aber auch nicht zu ergeben, also nicht zu kapitulieren vor den Anforderungen, die Markt und Massenmedien an Verständlichkeit, Vermittlung, Kommunikationsfähigkeit stellen.
Beide Haltungen sind, so wird zu zeigen sein, deutlich wahrzunehmen: auf der einen Seite Abschottung, Flucht in einen Kulturdünkel, gegründet auf der Gewissheit, im Besitz eines Besseren zu sein; auf der anderen: immer bedenkenlosere Anpassung an die »Marktfähigkeit« von Kultur. Beide, so wird in diesem Buch behauptet, versäumen, verspielen, was sie doch »retten« wollen. Beide Haltungen sind verstehbar, man wird ihnen gute Absichten nicht absprechen, in der Konsequenz aber wirkt eine Verblödungsmechanik. Der Weg zu Beethoven (um das gewählte Beispiel noch einmal aufzunehmen) wird im zweiten Fall, also Appeasement an die nun einmal so herrschenden Verhältnisse, eher weiter als kürzer. Im ersten – Bewahrung durch Rückzug – droht Versteinerung dessen, was doch immer wieder neu zum Sprechen gebracht werden will, oder die Verkürzung auf ein esoterisches Spezialistenvergnügen. So wird es nicht gehen, wenn es weitergehen soll.
Man kann sich fragen, ob das denn überhaupt sein muss, und es mit dem Intendanten des DeutschlandRadio halten, der in einem Zeitungsgespräch erklärte, dass er stolz auf die öffentlich-rechtliche Qualität des von ihm verantworteten Programms sei; dass es das hinreichend gebildete Publikum dafür schon weiterhin geben werde, und wenn die Gesellschaft eines Tages sich ein solches Programm nicht mehr leisten zu können glaube, dann habe diese Gesellschaft eben ein Problem. »Punkt.«8
Das Schöne an dieser Haltung ist das selten gewordene Selbstvertrauen eines Vertreters des inhaltlich strengen öffentlich-rechtlichen Anspruchs. Der Intendant eines nationalen und wenig kostenintensiven Hörfunkangebots kann vergleichsweise leichten Herzens so sprechen. Seine Kollegen in den Hierarchien der Landesrundfunkanstalten der ARD und des ZDF haben viel mehr Geld – und ganz andere Sorgen. Als fatal an der Haltung des selbstbewussten Intendanten könnte sich allerdings der feste Glaube daran erweisen, dass es dieses Publikum noch ewig geben wird: Dagegen sprechen die Altersstruktur der Hörer heute und die veränderten Mediennutzungsgewohnheiten der (gewünschten) Hörer von morgen, auch der »gebildeten«. Sie werden, in einer immer schneller sich wandelnden Welt, vermutlich anders gebildet sein, als der Intendant sich das vorstellt. Wagen wir ein Szenario, und bitte stellen Sie sich hier zur Untermalung eine Musik vor, wie sie Roland Emmerich für seine immer wieder neueste Variation des Themas »das Ende der Welt« einsetzen würde.
Ratlose Superhelden im Weltuntergangskino
Der Untergang des Abendlands ist schon im Gang. Die Bildungsfundamente brechen weg. Institutionen wanken. Das Restbürgertum trifft sich noch in seinen Abonnements, die Bessergestellten in den Kunstwelten von Salzburg und Bayreuth. Aber Kontinente von »Abgehängten« sind nicht mehr erreichbar außer vom »Unterschichtenfernsehen«. Die PISA-Studien bescheinigen dem deutschen Bildungssystem furchtbare Defizite; und dabei geht es doch erst einmal um Grundfertigkeiten wie Lesen, Schreiben, Rechnen. Von »Kultur«, ästhetischer Bildung ist hier gar keine Rede. Wenn die zuletzt verstärkten Bemühungen um einen besseren Listenplatz im internationalen Ranking greifen und deutsche Schüler, was Lesen-Schreiben-Rechnen betrifft, dem Fernziel Finnland etwas näher kommen, dann könnten sich diese Bemühungen um Effizienz sogar als nachteilig für die sogenannten »weichen« Fächer erweisen und sich das Mehr in Mathe als ein Noch-weniger im Musischen verschieben: Ist Musikunterricht noch wichtig?
Ja! Und wie!, donnert es inzwischen dagegen. (Im Emmerich-Weltuntergangskino würde man jetzt das Thema eines hoffnungsfrohen Triumphmarsches hören.) Denn die Gegenkräfte haben mobil gemacht: Johannes Raus letzte große Rede galt dem Erhalt von Musikschulen und Musikunterricht im Land der Dichter, Denker und Musiker. Der Film Rhythm Is It, der 2004 das Leuchtturm-Education-Projekt der Berliner Philharmoniker dokumentierte, wurde zum erfolgreichsten deutschen Non-Fiction-Film der letzten Jahre: Berliner Hauptschüler tanzten zu Strawinskys Sacre du Printemps! Damit war die Macht der Künste Musik und Tanz auch im sozialen Problemfeld bewiesen, you can change your life in a dance class. Die Botschaft kam an, nicht nur in der Vorstandsetage der Deutschen Bank (die das Berliner Projekt finanzierte), auch in den Hirnen von Politikern. Das Thema ästhetische Bildung ist seitdem gesetzt. Kaum ein Theater mehr ohne Education-Angebot, Schulprojekte, Jugendclubs. Die Zeit titelt Macht Musik! auf der ersten Seite und füllt ein ganzes Feuilleton damit: »Wer ein Instrument lernt, kommt besser durchs Leben.«9 Neurophysiologen weisen immer wieder neu nach, dass Klavierspielen den IQ stimuliert. Das alles ist wunderschön. Großes Kino.
Wir sitzen hier im Lieblingsfilm vieler Kulturverteidiger. Man kann ihn sich immer und immer wieder ansehen, vor allem als Mittel gegen den deprimierenden Gedanken, es könne doch alles vergebens sein.
»Es ist alles vergebens«, singt Harlekin in Strauss’/Hofmannsthals Ariadne auf Naxos zur Aufmunterung der allzu traurigen Königstochter, »ich fühlte es während des Singens«. Im aktuellen Kulturbetrieb sehen wir die allzu traurigen, weil verlassenen Prinzessinnen neben den unentwegten Spaßmachern der Mutmach-Fraktion. Wer aber im Singen die eigene Wirkungslosigkeit wahrnimmt (dass alles nichts hilft, die Traurigen aus der Traurigkeit zu bringen), dem verschließt sich der Mund. Dergestalt trostbedürftigen Kulturschaffenden oder Kulturverwaltenden dient der Film von der Nützlichkeit (macht schlau!) und sozialen Wirksamkeit (Hauptschüler aus Berlin!) von Musik und Kunst zur Wiederherstellung der nicht selten schwer angeschlagenen Arbeitsfähigkeit. Gegen solches Aufmunterungs-Doping ist nichts zu sagen. Außer dass in den aktuellen Debatten um Sinn, Nutzen und Notwendigkeit ästhetischer Bildung vom zweckfreien Schönen immer noch kaum die Rede ist.
Fauler Zauber Vermittlung?
Während die im Marsch durch die Institutionen in Ehren ergrauten Helden der Welt von ’68 sich nach wie vor im publikumswirksam krachenden Niederreißen von »Schwellenängsten« ausagieren (ein Mythos, wie zu zeigen ist), lautet das neue Zauberwort »Vermittlung«. Vermittlung erzeugt ein gutes Gefühl, denn es suggeriert eine Lösung für ein Problem: Wir haben die Kunst hier und das Volk, das Publikum, die Jugend usw. da – und den traurigen Befund, dass ein wachsender Teil von Volk, Publikum und Jugend ganz gut ohne Kunst auszukommen scheint.
Alles eine Frage der Vermittlung, rufen Kulturleute, Medienleute, Professoren. Wer wollte widersprechen? Die Frage ist nur, ob funktioniert, was sich in der Begründungslyrik von Projektförderungsanträgen, neuen Studiengängen, Spielzeitheften, Erwachsenenbildungskonzepten so unwiderstehlich liest. Denn so groß das Problem, so groß auch die Ratlosigkeit – und so erschütternd, alles in allem, die Einfallslosigkeit. Und weil, wo Sondermittel genehmigt werden, schnelle Erfolge evaluiert werden wollen, gehen die meisten der neuen Musik- und Kulturvermittler ziemlich geradewegs auf Nummer sicher. Hier treffen sie sich mit den alten Schwellen-Niederreißern. Beider Devise lautet ähnlich: »ermäßigte Eintrittspreise« – und dabei geht es nicht um den Unterschied von Warenwert und wahrem Wert einer Opernkarte. Es geht um geistige Ersparungsangebote, eine dramatische »Reduktion von Komplexität«, die im Sinne ihrer guten Vermittlungsabsicht – und hier gründet die Skepsis dieses Buches – die Kunst verpasst.
Als die Medien mit dem letzten Mozart-Jahr 2006 fertig waren, war Mozart medial gründlich erledigt – aber worum es im Figaro geht, wo das Unbegreifliche im Finale der Jupitersymphonie anfängt, das kam nicht vor. Zu komplex. Fürs Fernsehen, natürlich, aber auch für Printmedien, Radio, selbst für die nicht-massenmedialen Bildungsinstitute. Natürlich können ein paar Takte genialer Musik oder jedenfalls »schöner Stellen« als »Einstiegsdroge« funktionieren. Und wer wollte bestreiten, dass zur ersten Begegnung mit Beethoven vielleicht nicht die Große Fuge ausgesucht werden sollte. Gute Vermittlung wäre aber doch eine, die vor allem eine Ahnung davon gibt, was hinter der freundlich-übersichtlichen Anfangserfahrung noch alles zu entdecken ist. Dazu gehört zu sagen, wie weit der Weg dahin sein kann, und glaubhaft zu machen, dass die Länge dieses Erfahrungs- und Erkenntnisweges aber genau den Reiz der Sache ausmacht. Die Behauptung, dieser Weg sei kurz und bequem, wird sich als Reklamelüge erweisen, sobald es aufwärtsgeht und länger dauert, und wer darauf nicht vorbereitet ist, wird schneller unlustig und eher aufgeben als derjenige, der auf eine Herausforderung vorbereitet wurde.
Die selbstgewählte Bescheidenheit, was Möglichkeiten der Differenzierung angeht, ist allgemein, und sie hat ein dramatisches Ausmaß erreicht: Wo alles leicht und benutzerfreundlich ein- und abgehen muss, hat das Schwierige keine Daseinsberechtigung. Und wieder produziert das Mangelgefühl, der Phantomschmerz um etwas, das fehlt, einen Überbringer mit Botschaft: einen ehemaligen Internatsdirektor, der im (von ihm sicher kritisch gesehenen) Fernsehen schmallippig die Notwendigkeit von »Disziplin« anmahnt. Hat er nicht recht?
Auch Bernhard Bueb geht es um Anstrengungen und das der Anstrengung innewohnende Glücksversprechen: »Das Glück der Anstrengung fällt Jugendlichen heute nicht als Erstes ein, wenn von Glück die Rede ist. Sie kennen oft nur das Glück der Animation, das von außen kommt. Fernsehen, Internet und Computer sind eine Quelle des Glücks, Drogen, Alkohol und Zigaretten eine andere Quelle.«10 Hier spricht ein Schulleiter, der den Untergang der Welt qua Hausordnung aufzuhalten sucht. Es spricht aber, von höherer Warte, auch der Kulturkritiker, der den Bildungsnotstand als Folge eines Erziehungsnotstandes diagnostiziert, den er vor allem als Folge des Fernsehens, der unablässigen Verführung durch Konsum und Mangel an Perspektiven ausmacht. »Mut zur Erziehung«, so Bueb dagegen, bedeute »Mut zur Disziplin«. Sein »Lob der Disziplin« aber kommt auf den Leser wie eine kalte Dusche: »Disziplin verkörpert alles, was Menschen verabscheuen: Zwang, Unterordnung, verordneten Verzicht, Triebunterdrückung, Einschränkung des eigenen Willens.«11 Bueb ist ein Gegner wohlmeinender Hinführungs-Choreografien, er nennt es »Angebotspädagogik«: »Die Angebotspädagogik ist gescheitert, weil sie der Natur des Menschen widerspricht. Auch die Internate haben jahrzehntelang den Fehler begangen, Kindern und Jugendlichen Aktivitäten in der Freizeit anzubieten, statt sie dazu zu verpflichten.«12
Der Disziplinpädagoge Bueb spricht von Werten, aber vor allem spricht er von Grenzen. Unter die »Aktivitäten in der Freizeit« fällt auch Musik, sie erscheint als eine Art Etüdenprogramm fürs rechte Leben und Arbeiten: »verzichten zugunsten eines Zwecks, Ausdauer beweisen, einer Sache dienen und sich qualifizieren. Frühes Musizieren übt die Tugenden der Arbeit. […] Wem Arbeiten nicht zur zweiten Natur geworden ist, der wird seine Begabungen nur unzureichend entfalten.«13 Um seine Werte und Tugend-Schätze hat er einen Zaun von Verboten errichtet. Doch so scharf der kultur- und medienkritische Blick die Krankheit erfasst, so sehr darf doch bezweifelt werden, ob die Rezepte des Autors zweckdienlich sind. Bloß weil Fernsehen auch verdummen kann, macht Fernsehverbot die Menschen noch nicht schlauer. Auch ist die Welt kein Internat. So populär-unpopulär seine Ansichten erscheinen: In Buebs Paradiese der Disziplin möchte man doch »lieber nicht« (Melville, Bartleby) eingehen.
Was es soll
Dieses Buch möchte andere Energien stimulieren. Es wendet sich gegen die furchtbaren Vereinfacher in Medien, Kultur- und Bildungsinstitutionen. Vermutet wird, dass diese ihren Adressaten immer lauere Süppchen vorsetzen – weil sie es oft auch selbst nicht mehr anders wissen.
Dagegen wird ein unzeitgemäß emphatischer Begriff von Kultur gestellt. Positiv behauptet wird, dass wir mit dem, was zwischen, vor und hinter Bach und Boulez, Cervantes und Celan, zwischen Aristoteles und Žižek komponiert, geschrieben und gedacht worden ist, einen gigantischen Staudamm nicht nur an Wissen, sondern an ästhetischen, intellektuellen und emotionalen Erfahrungsmöglichkeiten haben – dass aus dem unter den herrschenden Bedingungen in den Bereichen Bildung, Medien und Kulturbetrieb aber nur schmale Rinnsale rieseln. Es geht also um Öffnung, um Offenheit, letztlich darum, das Ungeheuerliche von Kunst erfahrbar zu machen – statt es in kleiner Münze, als Feierabendentspannung, Bildungsgut oder IQ-Training zu verscherbeln.
Dieses Buch behauptet, dass man nichts geschenkt bekommt, dass man es sich mit der Kultur zwar nicht unnötig schwer machen muss, dass das Schwere aber schwer und das Komplizierte nun mal komplex ist und dass die habituelle Vermeidung von Anstrengung ein Übel ist. Und dass die Nicht-Zumutung von Anstrengung aus Furcht vor der Trägheit des Publikums auch etwas von Verachtung hat.
Plädiert wird also für eine andere Kultur der positiv verstandenen Anstrengung. Gerichtet ist dieses Plädoyer an die Institutionen Medien, Bildungswesen und Kulturbetrieb, an die Politik, aber auch den einzelnen Rezipienten, an Leserinnen und Leser, Hörerinnen und Hörer. »Anstrengung« meint die Bereitschaft, sich auf Komplexität einzulassen; es meint aber – und schon sind wir bei der Politik – auch, dass Kultur Geld kostet. Deutschland hat die dichteste Infrastruktur an Kulturinstitutionen weltweit. Dass es das noch gibt, hat oft mehr mit ihrer institutionellen Schwerabschaffbarkeit zu tun als mit Freude, Einsicht und Interesse an dem, was da getrieben wird. Und was da getrieben wird, hat manchmal mehr mit Routine zu tun als mit Freude, Erkenntnis und Interesse. Manchmal heißt, dass es immer wieder auch anders läuft, dass »Vermittlung« immer wieder auch gelingt. Gerade wer hier stark engagiert ist, wird die im Folgenden gelegentlich zugespitzte Kritik ungerecht finden. Auch wenn es um die Folgen der Furcht vor Komplexität geht: Der Längsschnitt durch die (Vermittlungs-)Systeme Bildung, Medien und Kulturbetrieb, auf der Suche nach den Punkten, an denen gerade etwas sehr schiefläuft, kommt ohne Vereinfachungen selbst nicht aus. Man wird sich, nach allerhand Kritischem, fragen, ob der Autor denn wisse, wie es besser gehen könnte. Patentrezepte sind nicht zu erwarten. Am Ende aber werden Vorschläge gemacht, wo anzusetzen wäre; sie zielen darauf, dass aus einem veränderten Bewusstsein auch eine veränderte Haltung folgen kann. Und daraus ein anderes Handeln.14 – Damit wären Perspektive, Absichten – und Grenzen des Unternehmens skizziert, das sich im weiteren Sinn dem heiklen Genre Kulturkritik verbunden sieht.
»Kulturkritik ist ein osmotisches Denken mit Weltdeutungsanspruch, das vom Zeitgeist lebt, wenngleich es sich gegen die eigene Zeit wendet«, schreibt Georg Bollenbeck in einer Geschichte der Kulturkritik, deren Vorzug darin liegt, nicht nur ihre allbekannten Grenzen noch einmal zu vermessen, sondern sie als Wahrnehmungs-, Erkenntnis- und Äußerungsmodus eigenen Rechts zu würdigen. Die Arbeit der »zunftfreien« Kulturkritiker fasst Bollenbeck so zusammen: »Sie ignorieren disziplinäre Grenzen und adressieren ihre Arbeiten an eine kulturräsonierende Öffentlichkeit. Sie interessieren sich weniger für die Beobachtung anderer Bücher und mehr für die Beobachtung ihrer eigenen Epoche. Sie stellen immer ihren Aktualitätsbezug heraus. Kulturkritik erlaubt Blickerweiterungen und eine überraschende Problemsensibilität.«15
Eine kleine Blickerweiterung, was ein paar feststehende Gewissheiten über die Vermittlung – und »Bewirtschaftung« – von Musik und Kultur angeht, wäre ein schönes Ziel für dieses Buch. Eine solche Blickerweiterung würde auch den an das Zitat anschließenden Satz nicht übersehen, der von den Risiken und Nebenwirkungen der kulturkritischen Herangehensweise handelt: »Ihr Vermutungswissen kann allerdings auch in alarmistische Hypergeneralisierungen umschlagen.« Der Verfasser hofft, dem zu entgehen. Er würde die folgenden Ausführungen am liebsten so verstanden sehen: als eine Empfehlung, ohne Übellaunigkeit oder apokalyptische Posen, sich über die Preise – und den Preis – von Kultur klarzuwerden und den Gang zu den Quellen zu wagen. Dahin, wo es (wahrhaft) genüsslich, aber auch gefährlich wird. HIC SVNT LEONES, stand einst, bevor die Welt ganz vermessen war, auf den Landkarten, an den Rändern, wo man nicht weiterwusste.
Abb. 1: Gefährliche Gegenden
In der Verblödungsspirale
Um es also, dem kulturkritischen Genre angemessen, noch einmal zugespitzt zu formulieren: Wir befinden uns, was Verständnis und Aufnahmefähigkeit für Kunst und Kultur angeht, in einer Verblödungsspirale, die mit dem Versagen des Bildungssystems, spezifischen Funktions- und Wirkungsweisen der Massenmedien und der fortschreitenden Ökonomisierung der Gesellschaft zu tun hat. Einwirkungsmöglichkeiten können sich folglich nur an den Stellen ergeben, an denen die große Spirale angetrieben wird. Die folgenden Überlegungen sind zunächst anhand der genannten drei Sektoren strukturiert: Bildung, Wirtschaft/Kulturbetrieb, Medien. Weil sich diese Sektoren auf vielfältige Weise berühren, ist damit nur eine ungefähre Ordnung gegeben. Es geht darum, Ideen zu sammeln, wie es weitergehen könnte. Kann man die Verblödungsspirale bremsen? Ließe sie sich andersherum drehen? Was vermitteln die Vermittler? Am Ende aber soll sich der Blick öffnen auf einen märchenhaften Reichtum, auf den wir verzichten, vielleicht weil er in der gesteigerten Betriebsamkeit vergessen wurde.
Es wird um einen entspannten Umgang mit Komplexität, wie sie uns in Kunstwerken begegnet, geworben. Ästhetische Erfahrungen können uns in der Fähigkeit trainieren, Schwieriges auszuhalten, Unerklärbares anzunehmen. Darin liegt eine Schlüsselkompetenz, um in einer komplizierteren Welt zurechtzukommen. Zugleich ist Kunst aber auch viel mehr als Trainingslager und Mittel zum guten Zweck. Kunst ist zuerst und vor allem Kunst. Wer sich darauf einlässt, kann fliegen lernen. Aber vorher muss es ein wenig bergauf gehen.
Klar ist: Es wird anstrengend werden.
Bildung
»Wir sind, sagte ich, um eine Definition verlegen. Doch meinen wir wohl ungefähr so viel, daß wir uns ernstlich bemühen wollen, nachzudenken, wie wir wohl am besten gebildete Menschen werden.«
»Das ist viel und wenig, brummte der Philosoph: denken Sie nur recht darüber nach! Hier sind unsere Bänke: wir wollen uns recht weit auseinandersetzen: ich will Sie ja nicht stören nachzudenken, wie Sie zu gebildeten Menschen werden.«
Friedrich Nietzsche: »Ueber die Zukunft unserer Bildungsanstalten«
Così fan tutti, eine Kommunikationsstörung
Er war ein Herr, ein zum Opernbesuch ordentlich angezogener Mann um die sechzig, und als er mit seiner Frau den Theaterraum verließ, es war das prächtige Cuvilliés Theater in der Münchener Residenz und eben Pause von Mozarts Così fan tutte, da stellte er ihr folgende Frage: »Wie kann das eigentlich sein, dass ein deutscher Komponist einen italienischen Text vertont?« Die Nebensächlichkeit, inwiefern Mozart ein deutscher Komponist sei, beiseitegelassen, ist das keine schlechte Frage, denn sie kann nachdenklich machen.
Es hatte sich in den vergangenen anderthalb Stunden der junge, aber schon mit Preisen bedachte Regisseur alle Mühe gegeben, der langen Aufführungsgeschichte dieser Mozart-Oper eine neue, zeitgemäße Sicht zuzufügen. Das Spiel um die zwei Jungs, die ihre Mädchen auf die Treueprobe stellen, indem sie vorgeben, in den Krieg ziehen müssen, dann aber als verkleidete Albaner zurückkommen und die Geliebten umwerben, mit fürchterlichem Erfolg für ihre »Beziehungen« – dies alles spielte jetzt also auf einem Campingplatz vor Neapel, was man daran gut erkennen konnte, dass eine Ansichtskarte mit Grüßen aus Napoli auf die Bühne projiziert war; der erhabene Blick auf Stadt, Meer und Vesuv war aber nur der Hintergrund, den Vordergrund beherrschte ein enorm barbusiges Postkarten-Pin-up. »Die kenn ich irgendwoher«, meinte ein anderer älterer Herr, und in das dröhnende Schweigen seiner Nachbarin hinein: »Also das Gesicht kommt mir bekannt vor.«
Beide Bemerkungen lassen das ehrliche Bemühen erkennen, ein weitgehend rätselhaftes Geschehen zu dechiffrieren. Mit Mozart haben sie nichts zu tun. Formuliert wird eine Fremdheitserfahrung. Im ersten Fall würde die Beantwortung der Frage immerhin einen historischen Horizont eröffnen: Wer war Mozarts Librettist Da Ponte, warum war im Wien der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts nicht das Italienisch der Opera buffa, sondern das Deutsch der Entführung aus dem Serail oder der Zauberflöte das Besondere und so weiter. Im zweiten Fall führt die Beantwortung der Frage, ob und wo dem Besucher die Entblößte schon einmal begegnet ist, zu nichts, allenfalls zum Ärger mit seiner Frau. Zum Thema des Stücks dringen beide nicht vor. Dessen Brisanz, so ist leider anzunehmen, geht ihnen nicht auf. Erst recht nicht, was den jungen Regisseur trieb, als er das Geschehen auf einen Campingplatz verlegte. Vielleicht noch, dass es so eine »moderne« Inszenierung war, was man an den nackten Brüsten ja gleich sehen konnte. Am Ende gab es aber keinen Ärger, sondern freundlichen Beifall für die jungen Leute, man versuchte sich vielleicht noch einen Reim auf das eine oder andere Detail zu machen: Was bedeutete der Plastikvulkan, der da am Ende erschien – na, es spielt doch in Neapel, klar! Dann ist der Abend schnell vergessen. War es das? Das war’s.
Das Beispiel ist willkürlich gewählt, man könnte drastischere finden, aber darauf soll es hier gar nicht ankommen. Die beiläufige Beobachtung lässt ein alltägliches Missverstehen sichtbar werden: für sich genommen unbedeutend; bedenklich, sofern sich im kleinen Missverständnis größere spiegeln. Zugespitzt auf die Fragestellung, die auf den folgenden Seiten bearbeitet werden soll: Wenn eine künstlerische, intellektuelle, »kulturelle« Anstrengung (stellvertretend die der kompetenten Aufführung einer Mozart-Oper) von dem Publikum, das formal für die Resultate solcher Anstrengungen überhaupt noch erreichbar ist (Opernbesucher, das heißt empirisch: ältere Herrschaften, die sich auf ihre Bildungsfundamente noch etwas zugute halten), in einem sehr basalen Sinn nicht mehr verstanden wird, haben wir dann ein Problem? Und wie viel größer wird dieses Problem, wenn wir die Mozart-Oper mit einem jüngeren Publikum konfrontieren, das nicht einmal mehr über solche brüchigen Wissens- und Bildungsfundamente verfügt? Die Rede ist, wohlgemerkt, von Mozart, dem vermutlich einzigen Komponisten »klassischer« Musik,16 der als stabiler, wenn auch ungefährer Teil der Popkultur gelten kann, und es geht nicht um ein entlegenes Werk Mozarts, sondern um eine der »großen« Opern, deren Thema – wie es nämlich um Liebe und Treue zwischen jungen Männern und Frauen bestellt ist – von ungebrochener Brisanz ist. Vielleicht hätten diese Jüngeren, deren Generationsgenossen auch auf der Bühne des schönen Rokokotheaters agierten, die ambitionierte Deutung des jungen Regisseurs ja viel besser verstanden? – Das ist möglich, aber schwer zu sagen, denn die Altersgruppen der unter Vierzigjährigen waren nur durch drei mitgenommene Mädchen vertreten, von denen zwei sehr adrette zartrosa Kleidchen trugen und deren älteste zehn war. Heldenhaft wehrten sie sich gegen den Schlaf; eine hielt durch. Da Pontes Verwicklungen und Mozarts musikdramatische Wahrheit haben sie aber sichtbarer- und verständlicherweise wenig interessiert. Die Frage ist, ob sie wiederkommen, wenn die Probleme in Mozarts Così auch ihre Probleme sind. Und ob das Stück dann noch gespielt wird.
Das beschriebene Mozart-Missverständnis trug sich in München zu, einer Stadt, die für ihren Reichtum, auch für den an »klassischer« Kultur, besonders der Oper, beneidet wird. München ist auch eine Stadt, in der vor allem die Musik im öffentlichen Raum eine Rolle spielt und auf ein verhältnismäßig gut informiertes Publikum rechnen kann. Die Chefdirigenten der Münchener Spitzenorchester sind öffentliche Personen, über deren Engagement oder auch Weggang ein wahrnehmbarer Teil des Publikums leidenschaftlich debattiert. An manchen Abenden möchte man in einer Vorstellung des Nationaltheaters oder im Herkules-Saal der Residenz, bei einem Kammermusik- oder Liederabend, noch an das Vorhandensein eines Bildungsbürgertums glauben, das sich andernorts vielleicht in Zirkeln sammelt, meist aber vollkommen marginalisiert erscheint. In München, möchte man glauben, ist Mozart noch eine bekannte Größe. Woanders ist das lange schon ganz anders.
Wenn also in der Musikstadt München ein ambitionierter Mozart-Abend bei tendenziell gutem Willen auf Seiten der Produzenten wie auf der der Rezipienten solche Missverständnisse hervorbringt, dann wird daran eine Kommunikationsstörung sichtbar, die an anderen Orten, in anderen Theatern eher größer zu vermuten ist – gelegentlich verzweifelt groß.
Um noch einmal Harlekin in Strauss’/Hofmannsthals Ariadne zu zitieren: »Hübsch gepredigt! Aber tauben Ohren.« Es ist leider anzunehmen, dass damit ein wunder Punkt getroffen ist, was das hochkulturelle Sender-Empfänger-Modell angeht: Tatsächlich werden seitens des »Betriebs« Anstrengungen unternommen, deren Ergebnisse sich einem größeren Teil des Publikums kaum noch erschließen. Wenn immer wieder und zuletzt in immer kürzeren Abständen öffentlicher Streit über jene künstlerische Anstrengungen ausbricht, die unter dem Begriff »Regietheater« etwas unscharf zusammengefasst werden, dann ist der Kern der Auseinandersetzung vermutlich nicht weit von diesem wunden Punkt entfernt. Von den Kritikern des »Regietheaters«17 wird die Forderung erhoben, man möge die Werke des Theaters und Musiktheaters doch wieder so zeigen, dass das, von dem sie handeln, nicht zur Unkenntlichkeit verfremdet werde. Manche Zauberflöte wird von ehrgeizigen Regisseuren auch an kleineren Theatern so energisch und kreativ gegen den Strich gebürstet, dass eine Schulklasse, die hier womöglich eine erste und nicht unwahrscheinlich ihre letzte Opernerfahrung im Leben macht, eher verstört wieder nach Hause geht und von der Mozart-Musik nur am Rande etwas mitbekommen hat.
Vor allem an den Orten öffentlicher Musik- und Kunstaufführungen, in der immer noch vorhandenen dichten kulturellen Infrastruktur des deutschen Stadttheaterwesens, werden regelmäßig Kunst-Päckchen geschnürt, die die Interessierten unter den Adressaten nicht öffnen können und deren Annahme die Uninteressierten verweigern. Da wird offenbar von sehr vielen sehr wenig verstanden. Man besuche die häufig trostlos verlaufenden Kommunikationsversuche, die unter dem Titel »Publikumsgespräch« in den Foyers der Theater immer wieder unternommen werden, um sich ein Bild von der Breite des Grabens zu machen. Da ist schon vor der ersten Frage, schon vor dem ersten Erklärungsversuch einiges schiefgegangen, auf beiden Seiten. Hier soll es um die Seite des Publikums gehen. Die Verringerung einer allgemeinen »Lesefähigkeit« für das, was auf einer Theater- oder Opernbühne geschieht, deutet auf ein Bildungsproblem, das nicht nur Kinder und Jugendliche betrifft.
Bye-bye, Aye-Aye. Vom Vergessen
Auch die Geschichte des Verschwindens ist schon erzählt, der australische Journalist Terry Glavin18 hat sie geschrieben: Alle zehn Minuten stirbt eine Spezies aus, alle sechs Stunden eine Pflanzenart, alle zwei Wochen eine Sprache. Der Verlag Zweitausendeins, der das Buch vertreibt, zitiert in seinem Katalog dazu den Träger des Alternativen Nobelpreises Pat R. Mooney mit einem Satz, der nachdenklich machen kann: »Es könnte sein, dass unsere Generation die erste ist, in der die Menschheit mehr Wissen verliert als dazugewinnt.« Der Kanadier Mooney ist ein Fachmann für Ernährungsfragen und Biotechnologie, Glavin ein Reporter auf der Suche nach verschwundenen oder eben fast verschwundenen Mitbewohnern des Planeten wie dem Aye-Aye, dem Fingertier auf Madagaskar, von dem in einem fernen Urwaldwinkel noch ein paar Exemplare existieren, an dem sehr schmalen Rand zwischen Noch-Sein und NichtMehr-Sein.