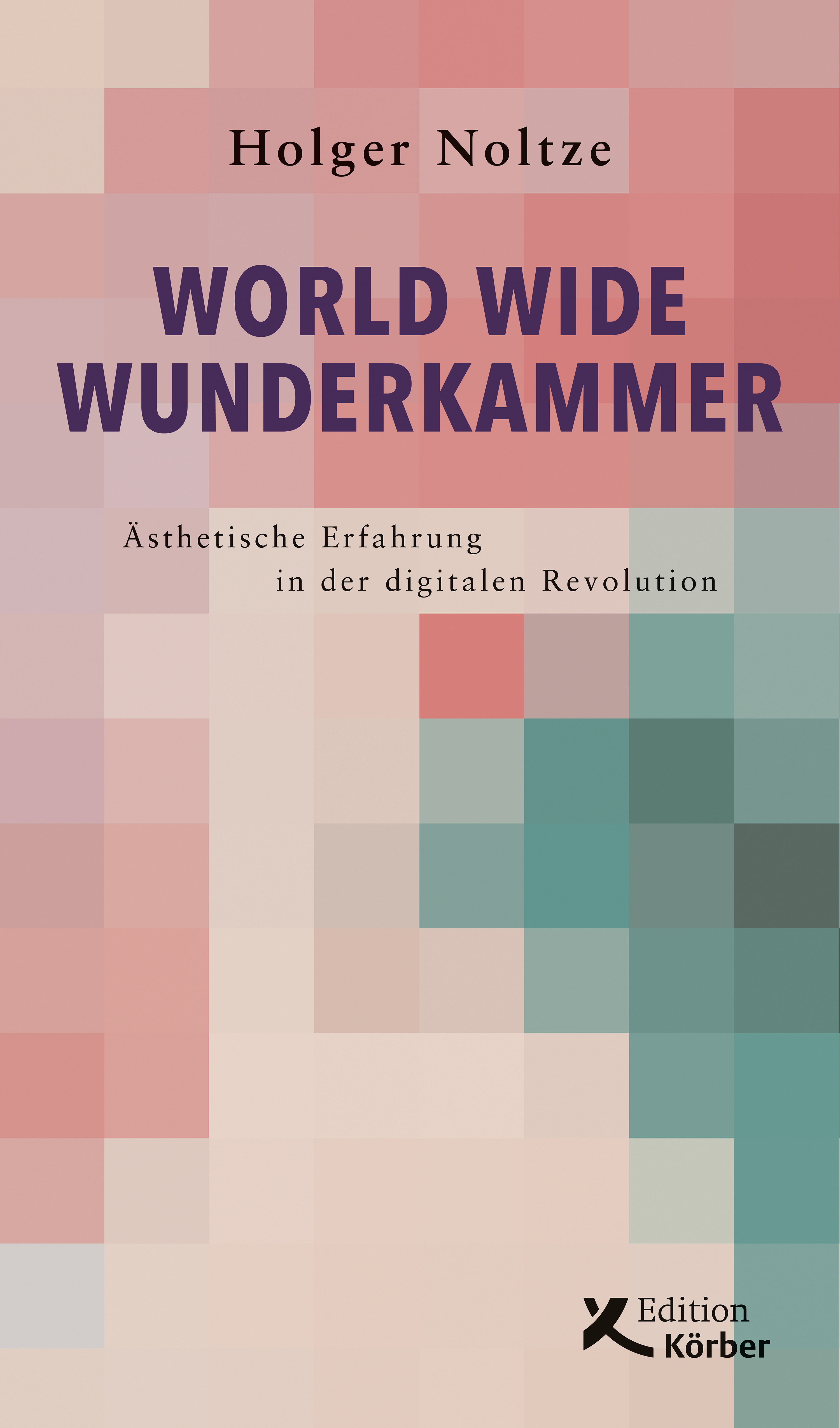Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Bertelsmann Stiftung
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Musik in Deutschland ist ein weites Feld. Es gibt eine reiche Szene, in der "Klassik" immer noch eine besondere Rolle spielt. Nirgendwo auf der Welt gibt es so viele Orchester, Chöre und Opernhäuser wie hier. In seinem Buch "Musikland Deutschland?" warnt Holger Noltze, Kulturjournalist und Professor für Musik und Medien, davor, diesen Reichtum zu verspielen. Als "Verteidigung" liefert er Argumente dafür, warum musikalische Förderung für die Persönlichkeitsentwicklung ebenso wichtig ist wie Musik für diese Gesellschaft. Noltze trägt in seiner aufrüttelnden Standortbestimmung zusammen, was wir über die Produktion und das Publikum klassischer Musik wissen, und macht Vorschläge, wo man ansetzen könnte, um das Musikland nicht nur zu bewahren, sondern seine Potenziale zu nutzen. Ergänzt wir das Buch durch fünf Videointerviews, die der Autor mit Musikexperten geführt hat: Christian Höppner, Generalsekretär des Deutschen Musikrates; Hans Neuhoff, Musiksoziologe; Heiner Gembris, Professor für psychologische Musikpädagogik; Richard McNicol, Musikvermittler; Tobias Bleek, Musikwissenschafter.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 133
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Holger Noltze
Musikland Deutschland?Eine Verteidigung
Musik in der Gesellschaft
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet unter http://dnb.d-nb.de abrufbar.
© E-Book-Ausgabe 2013
© 2013 Verlag Bertelsmann Stiftung, Gütersloh
Verantwortlich: Judit Schweitzer
Lektorat: Heike Herrberg, Bielefeld
Herstellung: Christiane Raffel
Umschlaggestaltung: Elisabeth Menke
Umschlagabbildung: itestro/Fotolia.com
Satz und Druck: Hans Kock Buch- und Offsetdruck GmbH, Bielefeld
ISBN 978-3-86793-431-2
ISBN 978-3-86793-476-3 (PDF)
ISBN 978-3-86793-571-5 (EPUB mit Videointerviews)
www.bertelsmann-stiftung.de/verlag
Inhalt
Vorwort
1 Die Lage
Vogelflug über ein reiches Land
Das ABC der Probleme: Von Akzeptanz bis Zuwendungen
Das Publikum und seine Perspektiven
Von nun an bergab? – Anbieter in einem schrumpfenden Markt
2 Die Maßnahmen: Praxis und Theorie der musikalischen Förderung
Musikunterricht: Fehlt
Musikvermittlung: Ersatzhandlungen?
Der Sinn der Sache: Klassische Musik als Förderfall
3 Die Aussichten: Musik und Gesellschaft
Change Management im Musikland
Kulturelle Inklusion
Musik und Angst
Kreativität
Zerstreutheit
Komplexitätstoleranz
Improvisation
Agenda »Musik in der Gesellschaft«:
Was getan werden kann
Videointerviews
4 Literatur
Der Autor
Summary
Vorwort
Der Reichtum des Musiklandes Deutschland ist gefährdet. Ein Unbehagen hat sich breitgemacht bei denen, die Musik, aus welchen Gründen immer, wichtig finden. Die folgenden Überlegungen möchten als Anregung verstanden sein, darüber nachzudenken, warum Musik nicht nur privates Vergnügen ist, sondern eine gesellschaftliche Größe, ein Energiepotenzial, das es in seinem ganzen Ausmaß vielleicht erst zu entdecken gilt. Es sollen Impulse gegeben werden, keine Rezepte. Trotzdem zielen sie auf die Praxis. Wer sich um die Musik in dieser Gesellschaft sorgt, muss Veränderungen wollen. Wer verändern will, muss sich darüber klar werden, wo ein solches Change Management überhaupt ansetzen kann. Davor liegt eine noch grundsätzlichere Frage: die nach dem Sinn der Unternehmung. Was sollen wir denn wollen und weshalb?
»Eine Verteidigung« – der Untertitel macht deutlich: Der Verfasser schätzt die Möglichkeit, dass wir die Reichtümer dieses Musiklandes verspielen könnten, als real ein und würde dies für ein Unglück halten. Weil die Zukunft der Musik stark von politischen – kultur- und gesellschaftspolitischen – Grundsatzentscheidungen abhängt, zielt das Folgende auf eine gesellschaftliche Auseinandersetzung um Legitimation und dabei geht es zunächst um Argumente. Gute Argumente sind das Ergebnis eines Nachdenkens. Der Autor findet, dass im musikalischen Betrieb zwar viel – gelegentlich verzweifelt – gehandelt, aber zu wenig nachgedacht wird. Doch gerade wenn die materiellen Spielräume enger werden, empfehlen sich Investitionen in Gedanken. Sie können nachhaltiger wirken als manche Leuchtturmprojekte, die der Betrieb liebt, weil sie schnelle Sichtbarkeit versprechen und weil mediale Aufmerksamkeit die gängige Währung des Betriebs geworden ist.
Teil 1 dieser Publikation dreht sich um die Fragen: Was haben wir, was haben wir zu verlieren, an welchen Stellen und wie ist das Musikland gefährdet? Teil 2 betrachtet die Maßnahmen, in denen sich musikalische Förderung darstellt, interessiert sich aber vor allem für die Begründungen solchen Engagements. Wenn die Beobachtung stimmt, dass die öffentlichen Aufwendungen für klassische Musik Gegenstand einer Legitimationsdebatte sind, die vernehmbar lauter, aber nicht eben differenzierter geführt wird – wofür etwa die Diskussion um die polemische Diagnose eines »Kulturinfarkts« ein Beispiel gibt (Haselbach et al. 2012) –, dann scheint es sinnvoll, die umlaufenden Legitimationsargumente auf ihre Stichhaltigkeit zu untersuchen.
In Teil 3 wird sortiert, wo man anknüpfen könnte, wenn man die Frage der klassischen Musik als grundsätzlich gesellschaftliche ansehen möchte. Dem kann man nicht ausweichen, wenn man die (unvermeidlich aufwendige) Pflege von Musik zur öffentlichen Aufgabe erklärt, die alle Steuerzahlenden in die Pflicht nimmt, nicht nur ihre Liebhaberinnen und Liebhaber. Und: Man sollte ihr gar nicht ausweichen wollen, denn gerade in ihren gesellschaftlichen, sozialen, kreativitätsstimulierenden Wirkungen liegt ein hoher Reiz – vieles, das nutzbar zu machen wäre, um diese komplizierte Welt ein wenig bewohnbarer zu machen.
Am Ende stehen sieben Thesen: Vorschläge, wo Veränderungsenergie ansetzen könnte. Daraus abgeleitet, schließen sich sieben Punkte einer möglichen Agenda an.
Dies ist ein dünnes Buch zu einem großen Thema. Es soll als Hinweisschild in einer unübersichtlichen Landschaft dienen, um zu zeigen, wo man weiterdenken und handeln könnte. Über Maßnahmen soll man streiten; vorher aber wäre es gut, sich über die Richtung zu verständigen.
1 Die Lage
Vogelflug über ein reiches Land
Deutschland ist reich. Das ist nicht nur eine Aussage über sein Bruttosozialprodukt, seine Produktivität oder seine Exportbilanz. Es ist auch eine Aussage über seinen kulturellen Reichtum und dabei vor allem über seine musikalische Kultur. Nirgends auf der Welt gibt es so viele Orchester, Chöre, Opernhäuser. Deutschland ist ein Musikland. Damit ist im Rahmen dieser Untersuchung vor allem die sogenannte ernste (E-) oder »klassische« Musik gemeint. Beide Begriffe sind unglücklich, aber schwer zu ersetzen. Zum Musikland Deutschland gehören selbstverständlich die Popularmusik, Rock, Pop, Jazz, aber auch Volksmusik und Weltmusik, alle Genres und Szenen. Die Fokussierung auf klassische Musik versucht, die spezifischen Probleme, die aktuell gerade dieses Genre begleiten, in den Blick zu nehmen.
Deutschland macht Musik: Mehr als fünf Millionen Laienmusikerinnen und -musiker zählt das Deutsche Musikinformationszentrum (Deutscher Musikrat, Orchester). Es wird gesungen, gestrichen, geblasen und gezupft, allein und vor allem in den 55.000 Chören und fast 40.000 Instrumentalensembles. In den 900 (im Verband deutscher Musikschulen organisierten) Musikschulen lernen 950.000 Menschen ein Instrument, darunter fast 900.000 Schülerinnen und Schüler unter 25 Jahren.
Deutschland hört Musik: In 81 Städten gibt es 84 Opernhäuser mit eigenem Ensemble. 7.309-mal ging in der Saison 2009/10 der Vorhang zu einer Opernaufführung hoch – das ist einsame Weltspitze. Auf Platz 2 folgen die USA mit 1.979, dann bereits Österreich mit 1.361 Vorstellungen. Ein Drittel aller Opernvorstellungen in der Welt sind in Deutschland zu sehen. 5.000 Musiker spielen in den Orchestern, 3.000 Sänger singen in den Chören, 1.300 Solisten sind fest angestellt (Operabase, Statistik).
Der Wirtschaftsjournalist Ralph Bollmann hat das Opernland Deutschland bereist (Bollmann 2011a und 2011b) und entdeckte dabei vor allem die deutsche Provinz in all ihrer Vielfalt und Verschiedenheit. Zwischen einem »Fidelio« in Neustrelitz und einer »Norma« im Münchener Nationaltheater liegen Welten, nicht nur beim Preis der Eintrittskarte. Und doch kann Wagners »Fliegender Holländer« im kleinen Opernhaus in Wuppertal-Barmen dringlicher und künstlerisch überzeugender klingen als das gleiche Stück an der Deutschen Oper Berlin. Die deutsche Opernlandschaft ist zerklüftet und ausdifferenziert; sie ist historisch gewachsen aus dem Erbe der alten Hoftheater und dem bürgerlichen Ehrgeiz, im eigenen Ort am Glanz gehobener Musikkultur teilzuhaben.
Das trifft in geringerem Maße auch auf die Konzertkultur des Landes zu. Was ein Konzerthaus ist, lässt sich im Vergleich zum Opernhaus weniger bestimmt sagen: Die Berliner Philharmonie, Hamburgs Laeiszhalle, das Konzerthaus Dortmund oder die Essener Philharmonie sind weitgehend spezifische Veranstaltungsorte klassischer Musik. Das Festspielhaus Baden-Baden kann auch Opern zeigen, die Kölner Philharmonie auch populäre Tanzveranstaltungen, der Gasteig versteht sich als »Zentrum des kulturellen Lebens in München«. So sind musikexklusive Konzerthäuser in Deutschland die Ausnahme, multifunktionale Konzertsäle in Mehrzweckhallen die Regel. Festzustellen ist allerdings ein aktueller Trend zu Neubauten: In Bonn und Bochum sind neue Konzerthäuser geplant, die Hamburger Elbphilharmonie befindet sich (wieder) im Bau, in Aachen wird ein »Haus für Musik« als Bürgerprojekt verfolgt, in Saarbrücken eine »Saarphilharmonie« geplant (Mörchen 2008).
Die Lust am Bau von Gehäusen für Musik, wie sie sich in der Vielzahl von Projekten und Plänen niederschlägt, ist fast überall begleitet von teils heftigen Diskussionen, in denen sich die Befürworter deutlicher Kritik ausgesetzt sehen – auch da, wo ein erheblicher Anteil der Finanzierung durch privates Engagement und Stiftungen aufgebracht wird. Es ergibt sich ein paradoxes Bild: Der gestiegenen Zahl der architektonisch anspruchsvollen, repräsentativen Spielstätten steht eine Reduktion der Mittel für die Musik selbst gegenüber. Die Deutsche Orchestervereinigung (DOV) beklagt die in den vergangenen zwanzig Jahren deutlich gesunkene Zahl an Kulturorchestern von 168 auf aktuell (2012) 132 und damit verbunden einen Abbau von Musikerstellen von 12.000 auf unter 10.000 (DOV 2012).
Abbildung 1: Opernhäuser in Deutschland
Auf die Verluste und die Akzeptanzprobleme der klassischen Musikkultur wird noch genauer einzugehen sein. Hier ist zunächst festzuhalten: Auch 132 Symphonieorchester bieten reichlich Musik an. Für die Saison 2009/10 wurden in knapp 11.000 Konzerten der Kulturorchester rund 4,5 Millionen Hörerinnen und Hörer gezählt (Deutscher Musikrat, Konzertveranstaltungen). Insgesamt etwa zehn Millionen Besucherinnen und Besucher kommen jährlich in Konzerten und Musiktheatern zusammen (Bollmann 2011a). Das entspricht etwa der Zahl der Stadionbesuche in der Fußball-Bundesliga.
Deutschland ist tatsächlich ein reiches Musikland.
Noch.
Das ABC der Probleme: Von Akzeptanz bis Zuwendungen
Die Zahlen über das allmähliche Verschwinden von Symphonieorchestern trüben das Bild des blühenden Musiklandes. Tatsächlich ist sein Reichtum aus einer ganzen Reihe von Gründen gefährdet, die schon einzeln genommen schwer wiegen. Zusammen verdüstern sie den Himmel sehr deutlich. Wer sich um das Musikland Deutschland sorgt, muss das ABC seiner Probleme zur Kenntnis nehmen. Erst das Gesamtbild der Schwierigkeiten kann die Chance bieten, Gegenstrategien zu entwickeln.
Fangen wir da an, wo die Freundschaft aufhört – beim Geld: etwa den Zuwendungen, auf die der Musikbetrieb angewiesen ist, weil die Präsenz klassischer Musik in der Regel an Aufführungen geknüpft ist, weil diese Aufführungen personalintensiv sind, an Institutionen gebunden und damit teuer. Die tatsächlichen Kosten sind über die Eintrittspreise nicht zu finanzieren. Das war immer so. Doch zu Zeiten, als Opern und symphonische Musik fürstliche Repräsentationsbedürfnisse befriedigten, spielte Geld keine Rolle. An die Stelle der fürstlichen Mäzene sind die öffentlichen Geldgeber getreten; hierzulande sind das vor allem die Kommunen und die Bundesländer. Je mehr deren Haushalte unter Druck geraten, desto stärker sieht sich auch die öffentlich subventionierte Kultur in einer Diskussion über die Notwendigkeit ihrer Existenz.
In den kommunalen Haushalten läuft Kultur unter »freiwillige Leistung«. Freiwillig aber heißt: nicht notwendig. Die Zuwendungen etwa an das städtische Opernhaus oder das örtliche Symphonieorchester zählen deshalb zu den wenigen Positionen, an denen eine verschuldete Stadt überhaupt etwas sparen kann. Oder sparen zu können glaubt. Allein um den Anstieg der Zinslast des bankrotten Berlin auszugleichen, müsse er sieben Opernhäuser schließen, rechnete einst Thilo Sarrazin vor, als er noch Finanzsenator der Hauptstadt war – um sarkastisch hinzuzufügen, man habe ja aber nur drei. Das war nicht die Bemerkung eines Musikliebhabers, sie macht allerdings deutlich, dass trotz der weltweit einmalig hohen Dichte der musikalisch-kulturellen Infrastruktur deren Abbau kein effektiver Schritt der Schuldenreduktion sein kann.
Wenn eine mittlere Kommune wie Wuppertal eine Belastung von 1,8 Milliarden Euro vor sich herschiebt, nimmt sich die Kürzung des Betriebskostenzuschusses an die Städtischen Bühnen von zwei Millionen kaum als substanzielle Erleichterung aus – sie dient aber zumindest in der Außenkommunikation als Beleg, etwas getan zu haben. Exemplarisch sind die Folgen eines solchen Sparbeschlusses: Da die Kürzung genau dem Etat des Schauspiels entsprach, wurde dessen Schließung diskutiert – allerdings nicht vollzogen, sondern der Mangel wurde verteilt. So gibt es weiterhin Schauspiel und Oper in Wuppertal, und beide eigentlich unterfinanziert.
Exemplarisch daran ist, dass die Schließung ganzer Sparten in der Regel vermieden wird, weil dies schlechte Nachrichten produziert. Es wird irgendwie weitergemacht. Es spricht für das Engagement der Wuppertaler Bühnen, dass man sich gegen die schleichende Verödung mit Qualität und Kunstwollen wehrt. An anderen kleinen Häusern ist der Mangel schon betrüblich sichtbar geworden. Ökonom Bollmann: »Der Mechanismus ist immer der gleiche: Kommunal- oder Landespolitiker setzen bei ihren Kulturbetrieben den Rotstift an – und provozieren einen Aufschrei des kulturbeflissenen Publikums. Am Ende geht es mit dem Musiktheater irgendwie weiter, aber an den Häusern bleibt in einer breiteren Öffentlichkeit der Ruf hängen, sie verträten ein sterbendes Genre« (Bollmann 2011a).
Tatsächlich gehört der Aufschrei des kulturbeflissenen Publikums zu den Ritualen der kommunalen Kürzungsdramen. Dazu gehört auf der anderen Seite der Einspruch kritischer Nichtbesucher: Man sehe gar nicht ein, den Kulturbeflissenen ihre Spezialinteressen steuerlich mitzufinanzieren. (Zu den weiteren Rollen dieses recht formalisierten Dramentyps gehören der Kämmerer als Advocatus Diaboli und der Oberbürgermeister als schwacher König, der das Schlimmste verhindert, aber nicht die Kraft zu mehr als traurigen Kompromissen hat.)
Daraus folgt: Die Verödung des Musiklandes Deutschland geht nicht schlagartig, sondern schleichend vonstatten. Aber gerade das »irgendwie weiter« des Betriebs könnte eine Abwärtsspirale in Gang setzen, in der mangelnde Qualität und nachlassende Wertschätzung sich als selbst verstärkende Faktoren erweisen. An dieser Stelle zeigt sich die ökonomische Krise verschlungen mit einer womöglich noch fataleren Tendenz: einer Krise der Akzeptanz.
Tatsächlich? Die im Auftrag der Bertelsmann Stiftung erstellte Studie »Klassische Musik« (TNS Emnid 2010) stellt als Ergebnis einer repräsentativen Befragung fest:
• 88 Prozent der Befragten halten die Weitergabe des musikalischen Erbes für wichtig.
• 96 Prozent halten Musikunterricht in Kindergärten und Schulen für »eher wichtig«, davon 65 Prozent sogar für »sehr wichtig«.
• Die Frage »Gehören für Sie klassische Musik und Oper zu den wichtigen Kulturgütern unserer Gesellschaft, die gefördert werden sollten?« beantworteten 67 Prozent mit Ja.
Diese Zahlen spiegeln auf den ersten Blick eine erfreuliche Wertschätzung klassischer Musik. Dazu gehört auch, dass jeder und jede zweite Befragte angab, ein Instrument zu spielen – und zugleich eine große Mehrheit das aktive Musizieren für den besten Weg hält, Kinder und Jugendliche für Klassik und Oper zu interessieren. Auch der Befund »mehr als ein Drittel hört mindestens einmal die Woche klassische Musik« klingt positiv.
Vieles spricht dafür, die überwiegende Zustimmung und Aufgeschlossenheit gegenüber Angeboten der klassischen Musikkultur als Indikatoren für ein immer noch vorhandenes Bewusstsein der Bedeutung eines musikalischen Erbes zu verstehen.
Damit ist zunächst ein Potenzial von grundsätzlicher »Erreichbarkeit« beschrieben. Doch die Dynamik der Entwicklung geht deutlich in die andere Richtung: Unter den 14- bis 29-Jährigen sinkt die Zustimmung für die – schon recht unverbindliche – »Weitergabe des musikalischen Erbes an die kommenden Generationen« auf 76 Prozent. Etwas grundsätzlich wichtig zu finden, bedeutet noch nicht, daran partizipieren zu wollen. Und liest man das Ergebnis von der negativen Seite, ließe sich auch sagen: Fast ein Viertel der nachwachsenden Generation hält den Bestand und die Pflege des musikalischen Erbes nicht mehr für relevant. Ähnliches gilt auch für die Frage nach der Förderungswürdigkeit von klassischer Musik und Oper, für die sich 67 Prozent aussprechen.
Abbildung 2: Eine deutliche Mehrheit hält die Weitergabe des musikalischen Erbes für wichtig
Frage: »Deutschland hat viele klassische Komponisten und weltberühmte Opern hervorgebracht. Halten Sie es für wichtig, dass dieses Erbe an klassischer Musik an die kommenden Generationen weitergegeben wird?«
Ist das eine große Zahl? Gehen diese Menschen in Konzerte? Nutzen sie die Angebote? Nein. »Nur acht Prozent der Bevölkerung in Deutschland gehören zu den regelmäßigen Nutzern kultureller Angebote, die vorrangig von den öffentlich geförderten Kultureinrichtungen bereitgestellt werden«, stellt eine Studie über den Zusammenhang zwischen demographischem Wandel und den ableitbaren Folgen für das Kulturpublikum fest. Und: »Diese sogenannten Kernkulturnutzer (die mindestens zwölfmal pro Jahr Kulturveranstaltungen besuchen) sind in der Regel an vielen Kunst-Sparten gleichzeitig interessiert« (Mandel 2010: 16).
Auf welcher Grundlage halten drei Viertel der Bevölkerung also die Förderung von klassischer Musik, etwa durch die Aufwendung öffentlicher Mittel, für sinnvoll? Es ist anzunehmen, dass dies nicht auf der Grundlage eigener Übung und Erfahrung geschieht – ein Befund, der sich mit einem Ergebnis der Untersuchung von Mandel über die »Nicht-Kulturnutzer« deckt: »Kultur wird mehrheitlich als wertvoll für die Gesellschaft erachtet, nicht jedoch für das persönliche Leben (…). Das Image von Kultur ist bestimmt von einem Hochkultur-Bild. Unter Kultur wird vor allem das verstanden, was von den traditionellen Kultureinrichtungen, den Theatern, Opern, Konzerthäusern und Museen angeboten wird. Das, was von vielen selbst gerne wahrgenommen wird, vor allem im Bereich Populärkultur, wird nicht als Kultur wertgeschätzt« (ebd.).
Die Einstellung einer Mehrheit lässt sich demnach so zusammenfassen: »Kultur ist da, wo ich nicht bin« (ebd.: 17).
Man hält etwas für wichtig, doch für die meisten ist das eine vage Wahrnehmung, die nicht auf eigenen Erfahrungen gründet. Dazu passt, dass auf die Frage »Wo überall begegnet Ihnen klassische Musik?« als häufigster Begegnungsort das Fernsehen (67%) genannt wurde, vor Radio (59%), Werbung (49%) und »im Kaufhaus« (27%). Das Fernsehen wird also immer noch als wichtigstes Fenster zur Welt wahrgenommen – auch als der Ort, an dem eine Begegnung mit klassischer Musik für möglich gehalten wird; es widerspricht allerdings der Empirie, nach der Musik auch in den öffentlich-rechtlichen Fernsehprogrammen fast nicht stattfindet (Deutscher Musikrat, Fernsehprogramme). Ein Schnipsel Strauss zur atmosphärischen Aufwertung einer Dokumentation über die Alpen, »La donna è mobile« zur Verstärkung des Kaufimpulses für Tiefkühlpizza ändern nichts daran, dass klassische Musik auch für das öffentlich-rechtliche Programm fast kein Thema ist.
So vielversprechend der Zustimmungswert 67 Prozent für die Förderung klassischer Musikangebote erscheint, steht er doch auf einer wackligen Basis. Und auch hier lässt sich die Perspektive ändern: Man kann auch sagen, dass 33 Prozent klassische Musik nicht