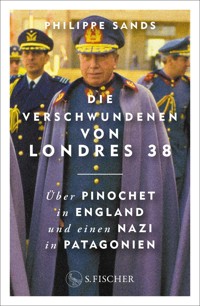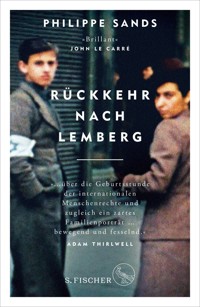19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Der bekannte Menschenrechtsanwalt und Bestseller-Autor Philippe Sands erzählt die skandalöse Geschichte eines Verstoßes gegen die Menschenrechte. Er zeigt, dass der Kolonialismus noch nicht überwunden ist undGroßbritannien bis heute internationales Recht bricht. April 1973. Mitten in der Nacht werden die Bewohner einer Insel im Chagos-Archipel aus dem Schlaf gerissen. Britische Soldaten zwingen sie mit vorgehaltenen Waffen, ihre Häuser zu verlassen, per Schiff werden sie nach Mauritius und in die USA deportiert. Chagos wird zu britischem Territorium erklärt, Großbritannien verpachtet eine der Inseln für eine Militärbasis an die USA. »Wir waren wie Tiere oder Sklaven auf diesem Schiff. Einige starben vor Kummer. (...) Es bricht einem das Herz.« Mit diesen Worten beschrieb Liseby Elysé 2018 vor dem Internationalen Gerichtshof ihre Deportation. Seit Jahrzehnten streiten sie und ihre Landsleute um das Recht auf Rückkehr, seit 2018 werden sie dabei von Philippe Sands beraten. 2019 schrieb der Internationale Gerichtshof die Chagos-Inseln Mauritius zu, was der Internationale Seegerichtshof 2021 bestätigte. Doch Großbritannien verweigerte weiterhin die Rückgabe der Inseln und die Rückkehr ihrer Bewohner. Erst im Oktober verkündete es, die Hoheit über die Inseln an Mauritius zu übertragen. Damit wird Liseby Elysés Traum, ihre letzten Lebensjahre in ihrer Heimat zu beenden und neben ihren Vorfahren begraben zu werden, endlich wahr. Nur die Insel Diego Garcia bleibt noch für 99 Jahre ein US-Militärstützpunkt. Ein aufrüttelndes Buch über kolonialen Dünkel und die Missachtung von Menschenrechten – und über die Kraft des Internationalen Rechts. »Elegant geschrieben, bewegend und höchst informativ.« Literary Review
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 301
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Philippe Sands
Die letzte Kolonie
Verbrechen gegen die Menschlichkeit im Indischen Ozean
Über dieses Buch
Der Kolonialismus ist noch nicht überwunden – wie Großbritannien bis heute internationales Recht bricht
April 1973. Mitten in der Nacht werden die Bewohner*innen einer Insel im Chagos-Archipel aus dem Schlaf gerissen. Britische Soldaten zwingen sie mit vorgehaltenen Waffen, ihre Häuser zu verlassen, und deportieren sie nach Mauritius. Chagos wird zur Kolonie erklärt, um dort eine Militärstation zu errichten.
Seit den 1990ern streiten die Menschen aus Chagos vor Gericht um das Recht auf Rückkehr, beraten vom Menschenrechtsanwalt Philippe Sands. Hier erzählt er die bewegende Geschichte ihres Kampfes gegen das erzwungene Exil. Im Mittelpunkt steht Liseby Elysé, eine mutige Frau, die nicht aufgibt, bevor sie nicht in ihre Heimat zurückkehren kann, um dort alt zu werden und die letzte Ruhe zu finden.
2019 schrieb der Internationale Gerichtshof in einem Gutachten die Chagos-Inseln Mauritius zu. Doch Madame Elysés Kampf geht weiter: Großbritannien verweigert ihr und ihren Landsleuten bis heute die Rückkehr – ein Verstoß gegen die Menschenrechte.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Philippe Sands, geboren 1960, ist Anwalt und Professor für Internationales Recht und Direktor des Centre for International Courts and Tribunals am University College London. Leidenschaftlich setzt er sich für humanitäre Ziele und das Völkerrecht ein. Er formulierte u. a. die Anklage gegen den chilenischen Diktator Pinochet. Er ist ein internationaler Bestseller-Autor, »Rückkehr nach Lemberg« wurde 2016 mit dem Baillie Gifford Prize und dem Wingate Literaturpreis ausgezeichnet.
Das erzwungene Exil der Chagossianer ist für ihn ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit und eine Missachtung der Menschenrechte. Noch ist das Unrecht nicht beendet – ein Grund für Philippe Sands, davon zu berichten.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Impressum
Erschienen bei FISCHER E-Books
Die Originalausgabe erschien 2022 unter dem Titel »The Last Colony. A Tale of Exile, Justice and Britain's Colonial Legacy« bei Weidenfeld & Nicolson, einem Imprint der Orion Publishing Group Ltd., London.
Copyright © Philippe Sands 2022
Illustrationen © Martin Rowson 2022
Für die deutsche Ausgabe:
© 2023 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main
Covergestaltung: Schiller Design, Frankfurt nach einer Idee von Orion Books
Coverabbildung: Der Steg von Peros Banhos in den 1960er Jahren
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-491587-6
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
Widmung
Motto
Mitteilung an den Leser
Prolog: »La Cour!«
I 1945
Neufundland
Deportation
Peros Banhos
Liseby, 1953
II 1966
Resolution 1514
Südwestafrika
Trennung
Liseby, 1973
III 1984
Camp Justice
Das Meer
Nicaragua
Madame Elysé, 1984
Der 11. September
IV 2003
Madame Elysé, 2006
»Freitage«
Istanbul
New York
Resolution 71/292
V 2019
Die Wahl
Die Plädoyers
Madame Elysé, 2018
La Cour!
Die Entscheidung
Rückkehr nach New York
Epilog: Bleu de Nîmes
Februar 2022
Postskriptum
Dank
Bildnachweis
Anmerkung des Illustrators
Schlüssel zu den Illustrationen
Weiterführende Literatur
Anmerkungen
Register
Gewidmet dem Andenken an
James Crawford (1948–2021) und
Louise Rands Silva (1964–2021
»Was ist eine Kolonie,
wenn nicht die brutale Wahrheit,
dass die Gräber sich öffnen,
sobald wir reden.
Und die Toten leben?«
Eavan Boland, »Witness«, 1998
Mitteilung an den Leser
Dies ist eine wahre Geschichte, erstmals erzählt in einer Reihe von Vorträgen, die ich im Sommer 2022 an der Haager Akademie für Völkerrecht hielt. Als Beteiligter an Teilen dieser Geschichte bin ich kein unabhängiger Beobachter und verstehe, dass man die Ereignisse aus unterschiedlichen Blickwinkeln betrachten und zu unterschiedlichen Deutungen gelangen kann. Ich habe versucht, eine persönliche, gleichwohl auf Fairness und Ausgewogenheit bedachte Darstellung vorzulegen.
Die Geschichte, die kaum bekannt ist und ein breiteres Publikum verdient, besteht genau genommen aus einer Reihe miteinander verwobener Geschichten. Eine handelt vom Internationalen Gerichtshof in Den Haag und von dessen Rolle beim allmählichen Niedergang des Kolonialismus, wobei das Hauptaugenmerk schlussendlich auf dem Fall Mauritius liegt. Eine andere ist persönlicher: mein eigenes, sich ständig weiterentwickelndes Verhältnis zur Welt des Völkerrechts. Und eine dritte, das Herzstück dieses Buches, ist die Geschichte von Liseby Elysé – die Geschichte des Unrechts, das ihr und anderen Chagossianern zugefügt wurde, und von ihrer Suche nach Gerechtigkeit, die bis auf den heutigen Tag andauert.
Ich habe mich bemüht einzufangen, was Madame Elysé mir während vieler gemeinsam verbrachter Stunden, in denen wir den Text und die Ereignisse durchgingen, anvertraute, und ihren Erinnerungen gerecht zu werden. Ich hoffe, dass unsere Zusammenarbeit und unsere Freundschaft ihren Erwartungen entsprechen. Wir entstammen unterschiedlichen Verhältnissen, doch unsere Wege verbanden sich, über rechtsstaatliche Verfahren und Gerichtsprozesse, die allmählich den Vorhang über der Kolonialzeit schlossen, in die Madame Elysé hineingeboren wurde und in der sie lebte und in der mein Berufsleben seine Prägung erfuhr.
Bei der Abfassung dieses Berichts über Chagos habe ich mit Martin Rowson zusammengearbeitet, der eine visuelle Interpretation der bahnbrechenden Fälle beisteuerte, die in jedem Kapitel kurz gestreift und in den historischen Kontext eingebettet werden.
London und Bonnieux
Juli 2022
Prolog: »La Cour!«
»Der Chagos-Archipel. Ein Name, so seidenweich wie ein Streicheln, so brennend wie die Sehnsucht, so hart wie der Tod …«
Shenaz Patel, Die Stille von Chagos, 2017
»La Cour!« Die Worte wurden an einem Sommermorgen in Den Haag feierlich von einem Mann in Amtstracht ausgerufen, vor seiner Brust hing eine eindrucksvolle Silberkette, ein Symbol der Autorität. Wie seit vielen Jahrzehnten eingespielt, verkündete er den Einzug der Richter. In plissierten schwarzen Roben betraten sie gesetzten Schrittes den Großen Saal des Friedenspalastes, wo sie sich in Reih und Glied zu ihren Plätzen hinter einem sehr langen Tisch begaben. In ihrer Mitte der Präsident, ein ruhiger Mann aus Somalia, der aus eigener Erfahrung wusste, was es bedeutete, Empfänger britischen und italienischen kolonialen Edelmuts zu sein. Er sah sich im Gerichtssaal um, blickte auf die Reihen von Anwälten und Diplomaten, Journalisten und Übersetzern, umrahmt von riesigen Buntglasfenstern und Kristallleuchtern, dann forderte er uns auf, Platz zu nehmen.
Direkt hinter mir, in der zweiten Reihe, saß eine schwarz gekleidete zierliche Dame, und die kleine Handtasche, die sie umklammert hielt, verlieh ihr ein förmliches, würdevolles Aussehen. Sie war aus dem fernen Mauritius als Mitglied der Delegation dieses Staates angereist. Sie war hier, um eine Geschichte zu erzählen, eine kurze Geschichte über ihre Jugendjahre, in der Hoffnung, dass ihr Bericht die Entscheidung der 14 Richter vielleicht in eine Richtung lenkte, die ihr ermöglichen konnte, an den Ort zurückzukehren, an dem sie geboren wurde. Ihre Heimat, im wahren Sinne, dort, wo das Herz ist, war Peros Banhos, ein Atoll, das zu einem Archipel namens Chagos gehört, der inmitten der Weiten des Indischen Ozeans liegt. Von dort war sie vor fünf Jahrzehnten zusammen mit Hunderten anderer Chagossianer zwangsumgesiedelt worden.
Liseby Elysé lebte bis zu ihrem 20. Lebensjahr glücklich auf einer der Inseln von Peros Banhos. Dann wurde sie eines Frühlingstages ohne Vorwarnung von den britischen Behörden aus ihrem Haus geholt, sie durfte einen einzigen Koffer mitnehmen, und man befahl ihr, an Bord eines Schiffes zu gehen, das sie tausend Meilen weit weg befördern würde. »Die Insel wird Sperrgebiet«, teilte man ihr mit. Niemand erklärte ihr, warum. Niemand erwähnte eine neue Militärbasis, welche die Amerikaner auf einer anderen Insel des Archipels, Diego Garcia, mit britischer Erlaubnis errichteten. Und niemand sagte ihr, dass Chagos, das lange zu Mauritius gehört hatte, von diesem Territorium abgetrennt worden war und nun eine neue Kolonie in Afrika war, bekannt als »Britisches Territorium im Indischen Ozean«. Madame Elysé und die gesamte Gemeinschaft von etwa 1500 Menschen, fast alle Schwarz und viele von ihnen Nachfahren versklavter Plantagenarbeiter, wurden gezwungen, ihre Heimatorte zu verlassen, und deportiert.
Madame Elysé war in Den Haag, um in einem ihre Inseln betreffenden Rechtsfall auszusagen. Die 14 Richter wussten noch nicht, wer sie war oder welche Rolle sie in dem Verfahren spielte. Sie würden Argumente in Bezug auf Großbritanniens letzte Kolonie in Afrika hören, erfahren, wie sie von Mauritius abgetrennt wurde, und sie würden entscheiden, ob sie völkerrechtlich zu Mauritius oder zu Großbritannien gehörte. Die Richter würden sich mit historischen Fragen und mit Aspekten der Kolonialherrschaft befassen, dabei völkerrechtliche Probleme von »Rasse« und Recht erörtern. Sie würden sich mit dem Prinzip der »Selbstbestimmung« beschäftigen und am Ende darüber urteilen, ob eine Gruppe von Menschen selbst über ihr Schicksal entscheiden durfte oder ob diese Menschen sich von anderen diktieren lassen mussten, wie ihr Leben zu verlaufen hatte.
Madame Elysé war eine Zeugin für Mauritius, den afrikanischen Staat, den ich in diesem Fall vertrat. Sie würde im Namen der Chagossianer sprechen, in ihrer Kreolsprache, mit Klarheit, Kraft und Leidenschaft. Weil sie weder lesen noch schreiben konnte, hatten die Richter eingewilligt, dass sie mittels einer vorher aufgezeichneten Erklärung aussagen würde. Sie würde sie währenddessen beobachten, so wie die Richter sie beobachteten, eine Frau in einem schwarzen Kostüm und einer spitzengeränderten weißen Bluse, am Revers eine kleine blau-rote Plakette, die forderte: »Let Us Return!«, »Lasst uns zurückkehren!«
Der Präsident eröffnete das Verfahren mit einer kurzen Zusammenfassung des Falles, dann bat er den ersten Sprecher, sich an das Gericht zu wenden. Langsam begab sich Sir Anerood Jugnauth – 88 Jahre alt, ehemaliger Premierminister von Mauritius, Mitglied der höheren Anwaltschaft von England und Wales, Queen’s Counsel (Kronanwalt) – zum Podium. Er sprach exakt 15 Minuten, es folgten zwei weitere Anwälte, eine kurze Kaffeepause und dann ein dritter Anwalt. Er und die Rechtsanwälte lasen von vorbereiteten Skripten ab, was für die Richter wie das Publikum eine gewisse Theateratmosphäre aufkommen ließ. Die Richter unterbrachen weder, noch stellten sie Fragen.
Dann begab ich mich zum Podium. Ich hatte schon viele Male zu diesem Gericht gesprochen, war diesmal jedoch angespannter als sonst. Madame Elysé, die jetzt in der ersten Reihe saß, stand kurz auf, als ich sie vorstellte. »Das Gericht sollte die Stimme der Chagossianer direkt hören«, erklärte ich, damit es ein Gespür für die Realitäten der Kolonialherrschaft bekommen würde.
Madame Elysés Erklärung wurde auf zwei große Bildschirme projiziert, die über den Richtern hingen, Worte und Bilder wurden weltweit ausgestrahlt. Im fernen Port Louis, der Hauptstadt von Mauritius, wurde das Verfahren live im Staatsfernsehen übertragen, und die Freunde von Madame Elysé hatten sich zum Zuschauen in einem Gemeindezentrum versammelt. Sie weinten, als sie sprach.
»Mappel Liseby Elysé.«
»Mein Name ist Liseby Elysé.« Die Übersetzung erschien in Englisch und Französisch in Form gut lesbarer Untertitel unten auf dem Bildschirm.
»Ich wurde am 24. Juli 1953 auf Peros Banhos geboren. Mein Vater wurde auf Six Îles geboren. Meine Mutter wurde auf Peros Banhos geboren. Meine Großeltern wurden auch dort geboren. Ich gehöre zur Delegation von Mauritius. Ich erzähle nun, wie ich gelitten habe, seit ich von meiner paradiesischen Insel entwurzelt worden bin. Ich bin froh, dass der Internationale Gerichtshof uns heute anhört. Und ich bin zuversichtlich, dass ich auf die Insel zurückkehren werde, auf der ich geboren wurde.«
Bei diesen Worten änderte sich die Stimmung in dem Großen Saal. Plötzlich war eine lastende Stille zu spüren, eine Stille, wie sie einen bedeutungsvollen Moment in einem öffentlichen Raum begleitet, eine Stille von der Art, wie man ihr in einem Theater oder Konzertsaal begegnet, wenn ein Künstler Kontakt mit einem Publikum herstellt, dessen Aufmerksamkeit so gefesselt wie gespannt ist. Während Madame Elysé sprach, ohne Skript, blickte der Präsident, der nur gut einen Meter entfernt saß, in ihre Richtung, derweil die Erinnerungen hervorpurzelten, in harten und eindringlichen Worten, die einen Kontrapunkt zum Prunk des Großen Saals bildeten:
»Jeder hatte eine Arbeit, seine Familie und seine Kultur. Aber wir aßen ausschließlich frische Nahrungsmittel. Schiffe, die von Mauritius kamen, brachten alle unsere Waren. Wie erhielten unsere Lebensmittel. Wir bekamen alles, was wir brauchten. Es mangelte uns an nichts. Auf Chagos führte jeder ein glückliches Leben.«
Der Tonfall änderte sich, wurde weniger sanft:
»Eines Tages sagte uns der Verwalter, dass wir unsere Insel verlassen, unsere Häuser verlassen und fortgehen müssten. Alle Menschen waren unglücklich. Sie waren wütend, dass man uns sagte, wir müssten fortgehen. Aber wir hatten keine Wahl. Sie nannten uns keinen Grund. Bis heute hat man uns nicht gesagt, warum wir gehen mussten. Aber danach kamen die Schiffe, die früher immer Nahrungsmittel gebracht hatten, nicht mehr. Wir hatten nichts zu essen. Keine Medizin. Überhaupt nichts. Wir litten viel. Aber dann eines Tages kam ein Schiff namens Nordvær.«
Madame Elysé hielt inne:
»Der Verwalter sagte uns, wir müssten an Bord des Schiffes gehen, alles hierlassen, alle unsere persönlichen Habseligkeiten zurücklassen, außer ein paar Kleidungsstücken, und weggehen. Die Leute waren sehr wütend darüber, und all das spielte sich im Dunkeln ab.«
Sie hielt abermals inne, während sie die Stirn runzelte. Sie nannte weder den Verwalter – Monsieur Willis-Pierre Prosper – beim Namen, noch nannte sie das Datum. Es war der Abend des 27. April 1973, bei Einbruch der Dämmerung:
»Wir gingen im Dunkeln an Bord des Schiffes, so dass wir unsere Insel nicht sehen konnten. Und als wir an Bord gingen, waren die Zustände im Bauch des Schiffes schlimm. Wir waren wie Tiere und Sklaven auf diesem Schiff. Die Leute starben an Traurigkeit auf diesem Schiff.«
»Tiere«. »Sklaven«. Madame Elysé spuckte die Worte aus:
»Und was mich betraf, ich war damals im vierten Monat schwanger. Das Schiff brauchte vier Tage, um Mauritius zu erreichen. Nach unserer Ankunft wurde mein Kind geboren und starb. Warum ist mein Kind gestorben? Ich denke, es starb, weil ich traumatisiert wurde auf diesem Schiff. Ich war sehr bekümmert, ich war durcheinander. Darum starb mein Kind, als es geboren wurde.«
Sie kniff die Lippen zusammen:
»Ich bleibe dabei, wir dürfen die Hoffnung nicht verlieren. Wir müssen daran glauben, dass der Tag kommen wird, wenn wir auf das Land zurückkehren werden, auf dem wir geboren wurden. Mein Herz leidet, und mein Herz gehört nach wie vor der Insel, auf der ich geboren wurde.«
Unmerklich zoomte die Kamera heran, Madame Elysés Entschlossenheit und aufsteigende Wut unterstreichend:
»Niemandem würde es gefallen, von der Insel entwurzelt zu werden, auf der er geboren wurde, entwurzelt zu werden wie ein Tier. Es zerreißt einem das Herz. Und ich bleibe dabei, es muss Gerechtigkeit geübt werden.«
Sie schien sich zu quälen, schien ihre Emotionen, ihren tiefen Quell der Wut zu zügeln, doch sie konnte nicht an sich halten. Es war, als würden sich Jahrzehnte aufgestauter Gefühle, Wut und Hoffnung Bahn brechen:
»Ich muss auf die Insel zurückkehren, wo ich geboren wurde. Meinen Sie nicht, dass es einem das Herz zerreißt, wenn jemand von seiner Insel entwurzelt wird wie ein Tier, und er weiß nicht, wohin er gebracht wird?«
Madame Elysé versagte die Stimme, ein Tremolo jenseits der Stille:
»Und ich bin sehr traurig. Ich weiß noch immer nicht, wie ich mein Chagos verließ. Sie haben uns gewaltsam vertrieben. Und ich bin sehr traurig.«
Sie schwieg und schloss die Augen:
»Mir kommen ständig jeden Tag die Tränen. Ich denke ständig, ich muss auf meine Insel zurückkehren.«
Dann, endlich, ließ sie alles heraus:
»Ich bleibe dabei, ich muss auf die Insel zurückkehren, auf der ich geboren wurde, und ich muss dort und wo meine Großeltern begraben wurden sterben. An dem Ort, an dem ich geboren wurde, und auf meiner Heimatinsel.«
Sie holte tief Luft, atmete aus, wischte sich mit einer Hand über das Gesicht, wie in einer großen reinigenden Bewegung, blickte dann in die Kamera, wandte sich ab und ließ den Kopf sinken. Sie weinte. Wie mochten die Richter auf eine so aufrichtige und ungewöhnliche Gefühlsäußerung an einem so ehrwürdigen Ort der Gerechtigkeit reagieren?
Madame Elysé hatte drei Minuten und 47 Sekunden gesprochen.
Die Stille, die folgte, schien endlos. Während ich auf dem Podium stand, erfüllte ein zartes Geräusch den Großen Saal des Friedenspalastes, das Geräusch von leisem Schluchzen und Tränen, die geweint wurden.
Ich wartete, um mich dann an das Gericht zu wenden.
Später, als ich nach dem Ende der morgendlichen Sitzung mit Madame Elysé vor dem Großen Saal stand, schaute sie mich mit einem Gefühl der Erleichterung an, während ein warmes Lächeln ihr Gesicht überzog.
»Ist es gut gelaufen?«
»Ja.«
»Darf ich eine Frage stellen?«
»Ja.«
»Warum haben wir so lange gebraucht, um nach Den Haag zu kommen?«
I1945
»Der einzelne Mensch (…) ist die höchste Einheit allen Rechts.«
Hersch Lauterpacht, 1943
Um die von Madame Elysé gestellte Frage zu beantworten, ist es notwendig, zu einem Wintertag in Cleveland, Ohio, zurückzugehen. Auf einem anderen Podium stehend, hielt Ralph Bunche im Februar 1945 vor dem Cleveland Council on World Affairs, einem Netzwerk aus 93 unabhängigen und überparteilichen Organisationen aus 40 US-Bundesstaaten, einen leidenschaftlichen Vortrag über den Kolonialismus und dessen Zukunft. Bunche, ein Beamter des US State Department, des amerikanischen Außenministeriums, war ein Schwarzer Amerikaner und ein ausgezeichneter Kenner der britischen und französischen Verwaltung in Afrika. Sein Vortrag war eine kernige Reaktion auf eine Meinung, die Arthur Creech Jones, der Kolonialismusexperte der britischen Labour Party, vor kurzem ihm gegenüber geäußert hatte. Vor die Wahl gestellt zwischen langsamem Fortschritt unter britischer Vorherrschaft oder Freiheit unter neuen internationalen Regeln, hatte Creech Jones erklärt, würden die Kolonisierten sich für die erste Alternative entscheiden. Und, fügte er hinzu, Bunche solle seine gefährlichen Ideen über Dekolonisierung auf sich selbst und auf die 15 Millionen Schwarzen Einwohner der Vereinigten Staaten anwenden.
»Die moderne Welt ist zu der Erkenntnis gelangt, dass die Fortschreibung des kolonialen Systems eine bedeutende moralische Frage mit sich bringt«, erklärte Dr. Bunche in Erwiderung auf Creech Jones. Sei ein einziges Volk berechtigt, dauerhaft über ein anderes zu herrschen? Nein. In den kommenden Wochen sollte Bunche Gelegenheit haben, diesen Gedanken in die Tat umzusetzen, und zwar bei den Verhandlungen über ein neues internationales Abkommen, die »Charta«, welche die Vereinten Nationen begründen und den formellen Prozess der Beendigung des Kolonialismus einleiten würde. Bunche sprach als Experte, als das Mitglied der die »Charta« aushandelnden US-Delegation, das den Auftrag hatte, Einigung über die Dekolonisierung zu erzielen. Ein paar Wochen später, im April 1945, als im Opernhaus von San Francisco die Arbeit an dem internationalen Abkommen richtig begann, schrieb er an seine Frau: »Ich war an diesem Nachmittag wirklich ein bisschen stolz, dass ich der einzige ›Neger‹ war, der im Parkett saß.«
Der Entwurfsprozess dauerte acht Wochen, das Ergebnis spiegelte sich in Kapitel XI der UN-Charta wider, einer »Erklärung über Hoheitsgebiete ohne Selbstregierung«. Ein Delegierter nannte den Text die möglicherweise »weitreichendste jemals verfasste Erklärung zur Kolonialgeschichte«. Bunche erkannte die Grenzen seiner Bemühungen, als er die Hoffnung ausdrückte, dass die neuen Regeln in gutem Glauben vorangebracht und umgesetzt würden. Er konnte nicht wissen, dass seine Arbeit eine Tür öffnen würde, durch die viele Jahrzehnte später Madame Elysé gehen würde, auf einer Reise von Chagos nach Den Haag.
Neufundland
Die Ursprünge von Kapitel XI der UN-Charta und der dort festgeschriebenen Verpflichtung zur Dekolonisierung lassen sich zurückverfolgen zu früheren revolutionären Momenten in Amerika, Frankreich und andernorts sowie zu philosophischen und politischen Schriften über die Beziehung zwischen einem Individuum und der größeren Gemeinschaft, von der sie oder er ein Teil ist. Solche Ideen veranlassten Wladimir Iljitsch Lenin, seinen Artikel »Über das Selbstbestimmungsrecht der Nationen« zu veröffentlichen, eine Aufforderung zur Beendigung von Fremdherrschaft. Vier Jahre später wandte sich der amerikanische Präsident Woodrow Wilson mit ähnlichen Ideen an den US-Kongress, als er die Interessen kolonisierter Bevölkerungen streifte. Einer seiner »Vierzehn Punkte« führte für verschiedene Völker der österreichisch-ungarischen Monarchie und des Osmanischen Reiches den Grundsatz der »autonome[n] Entwicklung« ins Feld, die Idee, dass jede nationale Gruppe eigene Rechte haben könnte. Solche Ideen beeinflussten andere Denker, wie etwa W.E.B. Du Bois und Eliézer Cadet, sowie die von Marcus Garvey gegründete Universal Negro Improvement Association (UNIA). Sie drangen in den Jahren nach dem Ersten Weltkrieg darauf, das »Selbstbestimmungsrecht« müsse »auf Afrikaner und auf jede europäische Kolonie angewendet werden, in welcher die afrikanische Rasse überwiegt«, und Deutschlands afrikanische Kolonien müssten »den Ureinwohnern« zurückgegeben werden.
Zwei Jahrzehnte später, als wieder Krieg wütete, stießen deutsche Truppen in die Sowjetunion und nach Nordafrika vor. Sie bedrohten die britische Kontrolle über Ägypten und den Suezkanal und damit die Route nach Mauritius, Indien und in andere Kolonialgebiete. Im Osten stellte Japan seinerseits eine Bedrohung für britische, niederländische und französische Kolonien dar. Noch waren die USA nicht in den Krieg eingetreten, und Präsident Franklin Delano Roosevelt nutzte diesen Moment, um ein Treffen mit dem britischen Premierminister Winston Churchill vorzuschlagen. »Irgendwo im Atlantik«, raunte Churchill, an einem geheimen Ort.
Die beiden trafen sich am Samstag, dem 9. August 1941, an Bord der USSAugusta, die im Little Placentia Sound vor der Küste Neufundlands, einer britischen Kolonie, vor Anker lag. Am folgenden Tag besprachen sie den Entwurf einer gemeinsamen Erklärung. Beim Abendessen wurde Roosevelts Sohn Elliot, Captain der US Army Air Forces, Zeuge einer »höchst aufgeladenen« Auseinandersetzung zwischen FDR und Churchill über Kolonialismus und das britische Empire. Roosevelt provozierte Churchill, indem er ihm erzählte, er wolle den präferenziellen Handel und andere Wirtschaftsvereinbarungen für Großbritanniens Kolonien aufheben.
»England beabsichtigt nicht einen Moment lang, seine begünstigte Position unter den britischen Dominions zu verlieren«, erwiderte Churchill verärgert. Roosevelt konterte: Echter Frieden erfordere die »Entwicklung rückständiger Länder«, und die beiden Mächte müssten zusammenarbeiten, um dem Faschismus die Stirn zu bieten und um Menschen von »einer rückständigen Kolonialpolitik« zu befreien.
Churchills Versuch, das Thema zu wechseln, war erfolglos. Die Vereinigten Staaten würden nicht für den Kolonialismus bürgen, fuhr Roosevelt fort, und würden »Volksbewegungen« für Unabhängigkeit und Selbstregierung unterstützen. Im Rückblick auf die Jahre des Kalten Krieges, die folgten, auf die Entwicklung in Chile, Nicaragua, Irak und Afghanistan und anderswo kann gegen die USA leicht der Vorwurf der Heuchelei erhoben werden. Nichtsdestotrotz hoffte Roosevelt, den britischen Kolonialismus durch ein »neues amerikanisches Jahrhundert« zu ersetzen, und eine seiner Ideen sollte als das »Prinzip der Selbstbestimmung« erfolgreich weiterentwickelt werden.
Mehrere Tage lang tauschte man robuste Ansichten aus. Die Amerikaner trafen mit einem Textentwurf ein, aber Roosevelt enthielt ihn Churchill vor, weil er fürchtete, er würde von diesem auf der Stelle abgelehnt. Sollten die Briten lieber einen eigenen Entwurf ausarbeiten, auf den die Amerikaner reagieren konnten. Der Trick funktionierte. Der erste Entwurf der Atlantik-Charta, pflegte Churchill zu sagen, war »eine britische Produktion, formuliert in meinen eigenen Worten«.
Er tappte direkt in die von Roosevelt gestellte Falle.
Der Entwurf wurde überarbeitet, Wörter wurden hinzugefügt oder geändert oder entfernt. Sätze wurden eingefügt, neue Punkte formuliert. Nach drei Tagen verständigten die beiden sich auf einen kurzen Text, der ihre Hoffnungen »auf eine bessere Zukunft der Welt« umriss. Die Ideen umfassten die Achtung von Hoheitsgebieten, mehr wirtschaftliche Zusammenarbeit, ein Ende der Handelspräferenzen für die Kolonien, individuelle Freiheiten, und Grenzen für den Einsatz militärischer Gewalt.
Die Atlantik-Charta bestand aus einer einzigen, maschinengeschriebenen Seite mit acht kurzen Punkten. Punkt 3 sollte zu gegebener Zeit äußerst wichtig für Mauritius und Madame Elysé werden, die Worte, die Großbritannien und Amerika auf den folgenden Grundsatz verpflichteten: »Sie achten das Recht aller Völker, sich jene Regierungsform zu geben, unter der sie zu leben wünschen.« Die Idee war revolutionär, beschwor sie doch die Vorstellung, dass »die souveränen Rechte und autonomen Regierungen aller Völker, die ihrer durch Gewalt beraubt wurden, (…) wiederhergestellt werden«. Churchill schrieb diese Worte, ohne gründlich darüber nachzudenken, wie sie interpretiert und angewendet werden könnten.
Die Atlantik-Charta fand ein breites Echo in der Presse. Eine Absichtserklärung, stellte die Zeitschrift The New Yorker fest, und noch dazu eine ziemlich gute, wenn auch interpretierbar. Aus Roosevelts Sicht verkündete die Charta das Ende des Imperiums, waren ihre acht Punkte eine Fortführung von Wilsons »Vierzehn Punkten«, ein Instrument, das Menschen im Osten Europas »ihren eigenen Nationalstaat« verhieß.
Churchill verstand den Text anders. Nein, versicherte er dem britischen Unterhaus, die Atlantik-Charta bedeute nicht das Aus für die Kolonien Großbritanniens – ihr entscheidender dritter Punkt gelte nur für jene, die »unter dem Joch der Nazis« lebten. Diejenigen, die der Krone Loyalität schuldeten, in Indien, Birma, Mauritius und anderen Teilen des britischen Empire, fielen nicht unter die im dritten Punkt zum Ausdruck gebrachte Verpflichtung.
Churchills Auslegung wurde nicht so breit geteilt. Überall in Afrika bezogen viele die Worte von Punkt 3 auf sich und die Kolonien ihres Kontinents, leiteten daraus eine Verpflichtung zur »Afrikanisierung« der Regierungen ab. In Südafrika verstand ein junger Nelson Mandela die Worte der Atlantik-Charta nicht als »leere Versprechungen«, sondern sah in ihnen die Verheißung der »volle[n] Staatsbürgerschaft«, des »Rechts, Land zu kaufen«, und der »Aufhebung aller diskriminierenden Gesetzgebung«.
Die Welt des Völkerrechts war – und ist nach wie vor – konservativ und vorsichtig, aber sind Worte erst einmal vereinbart, entfalten sie oft ein Eigenleben. Ein paar Monate nach der Annahme der Atlantik-Charta wurde der dritte Punkt aufgegriffen, und sein Grundgedanke fand Eingang in die im Januar 1942 in Washington, D.C., angenommene »Deklaration vereinter Nationen«. Sechsundzwanzig Staaten vereinbarten, sich gegen Deutschland und Japan zusammenzutun, dessen Angriff auf Pearl Harbor einen Monat zuvor die Amerikaner zum Kriegseintritt veranlasst hatte. Zu den Ländern, welche die Verpflichtung zur Selbstregierung aus der Atlantik-Charta akzeptierten und nach der Wahrung »der Menschenrechte und des Rechts in ihren eigenen Ländern wie auch in anderen Ländern«, verlangten, zählten auch die Sowjetunion und China.
Binnen weniger Jahre unterstützten etwa 50 Staaten die Deklaration von 1942, darunter vier aus Afrika: Ägypten, Äthiopien, Liberia und Südafrika. Die Verpflichtung zur Dekolonisierung war im Bewusstsein vieler Menschen angekommen, auch wenn die Modalitäten noch ungewiss waren.
Im Februar 1945 widersetzte sich Churchill auf der Konferenz von Jalta, wo er, Roosevelt und Stalin zusammentrafen, um über die Niederlage Deutschlands und Regelungen für die Nachkriegswelt zu sprechen, erneut Roosevelts Versuchen, die britischen Kolonien international anerkannten Regeln und internationaler Kontrolle zu unterwerfen. »Ich werde keinen Vorschlag zulassen, dass das britische Empire auf die Anklagebank gesetzt und von allen überprüft werden müsse, um festzustellen, ob es ihrem Standard entspricht«, sagte der Premierminister zu Stalin. »Niemals, niemals, niemals … jedes Stückchen Land, über dem die britische Flagge weht, ist immun.«
Die USA standen an der Spitze, als es um die Schaffung einer neuen Organisation, der Vereinten Nationen, ging. Der Außenminister wollte, dass jemand mit Engagement und Kenntnissen über Afrika die Dekolonisierung weiterführte. »Für die künftigen kolonialen Probleme dieser internationalen Organisation wollen wir den kompetentesten Mann einstellen, der zufällig ›Neger‹ ist«, erklärte der Generalsekretär der Konferenz über die Vereinten Nationen. Dieser Mann war Ralph Bunche, ein Politikwissenschaftler, der im US-Außenministerium mit dem Thema Kolonialismus befasst war, ein entschiedener Befürworter von Dekolonisierung und Selbstbestimmung, der aus seinen eigenen Erfahrungen mit rassischen Vorurteilen in den Vereinigten Staaten schöpfte.
Im Juni 1945, einen Monat nach dem Kriegsende in Europa, unterzeichneten 50 Staaten die Charta der Vereinten Nationen und füllten damit die durch den Niedergang des Völkerbunds hinterlassene Lücke. Diese Charta schrieb in Kapitel III, Artikel 7, einen Sicherheitsrat fest, ein einflussreiches Organ aus 15 Mitgliedern – darunter fünf ständige Mitglieder (die Vereinigten Staaten, Großbritannien, Frankreich, China und die Sowjetunion), die übrigen zehn gewählt für jeweils zwei Jahre – »zur Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit«. Zu den weiteren UN-Organen zählten eine Generalversammlung aus »allen Mitgliedern« als »das wichtigste beratende, politikgestaltende und repräsentative Organ« sowie ein neuer Internationaler Gerichtshof als wichtigstes rechtsprechendes Organ der UN. Fünfzehn Richter im Friedenspalast in Den Haag sollten Streifragen zwischen Staaten lösen. (Im Mai 1947 reichten die Briten die erste Klage ein, in der sie anführten, dass Albanien in Verletzung internationalen Rechts und der »Gebote der Menschlichkeit« Minen in der Straße von Korfu gelegt hätte – der sogenannte Korfu-Kanal-Zwischenfall.) Die Richter wurden außerdem ermächtigt, »Gutachten zu jeder Rechtsfrage auf Antrag jeder Einrichtung ab[zu]geben, die durch die Charta der Vereinten Nationen oder im Einklang mit ihren Bestimmungen zur Einholung eines solchen Gutachtens ermächtigt ist«.
Die Amerikaner drängten in der UN-Charta auf Dekolonisierung, wenngleich mit einer anderen Bezeichnung. Die »am härtesten arbeitende Konferenz, an der ich je teilgenommen habe«, sollte Ralph Bunche sie später nennen, »bei jedem Schritt ein erbitterter Kampf«, wobei Treuhandverwaltung und Dekolonisierung die »heißesten« Themen von allen gewesen seien. Er erreichte im Wesentlichen sein Ziel: Die Dekolonisierung wurde ein grundlegendes Ziel der Vereinten Nationen, da Artikel 1 der Charta die Mitglieder zur »Achtung vor dem Grundsatz der Gleichberechtigung und Selbstbestimmung der Völker« verpflichtete. Die Worte waren kühn und bedeutsam, die Sprache ein Kompromiss, ein Wink für die Briten und Franzosen, die um den Verlust von Kolonien fürchteten. »Nicht so gut, wie ich es mir gewünscht hätte«, berichtete Bunche, »aber im Ergebnis besser als das, was irgendeiner von uns erwartet hätte.«
Die Charta erwähnte die Kolonien nicht. Stattdessen sprach Kapitel XI von »Hoheitsgebieten ohne Selbstregierung«, eine weniger aufrührerische und für besorgte Europäer annehmbarere Formulierung. Artikel 73 erlegte denjenigen Verpflichtungen auf, »welche die Verantwortung für die Verwaltung von Hoheitsgebieten haben oder übernehmen, deren Völker noch nicht die volle Selbstregierung erreicht haben«: Die Kolonisatoren müssten anerkennen, »dass die Interessen der Einwohner dieser Hoheitsgebiete Vorrang haben«, und »das Wohl dieser Einwohner« und deren Selbstregierung »aufs äußerste (…) fördern«. Wie dies geschehen sollte, hinge von »den besonderen Verhältnissen jedes Hoheitsgebiets, seiner Bevölkerung und deren jeweiliger Entwicklungsstufe« ab. Die Charta schuf ein neues internationales »Treuhandsystem«, um andere, sogenannte »Treuhandgebiete« unter der Zuständigkeit eines »Treuhandrates« zu verwalten.
Auf diese Weise schuf die UN-Charta einen Rahmen für den Wandel, eine rudimentäre Verpflichtung zur Dekolonisierung. Der Text spiegelte eine Einigung wider, eine Übereinkunft zur Nichtübereinkunft, die Vereinigten Staaten auf der einen, Großbritannien auf der anderen Seite. Doch es war ein Anfang, und wie bei so vielen Dingen im Leben: Sobald eine Idee auf den Weg gebracht ist, kann nichts sie mehr aufhalten.
Deportation
Während sich der Vorrang der Interessen der Kolonisierten manifestierte, suchten andere Entwicklungen im Völkerrecht die Rechte von Einzelnen und Gruppen zu befördern. Ein neues System der Menschenrechte entstand, als Regierungen sich auf eine Reihe von Ideen verpflichteten, darunter das Recht von Menschen, nicht von ihren Heimatorten zwangsumgesiedelt und an andere Orte überführt zu werden.
Ein Katalysator für den Wandel war der Nationalsozialismus und seine Idee vom »Lebensraum«: die Vorstellung, dass Deutsche »arischer« Abstammung im gesamten besetzten Europa (vor allem im Osten) »mehr Raum zum Leben« bräuchten. Das »Lebensraum«-Konzept war brutal: Einheimische wurden zusammengetrieben, deportiert und durch deutsche Kolonisten ersetzt. Die schrecklichen menschlichen Folgen inspirierten die im Sommer 1945 in London versammelten Verfasser des Londoner Statuts zur Schaffung des ersten internationalen Strafrechtstribunals, mit der Befugnis, hochrangige NS-Führer wegen »Verbrechen gegen die Humanität« strafrechtlich zu belangen. Für diesen Rechtsbegriff warb Hersch Lauterpacht, ein Rechtswissenschaftler aus Cambridge, dessen soeben in New York erschienenes Buch An International Bill of the Rights of Man eine Blaupause für die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte lieferte.
Zu den »Verbrechen gegen die Humanität« in Nürnberg gehörte die »Deportation« – die zwangsweise Überführung einer Gruppe von einem Gebiet in ein anderes. Dieses Thema war von persönlichem Interesse für mich, wie ich in Rückkehr nach Lemberg geschrieben habe: Zwei meiner Urgroßmütter, ältere Witwen, wurden von Wien nach Theresienstadt beziehungsweise Treblinka deportiert, wo sie umkamen. Jede durfte nur einen einzigen Koffer mitnehmen. Die Anklagepunkte gegen viele der NS-Angeklagten in Nürnberg umfassten auch ihre Rolle beim Einsatz für »Lebensraum« als Bestandteil der »neuen Ordnung« Deutschlands, einer Ordnung, die beabsichtigte, die britischen Kolonien in Afrika und anderswo aufzulösen, während sie zugleich Polen und andere europäische Gebiete kolonisierte.
In seiner Rede zur Eröffnung der Anklage vor dem Internationalen Militärgerichtshof in Nürnberg am 21. November 1945 sprach der Hauptanklagevertreter der USA, Robert H. Jackson, das Thema Deportationen und NS-Kolonien sowie den Gedanken eines »Selbstbestimmungsrechts« für Deutsche an. Jackson kontrastierte Deutschlands Verhalten mit den »rechtmäßigen« kolonialen Methoden Großbritanniens und Frankreichs; Letztere hätten sich, so versicherte er, ihre Kolonien ohne »Angriffskrieg« verschafft. Sir Hartley Shawcross, der britische Ankläger, hob auf die Legitimität des britischen Weltreichs und auf Deutschlands Krieg gegen das Empire ab. Im Oktober 1946 wurden neun der 24 Angeklagten unter anderem wegen »Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit«, worunter auch ihre Rolle bei den Deportationen fiel, verurteilt. Sieben von ihnen wurden gehängt.
Somit gab der Nürnberger Prozess den Anstoß für neue Prinzipien, die zeit- und raumübergreifend Fuß fassen sollten, da Deportation als »Verbrechen gegen die Menschlichkeit« anerkannt wurde. In groben Zügen funktioniert so das Völkerrecht: Jemand entwickelt eine Idee, legt sie schriftlich nieder (vielleicht in einem Aufsatz oder einem Buch), sie reift zu einem genehmigten Gesetzestext, findet Eingang in einen anderen Gesetzestext und entwickelt anschließend ein Eigenleben, wenn Richter die Worte interpretieren und anwenden. Die Ideen der drei Gründungsurkunden – Atlantik-Charta, UN-Charta und Statut für den Internationalen Militärgerichtshof – befruchteten sich gegenseitig, breiteten sich anderswo aus und würden am Ende die Richter erreichen.
Im Dezember 1946 beschloss die UN-Generalversammlung auf ihrer allerersten Sitzung, dass Deportation ein »Verbrechen gegen die Menschlichkeit« sei. Zwei Jahre später, im Dezember 1948, verabschiedete die Generalversammlung in Paris die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte. Obschon sie sich über Selbstbestimmung und Kolonialismus ausschwieg, erkannte die Erklärung dennoch an, dass jeder von uns, jeder einzelne Mensch, das Recht hat, »jedes Land, einschließlich seines eigenen, zu verlassen sowie in sein Land zurückzukehren«.
Im darauffolgenden Sommer trafen sich Regierungsvertreter in Genf, um eine neue internationale Vereinbarung über Kriegsverbrechen zu unterzeichnen, die Zivilisten in Kriegszeiten größeren Schutz bieten sollte. Das Genfer Abkommen von 1949 verbot ausdrücklich »zwangsweise Einzel- oder Massenumsiedlungen sowie Deportationen von geschützten Personen aus besetztem Gebiet nach dem Gebiet der Besetzungsmacht oder dem irgendeines anderen besetzten oder unbesetzten Staates«. Das Rote Kreuz hoffte, die neuen Regeln würden dem »hassenswerten« Akt der Deportation für alle Zeiten ein Ende bereiten. Großbritannien unterstützte die Entwicklung aktiv und unterzeichnete als eines der ersten Länder das Abkommen.
Die Nachkriegsjahre waren bedeutsam, weil damals die Grundlagen für eine neue Rechtsordnung gelegt wurden. Im Jahr 1950 wurde Ralph Bunche als erster Schwarzer Person der Friedensnobelpreis verliehen; im kolonisierten Mauritius war er eine Quelle der Inspiration für Universitätsstudenten. Ebenfalls in jenem Jahr unterzeichneten europäische Staaten die Europäische Menschenrechtskonvention, das erste Abkommen, das Einzelpersonen gestattete, vor einem internationalen Gericht gegen ihre eigenen Staaten Rechte durchzusetzen.
Großbritannien unterstützte die Konvention, die 1953 in Kraft trat. Doch London nahm wohlweislich Mauritius von den Kolonien aus, für welche die Konvention galt, so dass jene, die dort und auch auf den Inseln des Peros-Banhos-Atolls und weiteren Inseln des Chagos-Archipels lebten, keine Rechte gemäß der Konvention oder ihrer späteren Protokolle hatten. Eines dieser Protokolle würde zu gegebener Zeit ausdrücklich verbieten, dass irgendjemand von dem Territorium des Staates, dessen Bürger sie oder er war, vertrieben wurde. Großbritannien hat es nie unterzeichnet.
Etwa um die Zeit, als die Europäische Menschenrechtskonvention für Großbritannien verpflichtend wurde, bekamen Marcelle und Charles Bertrand, die auf der Île du Coin, einer der vielen Inseln von Peros Banhos und Chagos, lebten, ein Kind. Es wurde in der einzigen Kirche der Insel, weißes Mauerwerk und hellrotes Dach, getauft. Liseby, wie das Mädchen genannt wurde, war ein Kind des Kolonialismus, eine Untertanin der britischen Krone, aber mit weit weniger Rechten als jene, die ihren Geburtsort verwalteten.
Peros Banhos
Peros Banhos besteht aus drei Dutzend Inseln und Inselchen, von denen sieben bewohnt waren, als Liseby Bertrand im Sommer 1953 geboren wurde. Die Île du Coin war die bevölkerungsreichste, ein Fleckchen Sand mit Kokospalmen, Heimat von etwa 400 Seelen.
Zur Zeit von Lisebys Geburt war Peros Banhos seit anderthalb Jahrhunderten britische Kolonie, als Schutzgebiet verwaltet von Mauritius. Regiert wurde die Inselgruppe von London aus, eine Folge des im Mai 1814 unterzeichneten Vertrags von Paris, der die Napoleonischen Kriege beendete, den internationalen Sklavenhandel verbot und verschiedene französische Kolonien Großbritannien zuschlug. Eine dieser Kolonien war die Île de France, welche die Briten unter dem Namen Mauritius kannten, eine durch vulkanische Aktivität entstandene größere Insel, die zusammen mit zahlreichen ihrer Schutzgebiete, darunter der Chagos-Archipel, britische Kolonie wurde. Das