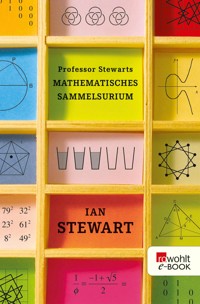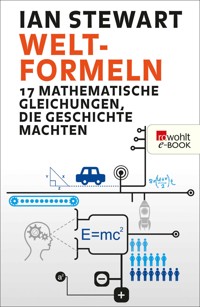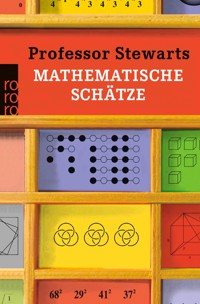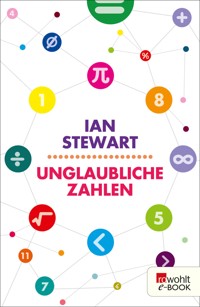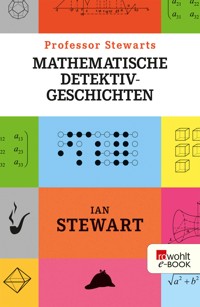9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Es sind die wahrhaft widerspenstigen Nüsse, von denen Stewart in seinem neuen Buch berichtet. Mathematische Rätsel, an denen sich die abstraktesten Köpfe seit Jahrzehnten, Jahrhunderten oder sogar Jahrtausenden die Zähne ausbeißen. Weil ab und zu doch jemand die Lösung findet. Wie 1993 der Brite Andrew Wiles nach einem langen Forscherleben für Fermat's Letzten Satz, der aus dem 17. Jahrhundert stammt. Um Rätsel wie dieses, die meisten aber bislang ungelöst, geht es in Ian Stewarts neuem Buch: die großen mathematische Probleme, von denen jeder, der sich für Mathematik interessiert, schon mal gehört hat, ob es die Goldbachsche, die Riemannsche, die Keplersche oder Poincarés Vermutung ist, um die Quadratur des Kreises oder das Drei-Körper-Problem geht. Stewart erklärt nicht nur die Gleichung, er erzählt auch die oft spannende Geschichte hinter der Entdeckung, die jedes dieser Probleme darstellt. Ein Wissensvergnügen nicht nur für Mathematik-Fans.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 576
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Ian Stewart
Die letzten Rätsel der Mathematik
Über dieses Buch
Es sind die wahrhaft widerspenstigen Nüsse, von denen Stewart in seinem neuen Buch berichtet. Mathematische Rätsel, an denen sich die abstraktesten Köpfe seit Jahrzehnten, Jahrhunderten oder sogar Jahrtausenden die Zähne ausbeißen. Weil ab und zu doch jemand die Lösung findet. Wie 1993 der Brite Andrew Wiles nach einem langen Forscherleben für Fermats letzten Satz, der aus dem 17. Jahrhundert stammt. Um Rätsel wie dieses, die meisten aber bislang ungelöst, geht es in Ian Stewarts neuem Buch: die großen mathematische Probleme, von denen jeder, der sich für Mathematik interessiert, schon mal gehört hat, ob es die Goldbach’sche, die Riemann’sche, die Kepler’sche oder Poincarés Vermutung ist, um die Quadratur des Kreises oder das Drei-Körper-Problem geht. Stewart erklärt nicht nur die Gleichung, er erzählt auch die oft spannende Geschichte hinter der Entdeckung, die jedes dieser Probleme darstellt. Ein Wissensvergnügen nicht nur für Mathematik-Fans.
Vita
Ian Stewart, geboren 1945, ist der beliebteste Mathematik-Professor Großbritanniens und hat auch in Deutschland eine wachsende Fangemeinde. Seit Jahrzehnten bemüht er sich erfolgreich, seine Wissenschaft zu popularisieren. Er studierte in Cambridge und promovierte an der Universität Warwick. Dort ist er Professor für Mathematik und Direktor des Mathematics Awareness Center. Seit 2001 ist Stewart zudem Mitglied der Royal Society. Zuletzt bei Rowohlt erschienen: «Welt-Formeln. 17 mathematische Gleichungen, die Geschichte machten» (2014); «Professor Stewarts mathematische Schätze» (2012/2013); «Professor Stewarts mathematisches Sammelsurium» (2011).
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg, September 2015
Copyright © 2015 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
Die britische Originalausgabe erschien 2013 bei Profile Books, London, unter dem Titel «The Great Mathematical Problems» Copyright © Joat Enterprises, 2013
Redaktion Heiner Höfener
Umschlaggestaltung ZERO Werbeagentur, München
Umschlagabbildung FinePic, München
Bitstream Vera is a trademark of Bitstream Inc.
ISBN 978-3-644-03001-5
Hinweis: Die Seitenverweise beziehen sich auf die Printausgabe.
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Inhaltsübersicht
Widmung
Motto
Vorwort
Kapitel 1 Große Probleme
Kapitel 2 Primgebiet
Kapitel 3 Rätselhaftes PI
Kapitel 4 Geheimnisvolle Kartierung
Kapitel 5 Sphärensymmetrie
Kapitel 6 Aus Alt mach Neu
Kapitel 7 Zu schmaler Rand
Kapitel 8 Orbitales Chaos
Kapitel 9 Primzahlenmuster
Kapitel 10 Welche Form hat die Kugel?
Kapitel 11 Nicht alle können einfach sein
Kapitel 12 Fluides Denken
Kapitel 13 Das Quantenrätsel
Kapitel 14 Diophantische Träume
Kapitel 15 Komplexe Schleifen
Kapitel 16 Wohin als Nächstes?
Kapitel 17 Zwölf für die Zukunft
Das Brocard-Problem
Ungerade perfekte Zahlen
Das Collatz-Problem
Existenz von perfekten Quadern
Die Lonely Runner Conjecture (Einsame-Läufer-Vermutung)
Conways Thrackle-Hypothese
Irrationalität der Euler-Konstanten
Reelle quadratische Zahlkörper
Langtons Ameise
Die Hadamard-Matrix-Vermutung
Die Fermat-Catalan-Gleichung
Die abc-Vermutung
Anhang
Glossar
Abbildungsnachweis
Namenverzeichnis
Für Jay Mandel und Jill Bialosky,
mit kosmischer Dankbarkeit
Wir müssen wissen. Wir werden wissen.
David Hilbert
Vortrag über mathematische Probleme 1930 anlässlich der Verleihung der Ehrenbürgerschaft von Königsberg.[1]
Vorwort
Mathematik ist ein riesiges, ständig wachsendes, sich ständig veränderndes Fachgebiet. Unter den unzähligen Fragen, die sich Mathematiker stellen und in den meisten Fällen auch beantworten, stechen einige aus dem Rest hervor: exponierte Gipfel, die die niedrigen Gebirgsausläufer überragen. Das sind die wirklich großen Fragen, die schwierigen und herausfordernden Probleme, für deren Lösung jeder Mathematiker seinen rechten Arm hergeben würde. Etliche blieben Jahrzehnte, manche Jahrhunderte, einige wenige ein paar Jahrtausende lang ungelöst. Etliche müssen noch bezwungen werden. Fermats letzter Satz war 350 Jahre lang ein Rätsel, bis Andrew Wiles nach siebenjähriger Plackerei die Lösung fand. Die Poincaré-Vermutung blieb mehr als ein Jahrhundert lang offen, bis sie von dem exzentrischen mathematischen Genie Grigori Perelman gelöst wurde, der sämtliche akademische Ehren und einen 1-Million-Dollar-Preis für seine Arbeit ablehnte. Die Riemann-Hypothese stellt Mathematiker in aller Welt seit 150 Jahren vor ein Rätsel.
Die letzten Rätsel der Mathematik enthalten eine Auswahl der wirklich großen Fragen, die die Mathematik in radikal neue Richtungen gelenkt haben. Das Buch beschreibt ihre Ursprünge, erklärt, warum sie so wichtig sind, und stellt sie in den Kontext von Mathematik und Naturwissenschaften insgesamt. Es enthält gelöste wie ungelöste Probleme, die mehr als 2000 Jahre mathematischer Entwicklung überspannen, doch sein Hauptgewicht liegt auf Fragen, die entweder heute noch offen sind oder in den vergangenen 50 Jahren gelöst wurden.
Ein Grundziel der Mathematik besteht darin, die grundlegende Einfachheit scheinbar komplexer Fragen offenzulegen. Das mag jedoch nicht immer offensichtlich sein, da die mathematische Konzeption von «einfach» auf vielen speziellen und schwierigen Vorstellungen beruht. Ein wichtiges Merkmal dieses Buches besteht darin, die tiefgreifende Einfachheit von Konzepten zu betonen und Komplexitäten zu vermeiden – oder sie zumindest klar zu erklären.
Die Mathematik ist neuer und vielfältiger, als die meisten sich vorstellen. Einer groben Schätzung zufolge liegt die Zahl der forschenden Mathematiker weltweit bei etwa hunderttausend, und sie produzieren jedes Jahr mehr als zwei Millionen Seiten neuer mathematischer Erkenntnisse. Keine «neuen Zahlen», darum geht es dabei eigentlich nicht. Keine «neuen Rechnungen» wie die bereits existierenden, nur umfassender. Eine algebraische Berechnung, die unlängst von rund 25 Mathematikern durchgeführt wurde, wurde als eine «Berechnung in der Größe von Manhattan» beschrieben. Das stimmte jedoch nicht ganz, sondern war eher untertrieben. Die Antwort hatte die Größe von Manhattan; die eigentliche Berechnung war deutlich umfangreicher. Das ist eindrucksvoll, doch es ist die Qualität, die zählt, nicht die Quantität. Diese gigantische Berechnung erfüllt diesen Anspruch in beiderlei Hinsicht, denn sie liefert wertvolle Grundlageninformation über eine Symmetriegruppe, die in der Quantenphysik offenbar und in der Mathematik definitiv eine wichtige Rolle spielt. Brillante Mathematik kann eine einzige Zeile lang sein oder eine ganze Enzyklopädie füllen, je nachdem, was das Problem verlangt.
Wenn wir an Mathematiker denken, kommen uns spontan endlose Seiten voller Symbole und Formeln in den Sinn. Diese zwei Millionen Seiten enthalten jedoch im Allgemeinen mehr Worte als Symbole. Die Worte dienen dazu, den Hintergrund des Problems, die Argumentationslinie, die Bedeutung der Berechnungen und ihre Stellung im ständig wachsenden Gebäude der Mathematik zu erklären. Wie der große Carl Friedrich Gauß um 1800 bemerkte, sind das Wesen der Mathematik «Bedeutungen, keine Bezeichnungen». Dennoch ist die Alltagssprache, in der mathematische Ideen ausgedrückt werden, die der Symbole. Viele veröffentlichte Forschungsartikel enthalten mehr Symbole als Worte. Formeln sind von einer Präzision, an die Worte nicht immer heranreichen können.
Dennoch ist es oft möglich, die dahinter stehenden Ideen zu erklären, ohne viele Symbole zu gebrauchen. Das Buch Die letzten Rätsel der Mathematik sieht darin sein Leitprinzip. Es illustriert, was Mathematiker tun, wie sie denken und warum ihre Themen interessant und wichtig sind. Vor allem beleuchtet es, wie sich heutige Mathematiker den Herausforderungen stellen, die ihnen ihre Vorgänger hinterlassen haben, während die großen Rätsel der Vergangenheit eines nach dem anderen dank der mächtigen Techniken der Gegenwart sich geschlagen geben und damit die Mathematik und die Naturwissenschaften der Zukunft verändern. Die Mathematik gehört zu den größten Errungenschaften der Menschheit, und ihre großen Probleme – ob gelöst oder ungelöst – haben ihre erstaunliche Schaffenskraft in der Vergangenheit über Jahrtausende geleitet und stimuliert und werden dies auch in Zukunft tun.
Kapitel 1Große Probleme
Fernsehprogramme über Mathematiker sind rar, gute noch seltener. Eines der besten, was Sehbeteiligung und Zuschauerinteresse wie auch Inhalt anging, war «Fermats letzter Satz». Das Programm wurde 1996 von John Lynch für die populäre BBC-Wissenschaftsreihe Horizon produziert. Simon Singh, der an der Produktion beteiligt war, verwandelte die Geschichte in einen spektakulären Bestseller.[1] Auf einer Webseite betonte er, dass der überwältigende Erfolg des Programms eine große Überraschung war:
Es waren 50 Minuten, in denen Mathematiker über Mathematik redeten, was kein auf der Hand liegendes Rezept für einen TV-Blockbuster ist, doch das Resultat war ein Programm, das die Phantasie des Publikums gefangen nahm und das viel Beifall von den Kritikern erhielt. Das Programm gewann den BAFTA für die beste Dokumentation, einen Priz Italia, andere internationale Preise und eine Emmy-Nomierung – das beweist, dass Mathematik genauso emotional und packend sein kann wie irgendein anderes Fach auf der Welt.
Ich denke, für den Erfolg des Fernsehprogramms wie auch des Buches gibt es mehrere Gründe, und sie haben Konsequenzen für die Geschichten, die ich hier erzählen möchte. Um die Diskussion stringent zu halten, werde ich mich auf die Fernsehdokumentation konzentrieren.
Fermats letzter Satz ist eines der wirklich großen mathematischen Probleme; es erwuchs aus einer scheinbar harmlosen Bemerkung, die einer der führenden Mathematiker des 17. Jahrhunderts an den Rand eines klassischen Lehrbuchs gekritzelt hatte. Das Problem erlangte notorische Berühmtheit, weil niemand beweisen konnte, was Pierre de Fermats Randnotiz behauptete, und trotz aller Bemühungen sehr kluger Leute blieb dies über 300 Jahre der Stand der Dinge. Als der britische Mathematiker Andrew Wiles das Problem daher 1995 schließlich knackte, war die Größe dieser Leistung für jedermann offensichtlich. Man musste nicht einmal wissen, um welches Problem es sich handelte, geschweige denn, wie er es gelöst hatte. Es war das mathematische Äquivalent der Erstbesteigung des Mount Everest.
Neben ihrer Bedeutung für die Mathematik spielte bei Wiles’ Lösung auch der human touch eine entscheidende Rolle. Im Alter von zehn Jahren packte ihn das Problem dermaßen, dass er sich entschloss, Mathematiker zu werden und es zu lösen. Er führte den ersten Teil seines Plans aus und ging so weit, sich auf Zahlentheorie zu spezialisieren, das allgemeine Gebiet, zu dem Fermats letzter Satz gehört. Je mehr er jedoch über die reale Mathematik lernte, desto unmöglicher erschien ihm das ganze Unterfangen. Fermats letzter Satz war eine verblüffende Kuriosität, eine isolierte Frage der Art, wie sie sich jeder Zahlentheoretiker ohne auch nur den Schimmer eines überzeugenden Beweises ausdenken konnte. Dieser Satz passte nicht in irgendeine Schublade mit einem Satz effizienter Lösungstechniken. In einem Brief an Heinrich Olbers hatte der große Gauß das Problem abgetan: «Ich gestehe, dass das Fermat’sche Theorem als isolirter Satz für mich wenig Interesse hat, denn es lassen sich eine Menge solcher Sätze leicht aufstellen, die man weder beweisen, noch widerlegen kann.»[2] Wiles kam zu dem Schluss, sein Kindheitstraum sei unrealistisch gewesen, und legte Fermat zunächst einmal ad acta. Doch dann gelang anderen Mathematikern wunderbarerweise ein Durchbruch, der das Problem mit einem Kernthema der Zahlentheorie verknüpfte, einem Thema, für das Wiles bereits Experte war. In für ihn untypischer Weise hatte Gauß die Bedeutung des Problems unterschätzt und nicht erkannt, dass es sich mit einem grundlegenden, wenn auch scheinbar in keinem Zusammenhang stehenden Gebiet der Mathematik verknüpfen ließ.
Nachdem diese Verbindung hergestellt war, konnte Wiles nun an Fermats Rätsel arbeiten und gleichzeitig seine Forschung an der modernen Zahlentheorie vorantreiben. Noch besser war: Sollte die Sache mit Fermat nicht gelingen, so würde doch alles Wichtige, was er bei dem Versuch, den Satz zu beweisen, herausfand, aufgrund seiner eigenen Bedeutung publizierbar sein. Daher nahm sich Wiles Fermats Problem wieder vor und begann sich ernsthaft Gedanken darüber zu machen. Nach sieben Jahren besessener Forschung, die er privat und insgeheim durchführte – eine in der Mathematik ungewöhnliche Vorsichtsmaßnahme –, kam er zu der Überzeugung, die Lösung gefunden zu haben. Unter einem obskuren Titel, der niemanden täuschte, hielt er auf einer renommierten Zahlentheoriekonferenz eine Reihe von Vorträgen.[3] Die aufregende Nachricht machte in den Medien wie auch in Mathematikerkreisen rasch die Runde: Fermats letzter Satz war bewiesen worden.
Der Beweis war eindrucksvoll und elegant, voller guter Ideen. Leider entdeckten Experten rasch eine ernste Lücke in seiner Logik. Bei Versuchen, große ungelöste Probleme zu knacken, passiert so etwas leider deprimierend häufig, und fast immer erweist es sich als fatal. Doch dieses eine Mal war das Schicksal gnädig. Mit Hilfe seines früheren Studenten Richard Taylor gelang es Wiles, die Lücke zu überbrücken, den Beweis zu reparieren und seine Lösung zu komplettieren. Die emotionale Belastung, die ihm zusetzte, wurde den Zuschauern des Programms lebhaft vor Augen geführt: Es muss die einzige Gelegenheit gewesen sein, bei der ein Mathematiker vor der Kamera in Tränen ausbrach, als er sich die traumatischen Ereignisse und den schließlichen Triumph nochmals in Erinnerung rief.
Ihnen ist vielleicht aufgefallen, dass ich Ihnen nicht gesagt habe, wie Fermats letzter Satz eigentlich lautet. Das war Absicht; wir werden an geeigneter Stelle darauf zurückkommen. Soweit es den Erfolg der Fernsehsendung betrifft, spielt das kaum eine Rolle. Tatsächlich haben Mathematiker sich niemals sehr dafür interessiert, ob das Theorem, das Fermat an den Rand des Buches kritzelte, stimmt oder nicht, weil von der Antwort nichts wirklich Wichtiges abhängt. Warum also die ganze Aufregung? Weil sehr viel von der Unfähigkeit der mathematischen Gemeinschaft abhängt, die Antwort zu finden. Es ist nicht nur ein Schlag in die Magengrube unseres Selbstbewusstseins: Es heißt, dass den existierenden mathematischen Theorien etwas Wichtiges fehlt. Zudem ist der Satz sehr leicht zu erklären; das trägt zu seiner Aura des Geheimnisvollen bei. Wie kann etwas, das so einfach erscheint, sich als so schwierig herausstellen?
Auch wenn Mathematikern die Antwort nicht wirklich wichtig war, sorgte es sie sehr, dass sie diese Antwort nicht kannten. Noch wichtiger war ihnen, eine Methode zu finden, die das Problem lösen konnte, denn das würde sicherlich nicht nur Licht auf die Fermat’sche Frage werfen, sondern auch auf eine ganze Palette anderer Fragen. Das ist bei großen mathematischen Problemen häufig der Fall: Nicht die Resultate selbst, sondern die Lösungsmethoden sind das, was wirklich zählt. Natürlich spielt das tatsächliche Resultat manchmal auch eine wichtige Rolle; das hängt davon ab, welche Konsequenzen es hat.
Wiles’ Lösung ist viel zu kompliziert und technisch fürs Fernsehen; die Details können tatsächlich nur Spezialisten verstehen.[4] Der Beweis birgt, wie wir noch sehen werden, tatsächlich eine hübsche mathematische Geschichte, doch jeder Versuch, diese im Fernsehen zu erklären, würde sofort den Verlust eines Großteils der Zuschauer bedeutet haben. Stattdessen konzentrierte sich die Sendung vernünftigerweise auf eine persönlichere Frage: Wie ist es, wenn man ein notorisch schwieriges mathematisches Problem anpackt, auf dem eine Menge historischer Ballast lastet? Die Zuschauer erfuhren, dass es eine kleine, aber entschlossene, in der ganzen Welt verstreute Gruppe von Mathematikern gab, denen ihr Forschungsgebiet sehr am Herzen lag, die miteinander sprachen, ihre Arbeiten austauschten und einen Großteil ihres Lebens damit verbrachten, unser mathematisches Wissen zu mehren. Ihr emotionales Engagement und ihr sozialer Zusammenhalt kamen deutlich herüber. Das waren keine cleveren Automaten, sondern wirkliche Menschen, die sich für ihr Fach begeistern konnten. Das war die Botschaft.
Die drei wichtigsten Gründe für den phänomenalen Erfolg des Programms sind daher folgende: ein bedeutendes Problem, ein Held mit einer wunderbaren, berührenden Geschichte und eine unterstützende Gruppe emotional beteiligter Menschen. Doch ich vermute, es gab einen vierten, nicht ganz so angemessenen Grund. Die meisten Nichtmathematiker hören nur selten von neuen Entwicklungen auf diesem Gebiet, und das aus einer ganzen Reihe verständlicher Gründe: Sie sind sowieso nicht besonders an diesem Thema interessiert, Zeitungen behandeln nur selten mathematische Themen, und wenn sie es doch tun, dann häufig auf drollige oder triviale Weise, und offenbar wird nicht viel im Alltag von dem beeinflusst, was Mathematiker im stillen Kämmerlein tun. Allzu häufig wird die Schulmathematik als abgeschlossenes Buch präsentiert, in dem es auf jede Frage eine Antwort gibt. Schüler können leicht zu der Überzeugung kommen, dass etwas Neues in der Mathematik so selten ist wie ein weißer Rabe.
Aus dieser Perspektive war die große Neuigkeit nicht, dass Fermats letzter Satz bewiesen worden war. Vielmehr, dass endlich jemand etwas Neues in der Mathematik gemacht hatte. Da es Mathematiker mehr als 300 Jahre gekostet hatte, eine Lösung zu finden, kamen viele Zuschauer unterbewusst zu dem Schluss, dass der Durchbruch das erste neue Stück Mathematik war, das in den letzten 300 Jahren entdeckt worden war. Ich behaupte nicht, dass sie dies explizit annahmen. Diese Position ist nicht haltbar, sobald man sich so offensichtliche Fragen stellt wie: «Warum steckt die Regierung so viel Geld in die Mathematik an Universitäten?» Unterbewusst war dies jedoch eine verbreitete Grundeinstellung, die nicht weiter hinterfragt wurde. Sie ließ Wiles’ Leistung noch größer erscheinen.
Eines der Ziele dieses Buches ist es, zu zeigen, dass die mathematische Forschung blüht und ständig neue Entdeckungen gemacht werden. Man hört nicht viel darüber, weil der größte Teil für Nichtspezialisten zu technisch ist, weil die Medien alles scheuen, was intellektuell fordernder als die TV-Serie X Factor ist und weil die Anwendungen mathematischer Erkenntnisse bewusst unter der Decke gehalten werden, um das Publikum nicht zu alarmieren. «Was? Mein iPhone basiert auf höherer Mathematik? Wie soll ich mich bei Facebook einloggen, wenn ich durch meine Matheprüfungen gefallen bin?»
Historisch erwächst mathematischer Fortschritt häufig aus Entdeckungen auf anderen Gebieten. Als Isaac Newton seine Bewegungsgesetze und sein Gravitationsgesetz entwickelte, wischte er das Problem, das Sonnensystem zu verstehen, damit nicht vom Tisch. Ganz im Gegenteil mussten sich Mathematiker auf einmal mit einer ganzen neuen Palette von Fragen beschäftigen: Ja, wir kennen die Gesetze, aber was folgt aus ihnen? Newton erfand die Infinitesimalrechnung, um diese Frage zu beantworten, doch seine neue Methode hatte ebenfalls Grenzen. Oft formuliert sie die Frage anders, statt die Antwort zu liefern. Sie verwandelt das Problem in eine spezielle Art von Formel, eine sogenannte Differenzialgleichung, deren Lösung die Antwort liefert. Aber die Gleichung muss man erst einmal lösen. Dennoch war die Infinitesimalrechnung ein brillanter Start. Sie zeigte uns, dass Antworten möglich waren, und gab uns ein effizientes Werkzeug an die Hand, sie zu suchen; diese Methode führt uns auch mehr als 300 Jahre später noch zu wichtigen Erkenntnissen.
Als das gesammelte mathematische Wissen der Menschheit wuchs, begann eine zweite Inspirationsquelle bei der Schaffung von noch mehr Wissen eine zunehmend wichtige Rolle zu spielen: der interne Bedarf in der Mathematik selbst. Wenn man beispielsweise weiß, wie man algebraische Gleichungen ersten, zweiten, dritten und vierten Grades löst, bedarf es nicht vieler Phantasie, nach dem fünften Grad zu fragen. (Der Grad ist im Grunde ein Maß für die Komplexität, aber man muss nicht einmal das wissen, um diese offensichtliche Frage zu stellen.) Wenn sich ein Problem der Lösung so entzieht, wie es der Fall war, macht diese Tatsache allein Mathematiker nur noch entschlossener, eine Antwort zu finden, ob das Ergebnis nun nützliche Anwendungen hat oder nicht.
Damit will ich nicht sagen, dass Anwendbarkeit keine Rolle spielt. Doch wenn ein bestimmtes Element in der Mathematik bei Fragen über die Physik von Wellen – Meereswellen, Schwingungen, Schall, Licht – immer wieder auftaucht, dann lohnt es sich zweifellos, dieses Element um seiner selbst willen zu untersuchen. Man muss nicht im Voraus genau wissen, wie eine neue Idee genutzt werden könnte: Das Thema Wellen taucht in so vielen wichtigen Gebieten so häufig auf, dass bedeutende neue Erkenntnisse sicherlich für irgendetwas von Nutzen sind. In diesem Fall schließt dieses «etwas» Radio, Fernsehen und Radar ein.[5] Wenn jemand eine neue Möglichkeit entdeckt, den Wärmefluss zu verstehen, und eine brillante neue Technik entwickelt, für die es leider noch keine richtige mathematische Grundlage gibt, dann ist es sinnvoll, das Ganze als mathematisches Problem zu betrachten. Selbst wenn man sich keine Bohne für Wärmefluss interessiert, könnten die Resultate durchaus anderweitig Anwendung finden. Die Fourier-Analyse, die aus diesem Forschungsansatz erwuchs, ist wahrscheinlich die nützlichste mathematische Einzelidee, die jemals entwickelt wurde. Sie bildet die Grundlage der modernen Telekommunikation, ermöglicht moderne Kameras, hilft, alte Filme und Tonaufnahmen wiederherzustellen, und das FBI benutzt eine moderne Erweiterung der Methode zur Speicherung von Fingerabdrücken.[6]
Nach einigen tausend Jahren eines derartigen Austauschs zwischen dem externen Einsatz von Mathematik und ihrer inneren Struktur sind diese beiden Aspekte des Faches inzwischen so eng verwoben, dass es so gut wie unmöglich ist, sie auseinanderzudividieren. Die geistigen Haltungen, die dahinter stehen, lassen sich hingegen leichter unterscheiden und haben zu einer groben Einteilung der Mathematik in «reine» und «angewandte» geführt. Das ist als provisorischer Weg, mathematische Ideen in eine intellektuelle Landschaft einzubetten, durchaus akzeptabel, aber keine besonders präzise Beschreibung des Faches selbst. Bestenfalls unterscheidet sie zwei Enden eines kontinuierlichen Spektrums mathematischer Arbeitsweisen. Schlimmstenfalls verdreht sie, welche Teile des Faches nützlich sind und woher die Ideen stammen. Wie bei allen wissenschaftlichen Disziplinen ist das, was der Mathematik ihre Macht verleiht, die Kombination aus abstrakter Logik und Inspiration aus der Außenwelt – eines speist sich aus dem anderen. Es ist nicht nur unmöglich, diese beiden Stränge auseinanderzudividieren, es ist auch sinnlos.
Die meisten der wirklich wichtigen mathematischen Probleme, die großen Probleme, um die es in diesem Buch geht, sind durch eine Art intellektuelle Nabelschau innerhalb des Faches erwachsen. Der Grund dafür ist einfach: Es handelt sich um mathematische Probleme. Die Mathematik erscheint oft als Sammlung isolierter Gebiete, die alle ihre eigene Technik aufweisen: Algebra, Geometrie, Trigonometrie, Analysis, Kombinatorik, Wahrscheinlichkeitsrechnung. In der Regel wird sie auch so unterrichtet: Ein jedes Thema in einem einzigen, wohldefinierten Gebiet anzusiedeln, hilft Schülern, das Material in ihrem Kopf zu ordnen. Es ist eine vernünftige erste Näherung an die Struktur der Mathematik, vor allem seit langem etablierter Mathematik. An der vordersten Front der Forschung bricht diese saubere Trennung jedoch oft zusammen. Es ist nicht nur so, dass die Grenzen zwischen den Hauptgebieten der Mathematik verschwommen sind. Sie existieren in Wirklichkeit gar nicht.
Jedem Mathematiker in der Forschung ist klar, dass sich bei jedem Problem, an dem er arbeitet, jederzeit und in unvorhersehbarer Weise herausstellen kann, dass es zur Weiterarbeit Ideen aus einem scheinbar in keinem Zusammenhang stehenden Gebiet bedarf. Tatsächlich kombinieren neuartige Forschungsansätze häufig mehrere Gebiete. Beispielsweise geht es bei meiner eigenen Forschung vorwiegend um Musterbildung in dynamischen Systemen, Systemen, die sich nach bestimmten Regeln in Abhängigkeit von der Zeit verändern. Ein typisches Beispiel ist die Art und Weise, in der sich Tiere bewegen. Ein trabendes Pferd wiederholt ständig dieselbe Folge von Beinbewegungen, und es gibt dabei ein klares Muster: Die Beine treffen in diagonal verknüpften Paaren auf dem Boden auf, zuerst das Bein links vorne und das Bein rechts hinten, dann die beiden anderen. Ist dies ein Problem, bei dem es um Muster geht, was bedeuten würde, dass die geeigneten Methoden aus der Gruppentheorie kommen, der Mathematik von Symmetrien? Oder ist es ein Problem, bei dem es um Dynamik geht, in welchem Fall Differenzialgleichungen nach Newton’scher Art zum Einsatz kommen?
Die Antwort lautet, dass es per definitionem beides sein muss. Es ist nicht ihre Schnittmenge, die dem Material entspräche, das sie gemeinsam haben – im Grunde nichts. Vielmehr ist es ein neues «Gebiet», das die zwei traditionellen Sparten der Mathematik überspannt. Es ist wie eine Brücke über einen Fluss, der zwei Länder trennt; sie verbindet beide, gehört aber zu keinem von ihnen. Diese Brücke ist jedoch keine schmale Fahrbahn, sie ist in ihrer Größe jedem der beiden Länder vergleichbar. Und was noch wichtiger ist, die eingesetzten Methoden sind nicht auf die beiden Länder beschränkt. Tatsächlich hat praktisch jede Vorlesung in Mathematik, die ich jemals gehört habe, irgendwann in meiner Forschung eine Rolle gespielt. In der Vorlesung über die Galois-Theorie, die ich als junger Student in Cambridge gehört habe, ging es darum, wie man eine algebraische Gleichung fünften Grades löst (oder um es genauer zu sagen, warum wir eine solche Gleichung nicht lösen können). Meine Vorlesung in Graphentheorie beschäftigte sich mit Netzwerken, Punkten, die durch Linien verbunden sind. Ich habe nie eine Vorlesung über dynamische Systeme belegt, weil ich über Algebra promoviert habe, doch im Lauf der Jahre habe ich die Grundlagen aufgeschnappt, vom Fließgleichgewicht bis zum Chaos. Galois-Theorie, Graphen-Theorie und dynamische Systeme: drei verschiedene Gebiete. So nahm ich jedenfalls bis 2011 an, als ich zu verstehen versuchte, wie sich chaotische Dynamik in einem Netzwerk dynamischer Systeme aufspüren lässt, und ein entscheidender Schritt basierte auf Dingen, die ich 45 Jahre zuvor in meiner Galois-Vorlesung gelernt hatte.
Mathematik ist daher nicht mit einer politischen Karte der Welt vergleichbar, bei der jedes Spezialgebiet klar begrenzt und jedes Land eindeutig von seinen Nachbarn zu unterscheiden ist, weil es rosa, grün oder hellblau eingefärbt ist. Sie ähnelt eher einer natürlichen Landschaft, in der man niemals wirklich sagen kann, wo das Tal endet und das Hügelland beginnt oder wo der Wald in Busch- und Grassavanne übergeht, wo in jede Art von Gelände Seen eingebettet sind und Flüsse die schneebedeckten Berghänge mit den fernen, tief gelegenen Meeren verbinden. Diese sich ständig verändernde mathematische Landschaft besteht jedoch nicht aus Gestein, Wasser und Pflanzen, sondern aus Ideen; sie wird nicht von Geographie, sondern von Logik zusammengehalten. Und es ist eine dynamische Landschaft, die sich verändert, wenn neue Ideen und Methoden entdeckt bzw. gefunden werden. Wichtige Konzepte mit weitreichenden Folgen sind wie Berggipfel, und vielseitig einsetzbare Techniken sind wie breite Flüsse, die Reisende über die fruchtbaren Ebenen tragen. Je deutlicher definiert die Landschaft wird, desto leichter ist es, noch unbestiegene Gipfel oder unerforschtes Gelände zu entdecken, das das Fortkommen behindert. Im Lauf der Zeit erlangen einige der Gipfel und Hindernisse Kultstatus. Das sind die großen Probleme.
Was macht ein großes mathematisches Problem groß? Intellektuelle Tiefe in Kombination mit Einfachheit und Eleganz. Und es muss wirklich schwierig zu knacken sein. Jeder kann einen Hügel besteigen; der Everest ist eine völlig andere Sache. Ein großes Problem ist gewöhnlich leicht zu erklären, auch wenn die dazu erforderlichen Fachbegriffe elementar oder hoch spezialisiert sein können. Die Aussagen von Fermats letztem Satz und dem Vier-Farben-Problem leuchten jedermann, der mit der Schulmathematik vertraut ist, sofort ein. Im Gegensatz dazu ist es unmöglich, die Hodge-Vermutung oder die Massenlücken-Hypothese zu erklären, ohne komplexe Konzepte von der vordersten Front der Forschung einzubeziehen – Letztere geht schließlich auf die Quantenfeldtheorie zurück. Für diejenigen, die auf solchen Gebieten zu Hause sind, ist die Aussage der Frage, um die es geht, einfach und natürlich. Sie umfasst keinen seitenlangen dichten und undurchdringlichen Text. Dazwischen liegen Probleme, die etwa auf dem Niveau des Mathematik-Grundstudiums angesiedelt sind, wenn man sie vollständig verstehen will. Ein allgemeineres Gefühl für das Wesentliche des Problems – woher es stammt, warum es wichtig ist, was wir mit der Lösung anfangen könnten – ist gewöhnlich jedem interessierten Leser zugänglich, und das ist es, was ich ihm bieten möchte. Ich gebe zu, dass die Hodge-Vermutung in dieser Hinsicht eine harte Nuss ist, da sie sehr technisch und abstrakt ist. Sie gehört jedoch zu den sieben mathematischen Millennium-Problemen des Clay Institute, auf deren Lösung ein 1-Million-Dollar-Preis ausgesetzt ist, daher möchte ich keinesfalls darauf verzichten.
Große Probleme sind kreativ: Sie helfen, neue mathematische Erkenntnisse zu schaffen. 1900 hielt David Hilbert auf dem Internationalen Mathematikerkongress in Paris einen Vortrag, in dem er die 23 wichtigsten Probleme in der Mathematik auflistete. Fermats letzter Satz war nicht darunter, doch er erwähnte ihn in der Einleitung. Wenn ein renommierter Mathematiker einige der aus seiner Sicht großen Probleme aufzählt, hören ihm andere Mathematiker aufmerksam zu. Die Probleme stünden nicht auf der Liste, wenn sie nicht wichtig und schwierig zu lösen wären. Es ist natürlich, die Herausforderung anzunehmen und zu versuchen, sie zu knacken. Seitdem war die Lösung eines der von Hilbert genannten Probleme immer ein guter Weg, sich seine mathematischen Sporen zu verdienen. Viele dieser Probleme sind zu speziell, um sie hier vorzustellen, viele sind Programme mit offenem Ende, statt spezifische Probleme zu sein, und mehrere werden später noch abgehandelt. Sie verdienen jedoch eine Erwähnung, daher finden Sie eine kurze Zusammenfassung in den Anmerkungen.[7]
Das ist es, was ein großes mathematisches Problem groß macht. Was es zu einem Problem macht, ist selten entscheidend dafür, wie die Antwort lauten sollte. Bei praktisch allen großen Problemen haben die Mathematiker eine sehr klare Vorstellung davon, wie die Antwort lauten sollte – oder hatten sie, wenn die Antwort inzwischen bekannt ist. Die Formulierung des Problems enthält tatsächlich häufig die erwartete Antwort. Alles, was als Vermutung beschrieben wird, ist genau das: eine plausible Mutmaßung, die auf einer Vielzahl von Hinweisen basiert. Die meisten gut untersuchten Vermutungen stellen sich schließlich als korrekt heraus, wenn auch nicht alle. Ältere Begriffe wie Hypothese haben dieselbe Bedeutung, und in Fermats Fall wird (genauer gesagt, wurde) der Ausdruck «Satz» missbraucht – ein Satz oder Theorem verlangt einen Beweis, aber genau das fehlte, bis Wiles ihn lieferte.
Ein Beweis ist genau die Anforderung, die große Probleme problematisch macht. Jeder, der einigermaßen kompetent ist, kann ein paar Berechnungen durchführen, ein offensichtliches Muster erkennen und dessen Essenz in einer prägnanten Aussage zusammenfassen. Mathematiker verlangen mehr als das: Sie bestehen auf einem vollständigen, logisch makellosen Beweis. Oder, wenn sich die Antwort als negativ herausstellen sollte, auf einer Widerlegung. Die verführerische Kraft eines großen Problems lässt sich nicht richtig einschätzen, ohne die entscheidende Rolle des Beweises in der Mathematik zu würdigen. Jeder kann eine plausible Vermutung anstellen. Was schwierig ist, ist zu beweisen, dass sie richtig ist. Oder falsch.
Das Konzept des mathematischen Beweises hat sich im Lauf der Geschichte verändert; die Anforderungen an die Logik sind im Allgemeinen höher geworden. Es hat viele hoch intellektuelle philosophische Diskussionen über das Wesen des Beweises gegeben, und diese haben viele wichtige Fragen aufgeworfen. Für den Begriff «Beweis» sind präzise logische Definitionen von «Beweis» vorgeschlagen und eingeführt worden. Die Definition, die wir im Grundstudium verwenden, lautet: Ein Beweis beginnt mit einer Sammlung von Grundsätzen, sogenannten Axiomen. Die Axiome sind so etwas wie die Regeln des Spiels. Andere Axiome sind möglich, doch sie führen zu anderen Spielen. Der antike griechische Geometer Euklid war es, der diesen Ansatz in die Mathematik einführte, und er ist noch heute gültig. Wenn man sich auf die Axiome geeinigt hat, entspricht ein Beweis einer Aussage einer Reihe von Schritten, von denen jeder entweder eine logische Folge der Axiome oder zuvor bewiesener Aussagen ist oder beides. Tatsächlich erkundet der Mathematiker ein logisches Labyrinth, dessen Kreuzungen Aussagen und dessen Gänge gültige logische Herleitungen (Deduktionen) sind. Ein Beweis ist ein Weg durch das Labyrinth, der von Axiomen ausgeht. Und er beweist die Aussage, bei der er endet.
Dieses hübsche saubere Beweiskonzept ist jedoch nicht die ganze Geschichte. Es ist nicht einmal der wichtigste Teil der Geschichte. Es ist so, als sage man, eine Symphonie sei eine Folge von Noten, die den Regeln der Harmonie unterliegen. Bei dieser Aussage fehlt die ganze Kreativität. Sie sagt uns nicht, wie man Beweise findet, oder auch nur, wie man die Beweise anderer Leute überprüft. Sie sagt uns nicht, welche Örtlichkeiten im Labyrinth wichtig sind. Sie sagt uns nicht, welche Wege elegant und welche hässlich sind, welche wichtig und welche unwichtig sind. Es ist eine formale, mechanische Beschreibung eines Prozesses, der viele andere Aspekte aufweist, vor allem eine menschliche Dimension. Beweise werden von Menschen entdeckt, und die Forschung in der Mathematik ist nicht nur Sache einer Schritt-für-Schritt-Logik.
Wenn man die formale Definition eines Beweises wörtlich nimmt, kann dies zu Beweisen führen, die praktisch unlesbar sind, weil man die meiste Zeit damit verbringt, sich minutiös mit jeder logischen Kleinigkeit auseinanderzusetzen, während einem das Ergebnis praktisch bereits ins Gesicht starrt. Daher kürzen praktizierende Mathematiker die ganze Sache ab und lassen alles aus, was Routine oder offensichtlich ist. Sie machen deutlich, dass da eine Lücke ist, indem sie Standardausdrücke verwenden wie «es lässt sich leicht zeigen» oder «Routineberechnungen besagen». Was sie nicht tun, jedenfalls nicht bewusst, ist, sich an einer logischen Schwierigkeit vorbeizudrücken und so zu tun, als gebe es sie nicht. Tatsächlich wird ein kompetenter Mathematiker ausdrücklich darauf hinweisen, welche Teile der Argumentation logisch auf schwachen Füßen stehen, und er wird die meiste Zeit darauf verwenden zu erklären, wie man sie ausreichend standfest machen kann. Das Ergebnis ist, dass ein Beweis in der Praxis eine mathematische Geschichte mit eigenem Erzählfluss ist. Sie hat einen Anfang, eine Mitte und ein Ende. Oft hat sie auch Nebenhandlungen, die sich aus der Haupthandlung ergeben und von denen jede ihre eigene Auflösung hat. Der britische Mathematiker Christopher Zeeman meinte einmal, ein Theorem sei ein intellektueller Ruhepunkt. Man kann anhalten, wieder Atem schöpfen und das Empfinden genießen, etwas Definitives zu haben. Die Nebenhandlung zurrt einen losen Faden in der Hauptgeschichte fest. Auch in anderer Hinsicht ähneln Beweise Geschichten: Sie verfügen oft über einen oder mehrere Hauptcharaktere – natürlich eher Ideen als Personen –, deren komplexes Wechselspiel schließlich zur Lösung führt.
Wie die Definition aus dem Grundstudium besagt, beginnt ein Beweis mit einer oder mehreren klar formulierten Annahmen, zieht daraus in kohärenter und strukturierter Weise logische Schlüsse und endet mit dem, was auch immer man beweisen will. Aber ein Beweis ist nicht nur eine Liste von Deduktionen, und Logik ist nicht das einzige Kriterium. Ein Beweis ist eine Geschichte, die Leuten erzählt und von diesen Leuten – die einen Großteil ihres Lebens damit verbracht haben, zu lernen, wie man solche Geschichten liest und Fehler oder Ungereimtheiten findet – logisch auseinandergenommen wird: Menschen, deren Hauptziel es ist, nachzuweisen, dass der Geschichtenerzähler falsch liegt, und die die unheimliche Gabe besitzen, Schwächen zu erkennen und auf ihnen herumzuhämmern, bis sie in einer Staubwolke zusammenbrechen. Wenn irgendein Mathematiker behauptet, er habe ein bedeutendes Problem gelöst, sei es eines der großen Probleme oder ein anderes würdiges, aber weniger herausgehobenes Problem, ist der professionelle Reflex nicht, «hurra!» zu rufen und eine Flasche Champagner zu öffnen, sondern zu versuchen, ihn zu widerlegen.
Das mag negativ klingen, doch der Beweis ist das einzige zuverlässige Werkzeug, das Mathematiker haben, um sicherzustellen, dass das, was sie sagen, korrekt ist. Da Forscher diese Art von Reaktion erwarten, verbringen sie viel Zeit mit dem Versuch, ihre eigenen Ideen und Beweise zu widerlegen. Auf diese Weise ist es weniger peinlich. Wenn eine Geschichte diese Art kritischer Beurteilung überstanden hat, verwandelt sich der Konsens rasch in Zustimmung, und an diesem Punkt erhält der Schöpfer des Beweises das Lob sowie die Anerkennung und Belohnung, die ihm zustehen. Jedenfalls läuft die Sache gewöhnlich so ab, wenn es auch vielleicht für die Beteiligten nicht immer so aussieht. Wenn man in einer Sache mittendrin steckt, ist die eigene Sicht dessen, was da gerade abläuft, möglicherweise eine andere als die eines unparteiischeren Beobachters.
Wie lösen Mathematiker Probleme? Zu dieser Frage gibt es nur wenige strenge wissenschaftliche Untersuchungen. Die moderne Bildungsforschung, die auf den Kognitionswissenschaften beruht, konzentriert sich weitgehend auf die Erziehung bis zum Highschool-Level. Einige Studien befassen sich mit der Lehre im Grundstudium Mathematik, doch das sind nur wenige. Es gibt bedeutende Unterschiede zwischen dem Lernen und Lehren von bereits vorhandenem mathematischen Wissen und der Schaffung neuen mathematischen Wissens. Viele von uns können ein Musikinstrument spielen, doch deutlich weniger sind in der Lage, ein Konzert oder auch nur einen Popsong zu schreiben.
Wenn es um Kreativität auf höchstem Niveau geht, stammt viel von dem, was wir wissen – oder zu wissen meinen –, aus Introspektion. Einen der ersten ernsthaften Versuche, herauszufinden, wie Mathematiker denken, unternahm Jacques Hadamard in seinem Buch The Psychology of Invention in the Mathematical Field, das 1945 erschien.[8] Hadamard interviewte führende Mathematiker und Naturwissenschaftler seiner Tage und bat sie zu beschreiben, wie sie dachten, wenn sie an schwierigen Problemen arbeiteten. Was sich ganz klar herauskristallisierte, war die entscheidende Rolle einer Eigenschaft, die man mangels eines besseren Ausdrucks als «Intuition» bezeichnen muss. Eine unbewusste Facette ihres Verstandes lenkte ihre Gedanken. Ihre kreativsten Erkenntnisse erwuchsen nicht aus einer schrittweisen logischen Ableitung, sondern aus plötzlichen wilden Sprüngen. Eine der detailliertesten Beschreibungen dieses scheinbar unlogischen Ansatzes zur Lösung einer logischen Frage lieferte der französische Mathematiker Henry Poincaré, Ende des 19./Anfang des 20. Jahrhunderts einer der führenden Köpfe seiner Disziplin. Poincaré beschäftigte sich mit zahlreichen Gebieten der Mathematik, gründete mehrere neue Gebiete und veränderte andere radikal. Er spielt in mehreren späteren Kapiteln eine wichtige Rolle. Zudem schrieb er populäre Wissenschaftsbücher, und diese breite Erfahrung half ihm möglicherweise, einen tieferen Einblick in seine eigenen Gedankengänge zu gewinnen. Wie dem auch sei, Poincaré war fest davon überzeugt, dass bewusstes logisches Denken nur ein Teil des kreativen Prozesses war. Ja, es gab Phasen, in denen es unabdingbar war: bei der Entscheidung, worum es bei dem Problem eigentlich ging, und bei der systematischen Verifizierung der Antwort. Aber dazwischen hatte Poincaré oft das Gefühl, sein Gehirn arbeite weiter an dem Problem, ohne ihn zu informieren, und das in einer Weise, die er einfach nicht begreifen konnte.
Bei seiner Analyse des kreativen Prozesses unterschied er drei Schlüsselstadien: Präparation (Vorbereitung), Inkubation (Bebrütung) und Illumination (Erleuchtung). Die Vorbereitung besteht aus dem bewussten logischen Bemühen, das Problem zu erfassen, es zu präzisieren und mit konventionellen Methoden anzugehen. Diese Stadien hielt Poincaré für essenziell: Es bringt das Unterbewusste in Gang und liefert Rohmaterial, mit dem dieses arbeiten kann. Zur Inkubation kommt es, wenn man aufhört, über das Problem nachzudenken, und etwas anderes macht. Das Unterbewusste beginnt nun, oft recht wilde Ideen miteinander zu kombinieren, bis es im Dunkeln zu dämmern beginnt. Mit etwas Glück führt dies zur Erleuchtung: Ihr Unterbewusstsein klopft Ihnen auf die Schulter, und in Ihrem Kopf wird das sprichwörtliche Licht angeknipst.
Diese Art von Kreativität ähnelt einem Drahtseilakt. Auf der einen Seite wird man kein schwieriges Problem lösen, wenn man sich nicht mit dem Gebiet vertraut macht, zu dem es offenbar gehört – zusammen mit vielen anderen Gebieten, die vielleicht damit verknüpft sind oder auch nicht, nur für den Fall, dass sie es tatsächlich sind. Auf der anderen Seite gilt: Wenn alles, was man tut, darin besteht, sich im üblichen Denken zu verfangen und Wege einzuschlagen, die andere schon erfolglos ausprobiert haben, gerät man in eine geistige Spurrille und entdeckt nichts Neues. Daher besteht der Trick darin, eine Menge zu wissen, es bewusst zusammenzuführen und sein Gehirn wochenlang auf Trab zu halten … und die Frage dann beiseitezulegen. Der intuitive Teil des Verstandes macht sich dann an die Arbeit, reibt Ideen aneinander, um zu sehen, ob Funken fliegen, und sagt uns Bescheid, wenn er etwas gefunden hat. Das kann in jedem Moment passieren: Poincaré erkannte plötzlich die Lösung eines Problems, das ihn seit Monaten beschäftigt hatte, als er aus einem Bus stieg. Dem autodidaktischen indischen Mathematiker Srinivasa Ramanujan, der ein Talent für bemerkenswerte Formeln hatte, fielen seine Ideen oft im Traum ein. Archimedes saß dem Vernehmen nach in der Badewanne, als er die Lösung für das Problem fand, den Goldgehalt einer Königskrone zu bestimmen, ohne sie zu zerstören.
Poincaré betonte, dass ein Fortschritt ohne die anfängliche Phase der Vorbereitung unwahrscheinlich sei. Das Unterbewusstsein, insistierte er, braucht viel Stoff zum Nachdenken, anderenfalls kann die zufällige Kombination von Ideen, die schließlich zu einer Lösung führt, nicht zustande kommen. Aus Perspiration erwächst Inspiration. Er muss auch gewusst haben – denn jeder schöpferische Mathematiker weiß dies –, dass dieser einfache dreistufige Prozess selten nur ein einziges Mal durchlaufen wird. Die Lösung eines Problems erfordert oft mehr als nur einen einzigen Durchbruch. Die Inkubationsphase für eine Idee kann von einem sekundären Prozess der Präparation, Inkubation und Illumination für etwas unterbrochen werden, das nötig ist, damit die erste Idee funktioniert. Die Lösung eines jeden Problems, das den Schweiß der Edlen wert ist, sei es groß oder nicht, umfasst in der Regel viele derartige Sequenzen, die ineinander verschachtelt sind wie Benoît Mandelbrots Fraktale. Man löst ein Problem, indem man es in Unterprobleme aufspaltet, und wiegt sich dann in der Hoffnung, dass man, wenn man diese Unterprobleme lösen kann, die Resultate zusammenführen und das Hauptproblem lösen kann. Dann arbeitet man an den Unterproblemen. Manchmal löst man eines von ihnen, manchmal gelingt es nicht, und man muss umdenken. Manchmal spaltet sich ein Unterproblem in mehrere Teile auf. Es kann ganz schön anstrengend sein, auch nur den Plan nicht aus den Augen zu verlieren.
Ich habe das Wirken des Unterbewussten als «Intuition» bezeichnet. Dies ist einer der verführerischen Begriffe wie «Instinkt», der häufig gebraucht wird, obwohl er keine wirkliche reale Bedeutung hat. Es ist ein Name für etwas, dessen Präsenz wir erkennen, das wir aber nicht verstehen. Mathematische Intuition ist die Fähigkeit des Geistes, Form und Struktur zu spüren, Muster zu entdecken, die wir nicht bewusst wahrnehmen können. Der Intuition fehlt die Kristallklarheit des bewussten logischen Denkens, doch das gleicht sie aus, indem sie unsere Aufmerksamkeit auf Dinge lenkt, die wir bewusst niemals in unsere Überlegungen einbezogen hätten. Neurowissenschaftler beginnen gerade erst zu verstehen, wie das Gehirn viel einfachere Aufgaben durchführt. Wie auch immer Intuition funktioniert, sie muss darauf basieren, wie das Gehirn gebaut ist und mit der Außenwelt in Wechselwirkung tritt.
Oft besteht der Schlüsselbeitrag der Intuition darin, uns auf schwache Punkte eines Problems aufmerksam zu machen, Stellen, an denen sich ein Angriff lohnen könnte. Ein mathematischer Beweis ist wie eine Schlacht, oder wenn man eine weniger kriegerische Metapher vorzieht, wie ein Schachspiel. Sobald ein potenzieller Schwachpunkt entdeckt ist, kann der technische Zugriff des Mathematikers auf die Maschinerie der Mathematik ins Spiel gebracht werden, um ihn auszunutzen. Wie Archimedes, der sich einen festen Punkt wünschte, um die Erde aus den Angeln zu heben, braucht der forschende Mathematiker eine Möglichkeit, bei dem Problem den Hebel anzusetzen. Eine Schlüsselidee kann es «aufschließen», es für Standardmethoden zugänglich machen. Danach ist alles nur noch eine Frage der Technik.
Mein Lieblingsbeispiel für diese Art von Hebelansatz ist ein Rätsel, das keine intrinsische mathematische Bedeutung hat, aber eine wichtige Botschaft überbringt. Nehmen wir an, Sie haben ein Schachbrett mit 64 Feldern sowie einen Vorrat von Dominosteinen genau der richtigen Größe, um zwei benachbarte Felder auf dem Brett abzudecken. Dann ist es einfach, das ganze Brett mit 32 Dominosteinen abzudecken. Aber nun stellen Sie sich vor, dass zwei diagonal gegenüberliegende Ecken des Brettes fehlen, wie in Abbildung 1. Lassen sich die verbliebenen 62 Quadrate mit 31 Dominosteinen abdecken? Wenn Sie es ausprobieren, scheint nichts zu funktionieren. Auf der anderen Seite fällt es schwer einzusehen, dass so etwas unmöglich sein sollte. Bis Ihnen klar wird, dass jeder Dominostein, ganz gleich, wie man ihn anordnet, ein schwarzes und ein weißes Quadrat abdecken muss. Das ist Ihr Hebel, nun müssen Sie ihn nur noch einsetzen. Es impliziert, dass jede von Dominosteinen bedeckte Region dieselbe Zahl von schwarzen und weißen Quadraten enthält. Aber diagonal gegenüberliegende Seiten haben dieselbe Farbe; wenn man also zwei entfernt (in diesem Fall zwei weiße), führt dies zu einer Form, bei der es zwei schwarze Felder mehr gibt als weiße. Daher lässt sich eine solche Form nicht abdecken. Die Beobachtung, dass es eine Farbkombination gibt, die jeder Dominostein abdeckt, ist der Schwachpunkt des Rätsels. Dieser Punkt bietet Ihnen einen Ansatzpunkt, um den Hebel Ihrer Logik anzusetzen und zu betätigen. Wenn Sie ein mittelalterlicher Baron wären, der ein Schloss angreift, wäre dies der Schwachpunkt in der Mauer – die Stelle, wo Sie die Schleuderkraft ihrer Wurfmaschine konzentrieren oder einen Tunnel graben sollten, um sie zu unterminieren.
Abbildung 1: Kann man das ausgeschnittene Schachbrett mit Dominosteinen bedecken, von denen jeder zwei Quadrate abdeckt (oben rechts)? Wenn man die Dominosteine einfärbt (unten rechts) und zählt, wie viele schwarze und weiße Quadrate es gibt, ist die Antwort klar.
Die mathematische Forschung unterscheidet sich in einer wichtigen Hinsicht von einer Schlacht. Jedes Territorium, das Sie einmal eingenommen haben, bleibt auf immer das Ihre. Sie entschließen sich vielleicht, Ihre Bemühungen auf etwas anderes zu konzentrieren, doch nachdem ein Theorem einmal bewiesen ist, verschwindet es nicht wieder. Auf diese Weise machen Mathematiker Fortschritte bei einem Problem, selbst wenn es ihnen nicht gelingt, es zu lösen. Sie beweisen eine neue Tatsache, die dann von jedermann in jedem beliebigen Kontext benutzt werden kann. Der Startpunkt für einen erneuten Angriff auf ein uraltes Problem erwächst aus einem zuvor unbemerkten Juwel, das halb vergraben in einem formlosen Haufen schlecht sortierter Fakten liegt. Und das ist einer der Gründe, warum neue mathematische Erkenntnisse um ihrer selbst willen wichtig sein können, selbst wenn man ihren Wert nicht auf den ersten Blick erkennt. Diese neue Mathematik ist ein weiteres Stück Land, das erobert wurde, eine weitere Waffe im Waffenarsenal. Ihre Zeit kommt möglicherweise noch – aber sie wird sicherlich nicht kommen, wenn diese Erkenntnis als «nutzlos» erachtet und vergessen wird oder niemals die Chance hat zu entstehen, weil sich niemand vorstellen kann, welchen Zweck sie einmal erfüllen könnte.