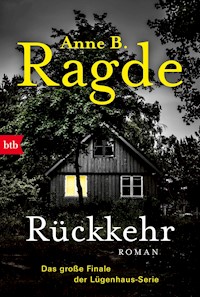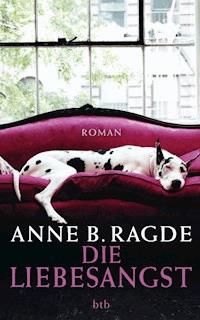12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: btb Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Lügenhaus-Serie
- Sprache: Deutsch
Die 40-jährige Torunn Neshov hatte bisher wenig Glück in der Liebe, und auch beruflich lief es nicht wirklich rund. Doch als die ehemalige Tierpflegerin sich entscheidet, den langsam verfallenden Bauernhof ihrer Familie zu übernehmen und in das dümpelnde Bestattungsunternehmen ihres Onkels einzusteigen, nimmt ihr Leben Fahrt auf. Sie mistet gründlich aus und zwar in jeder Hinsicht. Das gefällt nicht jedem. Aber Torunn ist hartnäckig und hat ein Händchen für schwierige Fälle, auch wenn es um die Liebe geht ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 445
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Zum Buch
Die 40-jährige Torunn Neshov hatte bisher wenig Glück in der Liebe, und auch beruflich lief es nicht wirklich rund. Doch als die ehemalige Tierpflegerin sich entscheidet, den langsam verfallenden Bauernhof ihrer Familie zu übernehmen und in das dümpelnde Bestattungsunternehmen ihres Onkels einzusteigen, nimmt ihr Leben Fahrt auf. Sie mistet gründlich aus und zwar in jeder Hinsicht. Das gefällt nicht jedem. Aber Torunn ist hartnäckig und hat ein Händchen für schwierige Fälle, auch wenn es um die Liebe geht …
Zur Autorin
Anne B. Ragde wurde 1957 in Hardanger geboren und lebt heute in Trondheim. Sie ist eine der beliebtesten und erfolgreichsten Autorinnen Norwegens und wurde mehrfach ausgezeichnet. Mit ihren Romanen »Das Lügenhaus«, »Einsiedlerkrebse« und »Hitzewelle« gelang ihr einer der größten norwegischen Bucherfolge aller Zeiten. Nachdem Anne B. Ragde zunächst angekündigt hatte, die Lügenhaus-Serie nicht weiter zu schreiben, erschienen mit »Sonntags in Trondheim« und »Die Liebhaber« die Fortsetzungen der auch in Deutschland überaus beliebten Buchserie.
Anne B. Ragde
Die Liebhaber
ROMAN
Aus dem Norwegischen vonGabriele Haefs
Als die Musik einsetzte, hob Margido den Kopf und ließ seinen Blick aus dem Bürofenster schweifen. Dass Melodie und Text so schön klangen, kam für ihn vollkommen unerwartet. Während er am Begleitheft für eine Beerdigung arbeitete und den Inhalt dreimal überprüfte, hörte er nur mit halbem Ohr den jungen Männern im Radio zu, die wild durcheinanderredeten und erzählten, wie hart sie für ihre erste Platte gearbeitet hatten.
Außerhalb der Kirche oder des Andachtsraums spielte Musik in seinem Leben keine große Rolle, er hatte zu Hause nicht einmal eine Musikanlage. Aber er ließ oft leise das Radio laufen, wenn er allein im Büro saß, er liebte schöne Choräle und war fast immer gerührt von der Musik, die Angehörige für eine Trauerfeier auswählten. Die Musik erzählte von Sehnsucht und Trauer und davon, wie das Leben gewesen war, bevor auf einmal der Tod zugeschlagen hatte.
Plötzlich kam ihm der Gedanke, dass große Schönheit und tiefe Trauer eigentlich nicht sehr weit auseinanderlagen. Die Klänge, die er jetzt anstelle der erwarteten jugendlichen Krachmusik vernahm, waren unbeschreiblich lieblich und hoben noch einmal seine Stimmung, die ohnehin nicht schlecht gewesen war. Und doch, ging ihm durch den Kopf, saß an einem anderen Ort vielleicht jemand und hörte dieselbe Musik, jemand in so tiefer Trauer, dass Melodie und Text einfach nicht zu ertragen waren. Er stattdessen sah hier aus dem Fenster und lächelte still vor sich hin, während vielleicht die Wunden dieses anderen Menschen aufgerissen wurden und er das Radio ausschaltete, um nicht weiter zuhören zu müssen. Seltsam, dachte er, wie das Leben selbst, unvorhersehbar.
An Unvorhersehbarkeit war er gewöhnt, und der Tod war etwas, wovon er lebte, es war seine Aufgabe, nach einem Tod aufzuräumen, ihn zu beschönigen und mit Blumen und Kerzen zu schmücken, dafür zu sorgen, dass keine Unklarheiten übrig blieben. Trotzdem konnte er nun hier sitzen und sich freuen.
Er freute sich über Torunn. Und weil er ihr endlich zeigen konnte, wie wichtig sie ihm war. Kaum eine Stunde verging, in der er nicht dankbar war, weil Gottes Fügung Torunn zu ihm gebracht hatte, weil sie eine so enge und gute Beziehung entwickelt hatten, weil Torunn das Bestattungsunternehmen Neshov als »Familienbetrieb« bezeichnete. Ihr stand noch immer eine lange Entwicklung bevor, und er war sich durchaus nicht sicher, ob sie sie bewältigen würde, aber sie befand sich auf einem guten Weg. Und sie befand sich mitten in seinem Leben, so ziemlich als Einzige; die anderen aus dem Büro standen ihm nahe, das war selbstverständlich bei den vielen gemeinsamen, intensiven Erlebnissen, die der Tod mit sich brachte, doch er ließ sie niemals ganz an sich heran, wahrte immer eine kleine, aber beruflich wichtige Distanz.
Die Musik verstummte, und die jungen Männer nahmen ihre Gespräche wieder auf. Solche Musik schreibt niemand, der nicht ganz unten in der tiefsten Finsternis gewesen ist, und sei es nur für einen kurzen Moment, dachte er. Er hörte jetzt voller Respekt zu, was die jungen Männer zu sagen hatten.
Das mit Astrid ist ja doch verdammt schnell gegangen«, sagte Olaug, dann biss sie eine Ecke von ihrem Gurken-Mayonnaise-Sandwich ab und kaute mit offenem Mund weiter. Sie hatte noch ihre eigenen Zähne, auch wenn die alles andere als ansehnlich waren.
Olaug, das war die mit den schütteren Haaren, die eigentlich fast kahlköpfig wirkte. Man konnte zwischen den Büscheln aus starrem grauem Haar ihre Kopfhaut sehen, die blank und gelblich glänzte. Olaug trug immer dieselben Silberstecker in den Ohrläppchen, morgens wie abends, und er vermutete, dass sie auch damit zu Bett ging, denn sonst hätte sie doch irgendwann auch mal vergessen müssen, sie anzubringen. Die Kugeln hingen schlaff aus dem Loch in dem runzligen Ohrläppchen, man sah ein Stück des silbernen Stifts, mit dem sie befestigt waren, und er fragte sich, warum sich Menschen solche Löcher zulegten, das musste doch schrecklich wehtun. Vielleicht stachen sie sie mit einer Nadel? Sie wohnte zwei Zimmer weiter auf der gegenüberliegenden Gangseite. Tormod mochte sie gern.
Sie war oft diejenige, die als Erste etwas zur Sprache brachte, das die anderen nur dachten. Es gefiel ihm, dass sie diese Dinge aussprach. Gerade erzählte sie, dass Astrid in der Nacht gestorben war, eine Neuigkeit, die sie alle kannten, die aber einfach nur stumm über dem Frühstück gehangen hatte, düster und drückend, wie die Luft unmittelbar vor einem Gewitter und dem ersten Knall. Oder wie bei einem Magengrimmen, ehe man merkt, dass die Luft endlich aus einem Teil des Darms in einen anderen entweicht und der Schmerz nachlässt.
An diesen Zustand war er seit Langem gewöhnt, denn er hatte fast sein ganzes Leben in diesem Zustand verbracht. Bisher hatte es niemanden gegeben, der die wichtigen Dinge zur Sprache brachte. Und so begleiteten sie ihn vom wachen Morgen bis zum lebensmüden Abend, er watete darin herum. Plötzlich erlebte er diesen Zustand nun wieder, aber diesmal war es nicht gefährlich, denn Olaug entschärfte die Situation bei der ersten Gelegenheit.
»Jetzt hat Astrid, verdammt noch mal, auch den Löffel abgegeben. Wer kommt als Nächstes dran?«, sagte Olaug.
Ja, er mochte sie. Auch wenn sie fluchte. Eine alte Dame im Altersheim, die derartig fluchen konnte, fand er witzig.
»Noch gestern Abend saß sie hier, zum Teufel, beim Abendessen, und hat damit angegeben, was sie in den Vierzigerjahren für ein Ass in der Gymnastikgruppe war«, sagte Olaug. »Aber so ist das Leben.«
Das Leben? Nein, der Tod, dachte er, und dass jemand über Nacht starb, war an einem solchen Ort nicht ungewöhnlich, dazu waren sie ja hier. Er hatte keine persönlichen Beziehungen zu anderen hier geknüpft, und wenn er sie in Gedanken beim Vornamen nannte, dann nur, weil das Personal sie immer so ansprach.
Er hatte nicht einmal eine Ahnung, wer vom Personal ausgebildete Pflegekraft und wer nur Hilfspfleger war. Das war ihm egal, solange er die wenige Unterstützung bekam, die er eben brauchte. Krank war er nicht und hatte auch nicht vor, so bald zu sterben, dazu war der Alltag endlich viel zu gut, auch wenn er sich den Gedanken selten gestattete.
Er selbst war dem Tod zuletzt begegnet, als Tor seinem Leben im Schweinestall ein Ende gesetzt hatte, doch da hatte sich der Betriebshelfer Kai-Roger um den Toten gekümmert, zusammen mit Margido. Und das Mal davor: Da hatte er auf der Rückbank des alten Volvo gesessen, mit Annas Kopf auf dem Schoß. Er hatte dagesessen und das starre, verzerrte Gesicht angesehen, ihre Augen geschlossen, ihr Körper in Decken gewickelt, das Auto stank nach Exkrementen, und Tor, mit angespanntem Nacken vor ihm, beugte sich wütend über das Lenkrad, um in der tiefen Dezemberdunkelheit die Umrisse der unbeleuchteten Straße erkennen zu können.
Damals hatte er zum ersten und letzten Mal in dem Volvo gesessen. Und er war zum letzten Mal in der Stadt gewesen. Sie war noch am Leben, als er ihren Kopf auf sein Knie gelegt hatte, aber im Krankenhaus war sie dann gestorben, nicht lange danach. Er wusste, dass es vorbei war, hatte begriffen, dass er mit dem Tod auf der Rückbank saß. Nur Tor glaubte wohl, sie würde jeden Moment wieder gesund und munter.
Es war lange her, die Sache mit Anna und Tor, aber zugleich kam es ihm gar nicht lange vor, so lebendig war seine Erinnerung. Nun hatte Olaug ihn ein bisschen an Anna erinnert – nicht ihre Kopfhaut oder die Silberkugeln, Anna hatte immer ein Kopftuch getragen, und Silber in den Ohren hatte sie schon gar nicht gehabt, die bloße Vorstellung kam ihm albern vor –, es war ihr Mund, die Lippen, die Art, wie sie sich kräuselten und bewegten. Sicher hatte er deshalb, jetzt, da Astrid tot war, daran denken müssen, wie es gewesen war, an jenem grauenhaften Abend hinten in dem alten Volvo, damals, als nichts zu begreifen war, obwohl er sich auch daran erinnerte, wie er gedacht hatte, dass jetzt alles anders werden würde, vielleicht schlimmer, vielleicht besser, es spielte keine Rolle, Hauptsache anders. Und das war es ja auch geworden. Dank Torunn und den Dänen und überhaupt.
Er konnte Olaug klar und deutlich vor sich sehen, Kopfhaut und Ohrläppchen und alles. Es war ein Wunder, wie deutlich alles auf einmal wurde, seit er eine Brille trug. So viele Jahre hatte er mit einem Vergrößerungsglas über Zeitungen und Büchern gesessen, und wenn er den Blick hob, seine Umgebung verschwommen wahrgenommen.
Deshalb war es ihm ja auch schwergefallen, sich mit anderen Menschen zu beschäftigen. Das hatte sich erst hier geändert, seit er sie betrachtete, ihre Mienen registrierte, wie sie aussahen, wenn sie etwas sagten. Anfangs war das unheimlich und überwältigend gewesen, als ob er sich an ein Chaos gewöhnen müsste, das ihn von allen Seiten umgab. Dieses Chaos trug vermutlich dazu bei, dass er die Gewohnheit entwickelte – oder eine Unsitte, wie sicher manche sagen würden, Torunn und Margido bestimmt –, überwiegend in seinem Zimmer zu bleiben. Anfangs war alles einfach zu viel. Jetzt konnte er etwas besser damit umgehen, manchmal. Dann und wann. Aber wenn die Leute ihm zu nahe kamen, wich er den Gemeinschaftsräumen tagelang aus.
Er mochte auch nicht, wenn das Personal ihm zu Leibe rückte, seine Angelegenheiten gingen die anderen nichts an. Aber nur wenige Tage, nachdem Torunn auf dem Weg von Oslo nach Neshov vorbeigeschaut hatte, war es losgegangen.
»Tormod, wie schön, ich habe gehört, dass Ihre Enkelin wieder auf den Hof ziehen will?«
Eine der älteren Pflegerinnen machte den Anfang, Petra, sie kam von hier aus Byneset, war mit fast allen verwandt und wusste alles. Also hätte sie ihn eigentlich nicht anzusprechen brauchen. Doch er war erleichtert gewesen, als sie Torunn als seine »Enkelin« bezeichnet hatte, denn das bedeutete, dass sie doch nicht die ganze Wahrheit kannte. Er machte sich jedoch nicht die Mühe, ihr zu antworten.
»Haben Sie gehört, was ich gesagt habe? Ja, ich weiß doch genau, dass Ihren Ohren nichts fehlt. Und das Buch da haben Sie sicher schon ein paar Mal gelesen, so vertieft können Sie also gar nicht sein.«
»Doch.«
»Blödsinn. Nichts als den Krieg im Kopf. Ich habe nach Ihrer Enkelin gefragt, ob Sie sich über Ihre Rückkehr freuen. Auch wenn man eigentlich nicht von einem Zurück sprechen kann, schließlich ist sie nicht hier aufgewachsen.«
»Nein.«
»Aber freuen Sie sich nicht ungeheuer, Tormod? Der Hof war doch eigentlich schon verlassen.«
»Das schon.«
»Aber ist das nicht schön?«
Sie redete immer so viel, er hatte keine Lust, den Blick zu heben und ihr ins Gesicht zu blicken, denn dann würde er den Faden verlieren. Er war mitten in einem Kapitel darüber, wie die Russen nach der Kapitulation in Berlin einmarschiert waren, es war eines der neuen Bücher, die Torunn gekauft hatte, geschrieben von einer Frau, die damals dort gelebt hatte, und es war ganz anders als alle anderen Kriegsbücher, die er bisher gelesen hatte. Er hoffte wirklich, dass Torunn es selbst nicht gelesen hatte und es auch nicht lesen wollte, denn dann würde er mit ihr darüber sprechen müssen, und wie sollte er es denn schaffen, mit ihr über Vergewaltigungen zu sprechen? Wenn er mit dem Buch fertig wäre, würde er es ganz hinten ins Regal stellen und es extratief hineinschieben, und sie hatte sicher sowieso genug zu tun und kaum Zeit zum Lesen, hoffte er.
»Freuen Sie sich?«
»Das schon.«
»Sie sehen aber nicht besonders glücklich aus. Sie sollten froh sein. Es ist doch auch eine Ehre für Sie, dass die nächste Generation weitermachen will«, hatte Petra gesagt und war aus seinem Zimmer verschwunden.
»Danke für den Kaffee«, hatte er erwidert, ein wenig zu spät.
Sie hatte das Zuckerstück vergessen. Und das nicht zum ersten Mal. Vor Torunns nächstem Besuch hatte er sie deshalb gebeten, ihm eine ganze Schachtel Würfelzucker mitzubringen, obwohl er das nicht gern tat, da sie und Margido ohnehin so lieb waren, alles einzukaufen, was er sich wünschte, und jetzt wurde die Liste noch länger. Aber Torunn hatte dann eine Schachtel mit braunen und ein bisschen klumpigen Zuckerstücken mitgebracht. Solche hatte er noch nie gesehen, und sie waren nicht so süß wie die blendend weißen mit den messerscharfen Kanten und Ecken. Doch so komisch die braunen auch waren, es kam vor, dass er zwei oder gar drei in seinen Kaffee tat, wenn keine Schokolade in Sicht war, keine Mokkabohne und kein Cremehütchen, das er so liebte. Es tat so gut, beim Lesen eine Praline zu lutschen, auch wenn er danach immer Scherereien mit seinem Gebiss hatte.
»Schnell abzutreten ist ja wohl nicht das Schlechteste, zum Henker«, sagte Olaug. »Wenn man sich das mal überlegt. Astrid hat Glück gehabt. Für uns andere ist das schlimmer, wir haben ja keine Scheißahnung davon, wann Schluss ist, unerwartet ist wirklich nicht das Schlechteste.«
»Nein, vielleicht nicht«, sagte eine Pflegerin und stellte eine Schüssel mit hart gekochten Eiern auf den Frühstückstisch. Die Eier zerteilt, blassgelbe Hälften mit einem bläulichen Rand um den Dotter.
Nie standen weich gekochte ganze Eier in einem Eierbecher auf dem Tisch, das gäbe nur Geklecker und Mehrarbeit, hatte er eine der älteren Pflegerinnen leise zu einer neuen sagen hören. Er aß lieber weich gekochte Eier und bekam sogar ab und zu eins, wenn er allein auf seinem Zimmer frühstückte. Dann freute er sich, und er gab sich alle Mühe, nicht zu kleckern, er hielt den Eierbecher dicht unter sein Kinn, ehe er den Löffel in den guten flüssigen, lauwarmen Dotter tunkte. Aber natürlich ging es zwischendurch schief. Es schmeckte doch so gut, so gut, dass er zu gierig und eifrig wurde.
»Ein massiver Schlaganfall, vermutlich«, sagte Olaug.
»Sicher«, sagte einer der anderen Mitbewohner, er hatte nicht herausgehört, wer.
In Gedanken nannte er sie alle Mitbewohner, nicht Bewohner. Aber er hatte auch gehört, dass das Personal unter sich von »Verbrauchern« sprach. Das war scheußlich, als ob sie alles nur verbrauchten, Essen und Zimmer und Strom und Handtücher und Waschmittel. Aber es war jedenfalls witzig, ein ganzes Leben allein gewesen zu sein, der eigenen Familie preisgegeben und deren Alltag, um dann plötzlich mit anderen Menschen zusammengesteckt zu werden, mit denen er nur das Alter gemein hatte, ein Schlafzimmer neben dem anderen, in Reih und Glied auf einem Korridor, jede Menge alter Leute, genau wie Kinder. Sie hatten keinen Dachboden und keinen Keller mehr, weder Küche noch Abstellkammer oder Garage, weder Schuppen noch Holzhütte noch Scheune, das alles war den »Angehörigen« in den Schoß gefallen.
Es gab keinen Herd, der mit Holzscheiten gefüttert werden musste, keinen Hofplatz, auf dem Schnee geräumt werden musste, und was die Frauen anging: Es gab keine Beeren einzukochen, keine Kleider zu waschen, keinen Fußboden zu putzen, kein Brot zu backen, keine Weihnachtsmahlzeit vorzubereiten, keine Tischdecken zu bügeln. Er nahm an, dass die Frauen deshalb die Sache mit den Geschenken so wichtig nahmen, denn das war das Einzige, wofür sie noch die Verantwortung trugen. Sie sprachen oft und gern darüber, hörte er, und dann ging es darum, schöne Karten und Umschläge zu kaufen, zu einer Bank gebracht zu werden, um Bargeld abzuheben. Sie waren total verzweifelt, wenn ihre Gesundheit sie gerade dann daran hinderte, dies zu erledigen, wenn in der nächsten Verwandtschaft ein Geburtstag bevorstand. Deshalb hoben die Damen eine große Summe ab, wenn sie schon mal bei der Bank waren, alles, was von der Rente übrig blieb, wenn das Heim seinen Anteil abgezogen hatte. Und das war das Einzige, was sie davor bewahrte, hier im Heim wieder zum Kind zu werden, dachte er. Achtzig Prozent der Rente flossen an das Heim, aber ihm machte das nichts aus, früher waren hundert Prozent an Anna und Tor geflossen. Er selbst war kein einziges Mal in einer Bank gewesen, in seinem ganzen Leben nicht, auch nicht, seit er hierhergezogen war. Vielleicht sollte er mit Margido darüber sprechen, er musste doch einige Kronen auf dem Konto haben, die Torunn bekommen könnte.
Kinderheim, Altersheim, das war doch fast dasselbe.
Er hatte keinen Fuß in ein anderes Zimmer hier gesetzt, aber er konnte ja hineinsehen, wenn eine Tür offen stand; alle wirkten wie winzige zusammengepresste Wohnzimmer, mit schönen Teppichen und Kommoden und Tischdecken und Kerzenleuchtern und Bildern an der Wand, und einem riesigen Bett, das den Eindruck vom Wohnzimmer ruinierte. In seinem eigenen Zimmer standen nur ein Bett, ein Tisch und sein Lehnstuhl.
Im Gegensatz zu den anderen hatte er keinen eigenen Fernseher. Und in den Fernsehraum ging er nur sehr selten. Fernsehen erinnerte ihn an Neshov, die trostlosen Abende, an denen der Fernseher ihn in den befreienden Schlaf gelullt hatte, wenn seine Augen zum Lesen zu müde gewesen waren. Als er hergezogen war und eine Brille bekommen hatte, war das wie eine Entziehungskur gewesen, danach ekelte das Fernsehen ihn fast an. Wenn er sich mal vor eine Sendung setzte, die ihn interessierte, kam es vor, dass er sich sofort im Wohnzimmer auf Neshov wähnte. Die Wände, die Fensterbänke, der Flickenteppich auf dem Boden vor dem Fernsehapparat, der muffige Geruch in der Küche, Anna, die beim Abwasch mit den Kochtöpfen klirrte.
Nein, dann lieber Radio, er hatte ein winzig kleines Radio, auf dem er ab und zu Nachrichten hörte, aber die betrafen ihn eigentlich kaum, da es vor allem um aktuelle Kriege ging, über die er sich einfach keinen Überblick verschaffen konnte. Vielleicht erschien er den anderen Bewohnern als Sonderling. Vielleicht hielten sie ihn nicht für ihresgleichen, weil er es vorzog, so viel für sich zu sein.
Aber die größte Diskrepanz – wenn man von den Bewohnern und den Angehörigen absah, die zu Besuch kamen –, bestand zwischen denen, die hier wohnten, und denen, die hier arbeiteten. Nur ganz selten war davon kaum etwas zu bemerken, etwa, wenn viel gelacht wurde oder jemand etwas Witziges sagte, dann war es fast ein bisschen unheimlich, als ob sie alle einfache Mitbewohner wären, oder eine Familie, und sich alle schrecklich lieb hätten.
Aber Gott sei Dank zeigten sich die Angestellten gleich darauf wieder so, wie sie wirklich waren, wenn sie losrannten, um einen Teppich geradezurücken oder ein Wasserglas weiter zur Tischmitte hin zu schieben. Und er sah ja die Autos draußen auf dem Parkplatz, wusste, dass diese Autos die Angestellten zu ihren eigenen Familien brachten, hier waren sie im Dienst, das war alles.
Dennoch verhielten sie sich ein wenig wie Eltern – wenn auch nicht so wie seine eigenen Eltern –, und so, wie hier mit ihnen umgegangen wurde, war es wohl kein Wunder, dass viele Bewohner beim Essen über ihre Kindheit sprachen. Für ihn war es nicht so wichtig, dass auf Sauberkeit und Ordnung geachtet wurde. Er konnte hier sitzen und Olaugs schüttere Haare ansehen und wusste dabei genau, dass seine eigenen frisch gekämmt waren – er hatte den Kamm unter den Wasserhahn gehalten – und dass sein Gebiss geputzt war. Unterhose und Socken waren sauber, er zog alle zwei Tage frische an, nach dem Duschen, häufiger war es nicht nötig, da er niemals schwitzte und sich unten herum sorgfältig abwischte.
Und auch das mit dem Duschen schaffte er sehr gut allein. Es war doch ein unbeschreiblicher Luxus, einfach vor einen Wasserhahn an der Wand treten und die Handbrause aufdrehen zu können. Auf Neshov hatte er sich tagelang davor gegraut, ab und zu noch viel länger, ehe er sich zum Duschen aufraffte. Zuerst musste er über den Rand der hellblauen Badewanne steigen, und dann auf dem glatten Emailleboden das Gleichgewicht finden. Er hatte gelernt, niemals die Füße zu bewegen, während er das Wasser über sich spritzen ließ, sodass er trockenen Boden unter sich behielt und nicht ausrutschte, aber wenn er dann aus der Wanne klettern wollte, musste er ja die Füße heben, und dann floss das Wasser unter seine Fußsohlen, und er hatte immer schreckliche Angst davor gehabt, zu fallen. Deshalb führte er alle Bewegungen unendlich langsam aus, während er sich mit beiden Händen am Rand der Badewanne festhielt. Manchmal hatte er so lange gebraucht, dass er bereits trocken war, wenn er sich auf dem Badezimmerboden in Sicherheit gebracht hatte und zum Handtuch greifen wollte.
So war es jetzt nicht mehr, jetzt war das Duschen zu einer angstfreien Routine geworden. Er hatte alles unter Kontrolle, war nicht krank, aber die ganze Situation war seltsam. Sehr seltsam. Aber sie brachte Sicherheit, alles war unendlich sicher und gut.
Das Einzige, was er und die anderen Mitbewohner noch zu erledigen hatten, war doch zu sterben, so, wie Astrid soeben. Sie waren hier, um zu sterben, und das war gut so. Absolut in Ordnung, eigentlich.
Sterben mussten ja alle zu irgendeinem Zeitpunkt. Von dem Moment an, in dem das Leben einsetzte, wanderten alle dem Tod entgegen. Er wusste gar nicht mehr, wie oft er sich früher im Leben gewünscht hatte zu sterben, deshalb ließ er sich die Stimmung nicht verderben, obwohl ihm klar war, dass er die Endhaltestelle nun erreicht hatte.
Tormod nahm sich ein halbes hart gekochtes Ei und legte es mit dem Gesicht nach unten auf eine Scheibe Brot mit guter Butter, danach spritzte er einen Strich orangen Kaviars über den weißen Eibauch. Ein Arm bewegte sich über seine Schulter und füllte seine Kaffeetasse wieder auf.
»Sie wollen doch bestimmt mehr, wo Sie so eine Kaffeetante sind«, sagte die Pflegerin, der der Arm gehörte, es war Hannelore mit dem Zäpfchen-R und dem deutschen Akzent, verheiratet mit einem Hippie aus Spongdal, wie sie immer sagte, ohne dass er mehr über den Mann oder darüber gewusst hätte, wie Hannelore hier auf Byneset gelandet war. Sie hatte gerade erst angefangen, er hatte gehört, dass sie früher als Deutschlehrerin an der Kathedralschule in Trondheim gearbeitet hatte. Abgesehen von ihrem Akzent war ihr Norwegisch perfekt. Bei einigen von den Aushilfen sah es schlechter aus, sie waren zwar nett, aber unmöglich zu verstehen, wenn sie wie stumme Kreaturen umherliefen und kaum miteinander sprechen konnten, da sie aus ganz verschiedenen Ländern stammten.
»Danke.«
»Heute haben Sie mit uns anderen zusammen gefrühstückt und zu Abend gegessen, Tormod, das ist ja ein Rekord.«
Darauf gab er keine Antwort. Wusste nicht, was er darauf entgegnen sollte. Aber es gefiel ihm, wie sie seinen Namen aussprach, mit langem O und dem deutschen R. Tooormod …
Wenn er allein auf seinem Zimmer aß, konnte er dabei lesen. Außerdem brauchte er sich nicht darum zu sorgen, dass sein Gebiss oft nicht richtig traf und ein Klickgeräusch machte, das die anderen lieber nicht bemerken sollten, ein Geräusch, das ihm selbst nie aufgefallen war, das er aber registrierte, seit er hier im Altersheim wohnte.
Ihm waren die Blicke aufgefallen, als er das erste Mal nachmittags bei Kaffee und Kuchen im Speiseraum saß. Die anderen Bewohner glaubten vermutlich, dass er Schweinerippen mit knuspriger Schwarte kaute. Sicher hatten Tor und Anna mit ihm wegen dieser Gebissgeräusche geschimpft, er erinnerte sich nicht mehr genau, die beiden hatten so vieles an ihm auszusetzen.
Am Vortag war er mit einer Biografie über Joseph Goebbels fertiggeworden, und nun wollte er vor dem Schlafengehen mit dem Buch über General Falkenhorst anfangen. Er las gern Bücher, gerne mehrmals, dann wusste er, was ihn erwartete, er konnte ganz ruhig bleiben, ohne Angst, plötzlich auf etwas bisher Unbekanntes zu stoßen, etwas, das ihn an seine eigene Geschichte denken ließ.
Wenn er die neuen Kriegsbücher las, die er von Torunn bekommen hatte, war er immer ein wenig angespannt. Er legte sich dann nicht die Decke über die Knie, sondern stand gewissermaßen in Habachtstellung, lehnte nicht einmal den Hinterkopf an die Sessellehne, denn davon wurde sein Nacken steif. Dennoch war er unendlich dankbar dafür, dass sie diese Bücher für ihn gekauft hatte, dass sie wirklich sein Bücherregal mit den Buchrücken fotografiert hatte, um zu wissen, welche Bücher ihm noch fehlten!
Torunn war lieb. Sie war so lieb. Das Buch über Falkenhorst hatte er mehrmals gelesen, er freute sich schon sehr darauf, sich ein weiteres Mal darüber herzumachen, deshalb war er zu den anderen gegangen, zum Abendessen, ehe er loslegte. Von Goebbels zu Falkenhorst. Das war ein großer Sprung. Von Deutschland nach Norwegen gewissermaßen.
Aber als er am Vorabend mit mühsamen Schritten sein Zimmer verlassen hatte, war Goebbels noch so präsent, dessen verkrüppelter Fuß, dass es sich fast so angefühlt hatte, als hätte er selbst einen, ginge mit diesem Klumpfuß, müsste einen speziell konstruierten Schuh mit hoher Extrasohle tragen und diesen Schuh unter einem besonders langen Hosenbein verdecken. Beinahe ertappte er sich beim Hinken.
Gestern hatte auch Astrid dort gesessen, zuverlässig und lebendig, und über die Gymnastikgruppe gesprochen. Sie war fast fünfundneunzig Jahre alt geworden, wie er gehört hatte. Er hatte nie auch nur ein Wort mit ihr gewechselt, das ergab sich einfach nicht. Sie war offenbar Frisörin gewesen, außerdem hatte sie viele Jahre im Büro gearbeitet, was immer das bedeuten mochte, und sie war während des Krieges als Fahrradkurier für die Widerstandsbewegung unterwegs gewesen und hatte wichtige Sachen transportiert, was sie in große Gefahr gebracht hätte, wäre sie entdeckt worden. So viel wusste er, und er hatte registriert, dass sie nicht besonders hübsch war, aber eine angenehme Stimme hatte, nicht schrill und laut, wie viele andere hier. Vermutlich hatte sie noch gut gehört, damit hing es ja oft zusammen, wie laut man beim Sprechen wurde.
»Sie bekam nicht oft Besuch«, sagte Olaug.
»Die wohnen ja so weit weg«, fiel Elise ein.
»Aber jetzt müssen sie kommen«, sagte Gjertrud, seine Zimmernachbarin, die immer strickte. Ihre Tochter brachte ihr jedes Mal eine große Tüte voll Wolle mit, wenn sie zu Besuch kam.
»Sicher wird dein Bruder jetzt die ganze Kiste schaukeln, Tormod«, sagte Olaug.
Margido kümmerte sich oft um die Toten hier auf Byneset, den Angehörigen gefiel, dass er einen Bezug zum Heim hatte. Außerdem hatten viele bereits Beerdigungen besucht, die Margido ausgerichtet hatte, und das beruhigte sie. Margido erzählte davon, und Tormod glaubte es gern, Margido gab nicht an, dazu war er nicht der Typ. Natürlich beauftragten alle gern ein Bestattungsunternehmen, das sie kannten, das war doch klug und vernünftig. Astrids Angehörige wussten zwar nicht, wer Margido war, aber Tormod war doch sicher, dass die Pflegekräfte ihn zumindest empfehlen würden.
Er schluckte runter.
»Oder deine Enkelin«, sagte Olaug. »Wie heißt sie doch noch gleich? Scheiße, jetzt werd ich wohl vergesslich!«
»Torunn«, klärte Petra vom Spülbecken her auf, wo sie gerade leere Milchflaschen ausspülte. »Aber sie kann das nicht allein machen, sie hat ja gerade erst angefangen.«
Nun war die Antwort überflüssig, denn Petra hatte genau das gesagt, was er selbst gedacht hatte.
»Ja, ja, bin ja mal gespannt, wer jetzt in ihr Zimmer zieht«, sagte Olaug.
Denn jetzt war Platz für jemand Neues.
Er kannte die Abläufe. Ab und zu kam die Familie her, um sofort nach den Verstorbenen zu sehen, aber nicht immer, das entschieden alle selbst. Manche warteten auch, bis die Leiche fortgebracht worden war.
Danach mussten die Angehörigen das Zimmer ausräumen, oder das von anderen erledigen lassen, wenn sie zu weit wegwohnten, denn die Räume mussten gründlich gereinigt werden und im Handumdrehen für den Neuzugang bereitstehen.
Es wäre schön, wenn Astrids Familie sich Zeit ließe, um herzukommen und die Verstorbene zu betrachten; doch ihm war klar, dass man sie nicht viele Stunden in ihrem Zimmer liegen lassen konnte, sie musste in einen Kühlraum. Und dann könnte sie bald geholt werden, und vielleicht würden Margido oder Torunn kommen und für ihn einkaufen, er brauchte Nachschub an Limonade und Mentholpastillen.
»Hoffentlich jemand, der genauso gern Kreuzworträtsel löst wie Astrid«, sagte Olaug. »Es ist stinklangweilig allein. Und ihr seid ja verdammt noch mal überhaupt keine Hilfe.«
Olaug hatte fast ihr ganzes Leben auf See gearbeitet, das war vermutlich der Grund, weshalb sie so redete. Er steckte sich ein kreideweißes Stück Zucker in den Mund und musste vor lauter Genuss die Augen schließen, als er dann einen Schluck Kaffee folgen ließ, der den Zucker unter seinem Gaumen langsam auflöste. Er dachte an die Schachtel mit den braunen Klumpen, die er in seinem Zimmer aufbewahrte.
Doch, er würde mit Margido über das Geld auf der Bank sprechen. Fragen, ob Margido Geld für ihn abheben könnte. Dann könnte er alles bezahlen, was sie für ihn kauften, und ganz deutlich sagen, dass er weißen Zucker wolle und keinen braunen.
Es war schön, aber ungewohnt, in einer zusätzlichen Funktion herzukommen, einer beruflichen. Sie war stolz auf die Arbeit, gleichzeitig war sie die fürsorgliche Enkelin oder die Nichte, je nachdem. Aber sie hatte längst beschlossen, Tormod als Großvater zu betrachten, auch wenn er eigentlich ihr Onkel war.
Am Vortag hatte sie fünf Flaschen Solo-Limonade und die Zeitschrift Vi Menn mit einer F-35 auf dem Titelblatt gekauft, dazu noch anderen Kleinkram, da sie ihn ja bald besuchen wollte. Sie durfte nicht vergessen, die Verschlüsse der Flaschen aufzudrehen und wieder zu schließen, er war nicht mehr stark genug für diesen ersten harten Ruck, und er hatte es sich in den Kopf gesetzt, das Pflegepersonal nicht unnötig beanspruchen zu wollen. Er wollte die Angestellten auch nicht für sich einkaufen lassen, was viele der Bewohner taten. Sie fand es eigentlich ein bisschen komisch, aber auch rührend, dass er nur mithilfe der Familie zurechtkommen wollte, wo er doch bisher kaum eine Familie gehabt hatte, auf die er sich hätte stützen können.
Sie hatte sich mit Margido im Pflegeheim verabredet, er wollte von zu Hause kommen, sie dagegen von Neshov, mit einem billigen Sarg aus Furnier, da die Verstorbene ohne Trauerfeier eingeäschert werden sollte. Aber Leichenhemd und Gesichtstuch gehörten dennoch dazu.
Sie setzte mit dem Auto bis zum Kellereingang zurück, sie war schon zweimal hier gewesen, um Verstorbene zu holen. Der Wagen hatte eine Rückfahrkamera und war leicht zu lenken, auch als Privatwagen, sie sauste jeden Tag damit nach Herzenslust durch die Gegend. Hinunter zum Strand von Gaulosen, wenn Anna Auslauf brauchte, und in die Stadt, um Farbe und Baumaterial zu kaufen. Peder Bovim, der bald aus der Firma ausscheiden würde, hatte wirklich das perfekte Auto für sie gefunden und es optimal anpassen lassen. Es war auch nicht besonders teuer gewesen, ein drei Jahre alter Ford Transit, als Lieferwagen zugelassen und mit Schienen, die auf der Ladefläche angebracht waren. Margido war davon so begeistert, dass Bovim das gleiche Modell noch mal besorgte und dann noch mit allen Extras ausstattete, die er bei Einsätzen nach einem Selbstmord oder einem Unfall benötigte, bei dem das Opfer auf der Stelle für tot erklärt wurde – etwa bei Autounfällen, Stürzen oder Bränden.
Torunn konnte einen gängigen Sarg aus dem Lager in der Scheune von Neshov alleine über die Laderampe und durch die Hecköffnung ins Auto schieben. Bei schwereren, solideren Sargmodellen dagegen waren zwei Personen vonnöten. Ebenso, wenn mehr als nur ein Sarg transportiert werden sollte, dazu konnte eine Art wattierte Zwischenplatte angebracht werden. Mit dem Transit wurden lediglich leere Särge befördert, deren Inneres nicht einsehbar war. Wurden dagegen Verstorbene transportiert, konnten die Särge natürlich nicht gestapelt werden, das war würdelos und ethisch nicht vertretbar, das hatte sie gelernt. Abgesehen davon war es unmöglich, den oberen Sarg ausreichend zu befestigen. Als Leichenwagen benutzten sie daher Margidos alten Chevrolet Caprice, der immer sauber und frisch gewienert und pietätvoll aussah.
Peder hatte die Gleitschienen anbringen, den Beifahrersitz entfernen und den Airbag ausbauen lassen und einen großen Hundekäfig besorgt, in dem Anna auf einer alten Steppdecke wie eine Prinzessin liegen konnte. Die Decke war zufälligerweise nicht in dem Entrümpelungscontainer gelandet, der auf dem Hofplatz stand. Torunn hatte sie in einem der zahllosen Schlafzimmerschränke gefunden und sofort beschlossen, dass Anna sie bekommen sollte, als Ersatz für den haarigen, verdreckten Thermo-Schneeanzug, den der Hund gleich nach ihrem Einzug auf dem Hof als Liegeunterlage annektiert hatte.
»Wir fahren einsitzig, Anna«, sagte sie immer, wenn sie am späten Nachmittag nach Gaulosen hinunterfuhren. In diesem Winter hatte sie Anna ohne Leine am Strand herumlaufen lassen können, aber jetzt war der Campingplatz voll belegt mit Leuten, die einen Husky nicht von einem Wolf unterscheiden konnten. Deshalb ging oder lief Anna an einer an einem Laufgürtel befestigten Leine.
Astrid Isakstuen, fünfundneunzig Jahre alt, nachts im eigenen Bett gestorben, offenbar an einem Gehirnschlag, laut Margido, der diese Aufgabe mit Leichtigkeit selbst hätte übernehmen können. Das Heim war so modern ausgestattet, dass die Verstorbenen diskret aus ihrem Zimmer geschoben und mit dem Fahrstuhl zu einem Kühlraum im Keller transportiert werden konnten, um im Anschluss in den Sarg gelegt und weiter zum Transit gebracht zu werden. Das war Luxus. Keines der älteren Pflegeheime und nur wenige der neueren besaßen einen eigenen Kühlraum. Margido hatte von ärgerlichen Zwischenfällen an warmen Sommertagen erzählt, wo die Angehörigen sich von einer übel riechenden Leiche verabschieden mussten, die danach in aller Eile fortgebracht wurde. Aber hier war es nicht so, hier verlief alles in den richtigen Bahnen, und das im wahrsten Sinne des Wortes. Trotzdem hatte sie noch zu lernen, wie die beiden anderen Neuen in der Firma. Ganz praktisch also, dass sie direkt neben dem Sarglager wohnte. Der Sarg sollte im Anschluss zum Krematorium in Moholt gebracht werden, sie hatte das selbst angeboten, da Margido müde wirkte, er hatte lange mit einer Frühjahrserkältung zu kämpfen, die einfach nicht vergehen wollte.
Sie zog den Zündschlüssel heraus und stieg aus dem Wagen, steckte sich eine Zigarette an und blickte zum Parkplatz hinüber. Margido war noch nicht da, sie waren für fünf Uhr verabredet. Ihr fiel die Tüte für den Großvater ein, und sie öffnete die Autotür ein weiteres Mal. Es war warm, einer der letzten Tage im Mai, das Pfingstwochenende stand bevor – es lag spät in diesem Jahr. Sie sah auf die Uhr, bald fünf.
Ein Abschied der Angehörigen am offenen Sarg war nicht geplant, die Familie hatte die bereits vom Personal zurechtgemachte Astrid Isakstuen schon am Morgen hier im Pflegeheim gesehen. Darüber war sie erleichtert. Sie hatte keine Vorstellung gehabt, wie viel Abendarbeit dieser Beruf mit sich brachte. Alles musste für die Angehörigen und ihre unterschiedlichen Bedürfnisse vorbereitet werden, die oft aus allen Landesteilen angereist kamen.
Margido hatte die Todesanzeige bereits aufgegeben, nachdem der Sohn den Text am Vormittag per E-Mail geschickt hatte. Der Sohn schrieb, das Pflegeheim habe ihm empfohlen, sich an das Bestattungsunternehmen Neshov zu wenden. Er hatte zudem bestätigt, dass die Tote eingeäschert werden sollte. Margido wollte diese Mitteilung mitbringen, sie sollte sie im Krematorium vorlegen, schließlich musste vor jeder einzelnen Einäscherung bei der Polizei die Erlaubnis beantragt werden.
»Der Text für die Anzeige existierte sicher schon vorher«, hatte Margido vermutet. »Praktisch, wenn die Angehörigen vorbereitet sind.«
Die Anzeige sollte in Adresseavisen und einer Zeitung namens Telen erscheinen, und ganz unten stand, die Beisetzung habe bereits stattgefunden. Das stimmte zwar eigentlich nicht, aber die Familie wollte Astrid Isakstuen so schnell wie möglich einäschern lassen, um danach die Urne nach Notodden zu überführen, wo die Familie lebte. Dort würden sie sich um den Rest kümmern, um eine private Trauerfeier und die Urnenbestattung.
Torunn fragte sich, wie diese Astrid Isakstuen so weit entfernt von ihrer restlichen Verwandtschaft hatte landen können, oder vielleicht auch, warum die restliche Verwandtschaft so weit weg lebte. Obwohl Torunn noch ein Neuling in der Branche war, hatte sie viel darüber nachgedacht, warum sie so wenig über die alten Menschen wusste, über ihr Leben, das auf verschlungenen Pfaden bis zu jenem Augenblick geführt hatte, in dem sie und Margido den betreffenden Menschen in den Sarg hoben und auf die weiße Seidenunterlage und das kleine weiße Kopfkissen betteten. So viele Geschichten, die niemand mehr erfahren würde, auch die Hinterbliebenen nicht, so viel Ungesagtes, alles, wonach niemand gefragt hatte, was niemals erzählt worden war, Geheimnisse, die bewahrt wurden, bewusst oder unbewusst.
Keiner antwortete, als sie beim Großvater an die Tür klopfte. Sie wartete einige Sekunden, dann öffnete sie leise.
Der Großvater saß im Sessel und schlief mit offenem Mund und nach hinten gelehntem Kopf – es sah ihm gar nicht ähnlich, tagsüber zu schlafen, die Brille war von der Nase gerutscht und lag auf dem aufgeschlagenen Buch auf seinen Knien. Die Luft im Zimmer war stickig und warm; sie lief zum Fenster und öffnete es vorsichtig, da erwachte er, im ersten Moment ein wenig verwirrt, aber er lächelte, als er sie sah, auf eine greisenhafte und zittrige Weise, machte sich an der Brille zu schaffen und leckte sich mit einer bleichen Zungenspitze langsam die Lippen.
»War so müde nach dem Essen«, sagte er und räusperte sich so zaghaft, als hätte er dazu nicht genug Kraft. Er bewegte sich zu wenig.
»Aber das Essen ist doch schon etwas her. Esst ihr nicht um drei?«
»Das schon, aber … bist du wegen …«
»Ja, Astrid Isakstuen. Margido kommt auch gleich. Hast du sie gekannt?
»Nein.«
»Hier ist es ja irrsinnig heiß, da könnte man ja fast im Stehen einschlafen. Ich hab dir kalte Solo mitgebracht, frisch aus meinem Kühlschrank zu Hause, möchtest du gleich einen Schluck?«, fragte sie und riss das Fenster weit auf.
»Ach ja. Tausend Dank, Torunn. Hier steht ein Glas auf dem Tisch.«
»Kann ich vielleicht auch die Tür aufmachen?«
»Nein. Dann gibt es Durchzug.«
»Was habt ihr denn zu essen bekommen?«, fragte sie und goss Solo-Limonade in das kleine Glas, große Gläser gab es hier im Heim nicht, da die alten Leute so wenig tranken, viel zu wenig, das wusste sie. Aber jetzt leerte er das Glas auf einen Zug.
»Frikadellen. Und Bratkartoffeln. Das war lecker.«
»Schön. Noch einen Schluck?«
»Ja, danke.«
»Hast du mit den anderen gegessen – dein Teller steht ja gar nicht hier?«
»Nein, den haben sie schon geholt.«
»Ach so. Petra hat mir vorhin erzählt, dass du gestern mit den anderen zusammen gegessen hast, Frühstück und Abendbrot. Und da dachte ich, dass du vielleicht deine Gewohnheiten geändert hast.«
»Was?«
Seine Stimme klang jetzt so hellwach und scharf, dass sie zusammenfuhr und ihn ansehen musste.
»Aber war das denn nicht gut? Mit den anderen zusammen zu essen?«
»Sie hat Schweigepflicht. Diese …«
»Petra.«
»Ja. Die«, sagte er.
»Sie hat keine Schweigepflicht bei Dingen, die nur nett gemeint und überhaupt nicht von Bedeutung sind. Das ist doch etwas sehr Positives. Ich habe mich darüber gefreut.«
»Das hört sich an, als ob ich ein Kind wäre.«
Die Augen hinter den Brillengläsern waren eisblau und wirkten größer, die schütteren Haare im Nacken standen nach dem Mittagsschlaf ab wie kleine Stacheln.
»Entschuldige«, sagte sie und musste sich abwenden. »Entschuldige. Ich verstehe schon, was du meinst, es muss tatsächlich etwas sonderbar klingen.«
Er räusperte sich wieder, mit etwas stärkerer und wacherer Kraft als beim ersten Mal.
»Hast du den Hund dabei?«, fragte er nach einer Weile.
»Nein, ich muss ja nachher zum Krematorium fahren. Kommt mir irgendwie komisch vor, einen Hund dorthin mitzunehmen. Keine Ahnung, warum. Das ist kein Routinejob.«
»Ist es doch«, sagte er, um ihr Mut zu machen.
»Ja, schon, irgendwie schon. Aber es darf trotzdem nie zur Routine werden. Auch wenn immer jemand stirbt. Jetzt geht es um die Tote, nur um sie. Ich laufe dann später mit Anna eine Runde, es ist ja sehr gutes Wetter.«
Sie öffnete die anderen Flaschen und drehte die Verschlüsse wieder zu, reihte sie auf dem Tisch auf, an der Wand, setzte sich dann auf sein Bett und schob die Hände unter die Oberschenkel. Als sie sich auf die Matratze fallen ließ und Luft aus den Decken entwich, nahm sie seinen Geruch wahr. Nicht der Geruch von Seife und Kopfhaut, der ihm bei einer Umarmung entströmte, sondern der Geruch der Nacht. Sie konnte seine Nächte riechen, einen strengen und von Angst durchsetzten Geruch; sie wusste nicht so ganz, warum sie so dachte, aber sie stellte sich vor, wie er sich in den langen Nächten von einer Seite auf die andere drehte, wie er allein in der Dunkelheit lag und vergessen, sich aber zugleich erinnern, sich um jeden Preis an das Allerwichtigste erinnern wollte.
»Du könntest hier drinnen einen kleinen Kühlschrank brauchen«, sagte sie.
»Das geht doch nicht. Ich kenne niemanden, der einen hat …«
»Die anderen haben einen Fernseher. Du nicht. Dann kannst du stattdessen einen kleinen Kühlschrank aufstellen.«
»Ja, ja. Wenn du … wenn das möglich ist, dann gern. Ich kann selbst bezahlen. Muss ohnehin mit Margido über Geld sprechen. Muss mir welches besorgen.«
Sie legte die Zeitschrift mit dem Kampfflugzeug auf den Tisch.
»Ich hab auch das hier gekauft. Und Mentholpastillen. Eine neue Sorte.«
»Neue Sorte …?«
»Menthol ist Menthol. Welches Buch liest du gerade?«
»Über General von Falkenhorst.«
»Ich bin nicht sicher, ob ich von dem überhaupt schon mal gehört habe«, sagte sie.
»Er hat den Angriff auf Dänemark und Norwegen geplant und durchgeführt. Das Unternehmen Weserübung.«
»Himmel.«
»Und er war bis ’44 Oberbefehlshaber der deutschen Truppen in Norwegen.«
»Oh Gott, ich weiß eigentlich so wenig. Gut, dass wir wenigstens einen in der Familie haben, der sich in der Kriegsgeschichte auskennt. Du bist doch ein wandelndes Kriegslexikon.«
Sie konnte sehen, wie er sich in seinem Sessel aufrichtete, als sie das sagte. In diesem Moment wurde an die Tür geklopft, und Margido kam herein, ohne auf Antwort zu warten.
»Ich wusste doch, dass ich euch hier finden würde«, sagte er lächelnd.
Sie war so erleichtert, ihn zu sehen, nur zu wissen, dass er hier war, er wusste einfach genau, wie die Dinge zu regeln waren. Ab und zu wurde ihr fast schwindlig bei dem Gedanken, dass der Tag kommen würde, an dem sie allein die Verantwortung für die Toten und Hinterbliebenen und den Papierkram und die gesamte Logistik rund um die Beisetzung zu tragen hätte. Es war eine so ernste Angelegenheit, alles musste so genau bedacht werden, und es war so unendlich wichtig, dass alles stimmte, da gab es absolut keinen Fingerbreit Raum für Abweichungen.
»Der Arzt war noch nicht hier«, sagte Margido zu Torunn. »Ich ärgere mich so, er hatte doch den ganzen Tag Zeit.«
Egal, wie offenkundig tot ein Mensch war, auch wenn sogar die Totenstarre bereits eingetreten war, immer musste ein Arzt das Herz abhorchen, um den Totenschein ausstellen zu dürfen.
In der Branche sorgte schon immer für Irritation, dass so viel Zeit mit Warten auf Arzt und Totenschein vergeudet wurde, bis die Arbeit mit den Verstorbenen weitergehen konnte.
»Ich habe das Personal gebeten, uns Bescheid zu sagen, er ist offenbar auf dem Weg hierher, wollte nur kurz nach einer anderen Bewohnerin sehen.«
»Dann machen wir es uns hier so lange gemütlich«, sagte sie. »Ich habe Tormod eben vorgeschlagen, einen kleinen Kühlschrank für sein Zimmer zu kaufen.«
»Keine dumme Idee«, erwiderte Margido. »Für Limo und Schokolade.«
»Ich brauche Geld. Geld von der Bank«, meldete sich der Großvater.
»Dann musst du für mich eine Vollmacht ausstellen«, sagte Margido.
»Vollmacht?«
»Ja, oder du musst selbst mitkommen. Du hast doch keinen Ausweis.«
»Hat er keinen Ausweis?«
»Nein«, antwortete Margido und setzte sich neben sie auf das Bett. »Er hat keinen Führerschein, und er hat keinen Pass, und er hat keine Bankkarte.«
»Hab einen Taufschein«, sagte der Großvater, »und diese rosa Karte, die mit der Post gekommen ist, als ich so … so eine Personenkennziffer bekommen habe.«
»1964«, sagte Margido. »Da war das, glaube ich.«
»Ja. Aber ich weiß nicht, wie ich so was ausstelle, so eine …«
»Vollmacht«, half Margido. »Die kann ich für dich aufsetzen, und dann bringe ich sie mit und du brauchst nur noch zu unterschreiben.«
Der Großvater lächelte und nickte mehrere Male.
»Aber ich finde trotzdem, du solltest einmal mitkommen. Ich weiß, Torunn und ich sagen das immer wieder, und ich weiß, wir gehen dir damit auf die Nerven …«
»Ja«, sagte der Großvater und sah auf seine Hände. Das Lächeln war verschwunden. Nicht ein einziges Mal, seit er vor vier Jahren hergezogen war, hatte er das Pflegeheim verlassen.
»Du verlierst dein Zimmer nicht«, sagte Margido. »Das wartet hier unverändert auf dich, bis du zurückkommst.«
Der Großvater antwortete nicht sofort. Torunn beobachtete ihn, sah, wie die Kiefer unter den hellen Bartstoppeln arbeiteten, er rasierte sich nur einmal pro Woche, die Haare wuchsen nicht mehr so schnell nach.
»So was geht schnell«, sagte der Großvater schließlich.
»Wie meinst du das?«, fragte Margido.
»Astrid. Die ihr holen sollt. Morgen kommt jemand Neues. Hab es schon oft gesehen. Die Leute tragen alles raus, und dann wird geputzt, und dann kommt jemand Neues.«
»Das passiert, wenn jemand stirbt«, sagte Margido. »Nach ein oder zwei Tagen muss das Zimmer wieder bezugsfertig sein, so ist die Regel, denk doch an alle, die ungeduldig warten.«
»Ja, so ist das«, sagte der Großvater.
Torunn versetzte Margido einen Stoß. Er sah sie nicht an, fuhr einfach fort: »Ja, ich sag es ganz offen, das geht schnell. Wenn jemand stirbt, ist das Zimmer im Handumdrehen leer, da hast du ganz recht. Der Sohn von Astrid Isakstuen zum Beispiel hat nur persönliche Papiere mitgenommen, einige Fotos und ihre Schmuckstücke, den Rest verstaut der Hausmeister im Keller. Der Sohn hat der Heilsarmee ein paar Kronen dafür gegeben, dass sie herkommen und Möbel und Lampen, den Fernseher, Bücher und Kleider abholen. Die lassen sich die Spenden sonst ja lieber bringen, aber ich habe das für ihn erledigt. Mit dir hat das alles allerdings gar nichts zu tun.«
»Doch«, sagte der Großvater.
»Nein!«, rief Margido.
»Du bist doch kerngesund«, erklärte Torunn. »Das wollte Margido damit sagen. Und natürlich rührt niemand dein Zimmer an, bis du zurückkommst. Wenn du mit uns einen kleinen Ausflug machst.«
»Nein«, sagte der Großvater.
»Wir meinen es doch nur gut«, sagte sie und merkte, dass sie jetzt zu zweit auf ihn einredeten.
»Absolut«, bekräftigte Margido.
»Gibt nur Ärger«, sagte der Großvater.
»Am Wochenende ist Pfingsten«, sagte sie. »Und meine Mutter und Margrete kommen aus Oslo zu Besuch.«
»Margrete …?«
»Sie war meine Nachbarin, so haben wir uns kennengelernt. Überleg doch mal, wie witzig es wäre, wenn du zum Kaffee kommen könntest! Margido kann dich abholen, und dann gibt es Kaffee und Waffeln. Margrete ist ausgebildete Krankenschwester, da wärst du in guten Händen.«
»Nicht nach Neshov«, sagte der Großvater.
»Du wirst es nicht wiedererkennen«, sagte Margido. »Du hast ja keine Ahnung, wie Torunn geackert hat und wie schön es jetzt ist.«
»Nein«, beharrte der Großvater.
»Na ja, ich bin noch nicht fertig damit, habe eigentlich erst angefangen«, sagte Torunn.
Es wurde an die Tür geklopft, und ein junger Pfleger steckte den Kopf herein.
»Der Arzt war jetzt hier«, sagte er und schloss die Tür wieder.
»Na gut. Ich kümmere mich um die Vollmacht«, sagte Margido. »Aber jetzt müssen wir wohl an die Arbeit, Torunn.«
Astrid Isakstuen war gewaschen und tamponiert. Bei plötzlichen Todesfällen mussten die Verstorbenen immer tamponiert werden. Wenn sie dagegen bereits längere Zeit im Sterben gelegen und kaum etwas gegessen oder getrunken hatten, war das nicht nötig, denn Darm und Blase waren ohnehin leer.
Sie legten Mundschutz, dünne Plastikschürzen und Einmalhandschuhe an, dann holten sie die Transportbahre und lösten das Klebeband, mit dem das saubere Laken, in das die Tote eingewickelt war, zusammengehalten wurde. Um ihr eines Handgelenk hing ein Pappschildchen an einem Bindfaden, darauf standen Name, Personenkennziffer und Todesdatum. Ein weiteres Schildchen war auf das Laken geklebt, ein drittes trug sie um den großen Zeh.
»Die sind gründlich hier«, sagte Margido und entfernte den fleischfarbenen Bügel, der ihr Kinn festgehalten und ihren Mund geschlossen hatte. Jetzt war der Mund durch die Totenstarre geschlossen. Die Haut war gelb und blank, die Augen waren eingesunken und die Lippen fast weiß, die Hände waren über dem Bauch gefaltet. Torunn und Margido würden sie als Letzte sehen. Sie zogen ihr das Leichenhemd über die Arme und hoch zum Hals.
Den Furniersarg hatten sie bereits neben die Bahre geschoben.
»Sie ist nicht schwer, das schaffen wir gemeinsam«, sagte Margido.
»Eins, zwei und DREI«, sagten sie im Chor und hoben den Leichnam in den Sarg. Sie steckten das Leichenhemd sorgfältig unter der Toten fest und kämmten die Haare, strichen die von der Kinnstütze hinterlassenen Hautfalten glatt und drückten ihr die Augen zu. Dann bedeckte Torunn Astrid Isakstuens Gesicht vorsichtig mit dem leuchtend weißen Leichentuch. Nachdem sie den Deckel festgeschraubt hatten, warfen sie Kinnstütze, Mundschutz, Schürzen und Handschuhe in den Behälter für Spezialabfall an der Wand.
Margido klebte den Zettel, auf dem groß und deutlich Namen, Personenkennziffer und Todesdatum standen, sorgfältig am Kopfende des Sargdeckels fest.
»Jetzt fahr vorsichtig«, sagte er, als sich der Sarg hinten im Transit befand und er ihr die nötigen Papiere übergeben hatte, die jetzt auf dem Hundekäfig lagen, der neben dem Fahrersitz als praktische Ablage fungierte. »Das Krematorium nimmt abends eigentlich niemanden mehr entgegen, aber Oddvar hat heute Dienst, er wohnt gleich nebenan und macht eine Ausnahme, er schuldet mir einen Gefallen.«
»Gut. Und du siehst zu, dass du nach Hause kommst, und trinkst einen heißen Johannisbeergrog«, sagte sie.
Sie stieg auf den Fahrersitz, ließ die Wagentür aber offen, legte die Hände auf den Schoß, seufzte und schaute durch die Windschutzscheibe.
»Es ist so schade, dass er nie mitkommen will«, sagte sie. »Er könnte doch … Er könnte doch zum Kaffee zu dir kommen, sehen, wie du wohnst. Und wir könnten …«
»Wir dürfen ihn nicht mehr so bedrängen«, beschwichtigte Margido. »Das bringt nichts.«
»Er schlief, als ich heute gekommen bin. Das tut er sonst nicht. Es war zwar verdammt heiß im Zimmer, aber trotzdem schläft er sonst nie tagsüber«, sagte sie.
»Das ist nicht verwunderlich. Er ist alt. Er hatte ein hartes Leben.«
»Ich weiß«, sagte sie.
»Sein Leben war viel härter, als du ahnst.«
»Ich habe durchaus eine Ahnung davon. Ich habe ja eine Weile mit ihm und Tor zusammengewohnt.«
»Aber nicht, als er noch unter Annas Fuchtel stand.«
»Nein«, sagte sie. »Gott sei Dank. Aber er liegt mir sehr am Herzen, und deshalb habe ich Angst, dass er einfach langsam eingeht.«
Sie wandte ihm das Gesicht zu, begegnete seinem Blick, fragte sich, ob er etwas über die Dinge wusste, die der Großvater ihr in jener Nacht vor fast vier Jahren erzählt hatte, als sie entschied, Neshov zu verlassen, während die Dänen und der ausgeflippte Architekt auf dem Hofplatz lautstark feierten. Sie konnte sich eigentlich nicht vorstellen, dass Margido etwas wusste, wann hätte der Großvater Margido davon erzählen sollen? Es schien ihr schlicht unmöglich, deshalb lächelte sie nur, ehe sie sich aus dem Auto beugte, um die Wagentür zu schließen.
»Ja. Du hast sicher recht«, sagte sie. »Jetzt erst mal ein kleiner Kühlschrank. Aber ich muss wohl los.«
»Es macht dir doch nichts, sie zu fahren?«
»Nein. Das ist kein Problem, Margido.«
»Du musst nur rückwärts vor den Schiebetüren halten und dann den Papierkram erledigen, den Rest erledigt Oddvar.«
Als sie eine Stunde später auf den Hofplatz von Neshov fuhr, stand Anna auf den Hinterbeinen, wedelte mit dem Schwanz und mit den Vorderpfoten in der Luft, während sich die Kette zwischen ihrem Halsband und dem Hofbaum stark spannte. Die Abendsonne stand tief und golden über dem Korsfjord im Westen und ließ die alte rote Scheune leuchten wie frisch gestrichen. Das Licht traf den Hund, ihren Welpen, der in den letzten Monaten enorm gewachsen war und dessen Körper versuchte, mit der Länge der Beine und den großen gespitzten Ohren Schritt zu halten.
»Meine Feinste«, rief Torunn und knallte mit der Autotür, genoss die Stille, die nur vom glücklichen Fiepen des Hundes unterbrochen wurde. Sie nahm an, dass Anna zusammengerollt im Schatten des Hofbaumes geschlafen hatte, bis sie den Transit hörte, wie er in die Ahornallee abbog. Anna erkannte auch Margidos Auto, sogar den Leichenwagen, der noch nicht so oft hier gewesen war.
Torunn lief zu Anna hinüber und kraulte ihr ausgiebig das Fell. Sie hatte für den Rest des Abends frei, und da spielte es keine Rolle, ob ihre Kleider von Hundehaaren übersät waren. Der Husky und die schwarze Berufskleidung gaben eine schlechte Kombination ab, lächerlich schlecht sogar. Sie hatte sich schwarze Kostüme gekauft, Rock und Blazer, so schlicht wie möglich und so wenig sie selbst, dass es schon fast absurd war, aber Dienst ist eben Dienst. In der Kirche und den Andachtsräumen war adäquate Kleidung gefragt, die keinerlei Aufmerksamkeit erregte, Schmuck und übertriebene Schminke, tiefe Ausschnitte und zu moderne Schuhe galt es zu vermeiden. Alles musste neutral und diskret aussehen, schließlich war es ihre Aufgabe, zu helfen, den Ablauf zu garantieren und den Menschen in ihrer Trauer beizustehen; Kleidung und Erscheinungsbild sollten fast wie eine Uniform wirken.