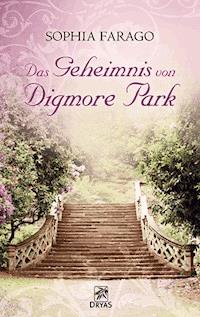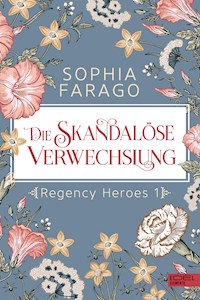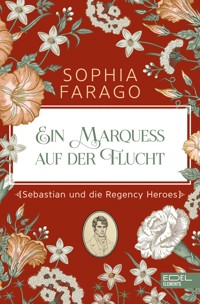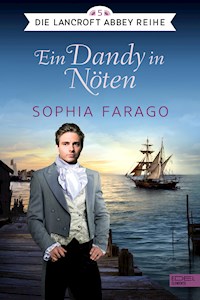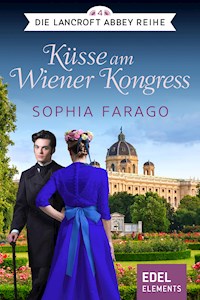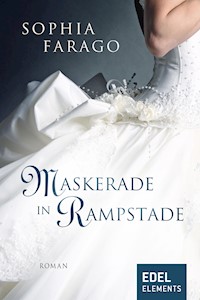7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Edel Elements - ein Verlag der Edel Verlagsgruppe
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Kaum jemanden achtet die vornehme Londoner Gesellschaft so sehr wie Mr Oscar Bradford. Er ist klug, meist freundlich, verfügt über einen feinen Humor und sein Ratschlag wird allgemein äußerst geschätzt. Nur für sich selbst weiß Oscar keinen Rat. Seit die anderen Heroes in festen Händen sind, ist sein Alltag zu einem trägen Einheitsbrei aus Arbeit, Pflichten, schrumpfenden Ersparnissen und Ärger mit dem skurrilen Erbonkel geworden. Er sehnt sich nach Liebe, Glück und Abenteuer, und weiß doch, dass keine Aussicht auf Erfüllung dieses Traums besteht. Bis, ja bis, ein Brett von hinten auf seinen Kopf herniedersaust und er ohnmächtig in eine Kutsche verfrachtet wird. Als er aufwacht liegt er in den Armen von Miss Virginia Ridgeway. Noch nie war jemand so hübsch gewesen und noch nie hat ihn jemand mit so viel Verachtung gemustert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 560
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Edel Elements
Ein Verlag der Edel Verlagsgruppe
Copyright © 2023 Edel Verlagsgruppe GmbH
Neumühlen 17, 22763 Hamburg
www.edel.com
Copyright © 2023 by Sophia Farago
Projektkoordination: Claudia Tischer
Lektorat: Dr. Rainer Schöttle
Korrektorat: Tatjana Weichel
Vermittelt durch: Michael Meller Literary Agency GmbH, München
ePub-Konvertierung: Datagrafix GSP GmbH, Berlin | www.datagrafix.com
Covergestaltung: Designomicon, München
Alle Rechte vorbehalten. All rights reserved. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
eISBN: 978-3-96215-488-2
Regency Heroes – Wie alles begann
Während der Schulzeit im noblen Privatinternat von Harrow hatten sie sich noch misstrauisch beäugt. Harold, der trotz seiner Fröhlichkeit und dem Mut, der bisweilen an Übermut grenzte, äußerst pflichtbewusst war, betrachtete Elliot mit all seinen Streichen und dem lauten Gelächter, das durch die weiten Flure der Schule hallte, als kindischen Nichtsnutz. Dieser verstand nicht, wie man so wissensdurstig und vernünftig sein konnte wie Oscar, der sich wiederum vor der scharfen Zunge und dem Sarkasmus von Elliots Cousin Reginald hütete. Und der wiederum konnte mit den drei anderen überhaupt nichts anfangen, weil er sich ihnen überlegen fühlte.
Doch dann kam das Studium in Oxford. Die vier erkannten schnell, dass sie nur gemeinsam gegen die Übermacht der Schüler aus Eton bestehen und die Mutproben, die ihnen die Älteren abverlangten, bewältigen konnten. Fortan teilten sie Freud und Leid sowie eine Ecke im geräumigen Schlafsaal. Der Hausknecht hatte auf die Betthäupter die Anfangsbuchstaben ihrer Vornamen gemalt: H E R O – die Regency Heroes waren geboren. Nun, 1813, sechs Jahre nach dem Studienabschluss, erweist sich die Freundschaft der vier so unterschiedlichen Gentlemen als wichtiger denn je.
Anmerkungen:
Dies ist Band 4 der Regency-Heroes-Reihe. In jedem der Romane wird eine Liebesgeschichte fertig erzählt. Du kannst dir also aussuchen, mit welchem du anfängst. Am meisten Spaß macht es trotzdem, wenn du mit dem ersten beginnst und in Die skandalöse Verwechslung eintauchst.
Freudige Überraschung! H E R O besteht aus vier Anfangsbuchstaben von vier Namen – dennoch macht der Epilog neugierig auf Emils Geschichte.
Eine Liste der wichtigsten Personen und Fachausdrücke findest du im Anhang.
Kapitel 1
August 1813Haus von Mr Oscar Bradford in Hampstead, etwa 3,5 Meilen nördlich von LondonFünf Tage vor der listenreichen Entführung
Der dichte Rauch war weithin sichtbar. Hohe Flammen schlugen grell gegen den Nachthimmel, Funken stoben. Es prasselte und zischte und mit einem lauten Knall stürzte auch noch der letzte Dachbalken in das tosende Feuer. Oscar Bradford hatte weder Zeit noch Nerven, über die Konsequenzen nachzudenken, die der Brand in seinen Stallungen haben würde. Zwei der Burschen hatten alle Pferde gerade noch rechtzeitig ins Freie bringen können. Die Tiere befanden sich nun draußen auf der Koppel und somit in Sicherheit. Das war das Wichtigste.
Nun stand Oscar ganz vorn in einer der drei Menschenketten, die Wasser eimerweise von jenem großen Löschteich schöpften, der zum Glück nicht allzu weit entfernt lag. Von allüberall waren Pächter, Bekannte und Nachbarn herbeigeeilt, um ihm bei der Bekämpfung des Brandes zu helfen, und so war es den Männern bisher tatsächlich gelungen, ein Übergreifen der Flammen auf das Haupthaus zu verhindern. Auch die Feuerwehr von Hampstead war fünf Mann hoch angerückt und brachte ihre ledernen Schläuche zum Einsatz. Der Butler Mr Carrock und die Lakaien eilten immer wieder ins Haus, um für Erfrischungen zu sorgen und die Helfer auch mit der Suppe zu stärken, die die Köchin eigentlich für die nächsten Tage vorgekocht hatte. Wie die anderen auch, waren ihre Hände und Gesichter schwarz vor Ruß und sie kämpften sich hustend von einem der Helfer zum anderen. Oscars Schwester Emily und deren Nachbarin und beste Freundin Lady Clara Baronin Helmsbury hatten Verbandszeug auf den Tisch im Eingangsbereich des Hauses geschafft und halfen Verletzten, ihre Wunden zu reinigen und zu verbinden und so manchen Holzsplitter aus den rauen Fingern zu ziehen. Auch Baron Helmsbury selbst griff überall mit an, wo Not am Mann war.
Alle waren sie da. Alle halfen mit. Alle – bis auf einen. Oscars Erbonkel, der alte Earl of Glazebury, glänzte mit verdächtiger Abwesenheit. William, einer der Stallburschen, behauptete, eine Gestalt in genau so einer weinroten Samtjacke hinter dem Stall gesehen zu haben, wie der Earl sie gern trug. Das sei kurz vor Ausbruch des Brandes gewesen. Er konnte sich allerdings nicht erklären, wohin der alte Mann dann so schnell verschwunden sein sollte. Noch dazu, da er seine gichtigen Beine nur mehr mithilfe eines Gehstocks mühsam fortbewegen konnte.
Oscar hatte den Großonkel vor ungefähr drei Jahren zu sich geholt, als ein Brand dessen eigenes Anwesen in Hounslow in Schutt und Asche gelegt hatte – oh, welch Ironie des Schicksals! Der einzige Sohn des Earls hatte damals ein Feuer gelegt und war dann selbst auf tragische Weise darin umgekommen. Obwohl Oscar den alten Herrn zu dieser Zeit kaum kannte, hatte er ihm in seinem Haus in Hampstead eine neue Heimat geboten. Immerhin war dieser damals schon Mitte siebzig gewesen und stand nach dem Tod seines Sohnes ganz allein auf der Welt. Also hatte es Oscar für seine Pflicht gehalten, ihm durch seine Großzügigkeit Respekt und Dank dafür zu erweisen, dass er in nicht allzu ferner Zeit den Titel eines Earls of Glazebury und dessen Vermögen erben würde. In nicht allzu ferner Zeit! Vermögen! Er konnte nur bitter auflachen, wann immer er daran dachte. Die knapp drei Jahre, die Glazebury nun schon bei ihm wohnte, fühlten sich endlos an. Sie waren gefüllt mit den unterschiedlichsten Eskapaden des Alten, welche die vornehme Londoner Gesellschaft so manch indigniertes Stirnrunzeln gekostet hatte. Oder auch ein amüsiertes Auflachen und sehr oft ein sensationsgieriges Teilnehmen an seinen sinnlosen Wetten. Ihn jedoch kostete der Onkel beinahe all seine Ersparnisse, und darüber hinaus auch noch seine letzten Nerven. Er konnte nur hoffen, dass sich nach dem Tod des Earls seine insgeheime Hoffnung erfüllte, dass der Alte doch noch irgendwo einen kleinen Batzen Geld bunkerte und ihm damit seine bisherigen Ausgaben zumindest teilweise ersetzt werden würden.
Während sich Oscar all dies durch den Kopf gehen ließ, drehte er sich immer wieder zu dem Stallburschen um, der einen vollen Eimer nach dem anderen an ihn weiterreichte, und schüttete das Wasser schließlich in hohem Schwall auf die Flammen. Immer und immer wieder. Bis er die Finger kaum mehr spürte und die Schultern und das Kreuz so stark schmerzten, dass er befürchtete, er würde sich am nächsten Tag kaum rühren können. Gegen zwei Uhr früh stieß der Feuerwehrkommandant dann endlich ins Horn, um das ersehnte Signal Brandaus! zu geben. Der ehemals weitläufige Stall war nur mehr ein verkohlter, nasser Haufen, mit dem nichts mehr anzufangen sein würde. Aber zumindest war es ihnen mit vereinten Kräften endgültig gelungen, die Gefahr für das Herrenhaus abzuwenden. Als Oscar sich bei allen Helfern ringsum bedankte, zog ein starker Wind auf und die ersten Blitze zuckten vom Nachthimmel. Binnen Minuten begann es wie aus Eimern zu schütten. Während die anderen sich in Windeseile in alle Richtungen davonmachten, sah er zum Himmel hinauf und schüttelte den Kopf. Er wusste nicht, ob er froh darüber sein sollte, dass der Wind nicht früher aufgezogen war – wodurch die Flammen wieder gefährlich angefacht worden wären –, oder ob er Petrus dafür zürnen sollte, ihnen die ganze Löscharbeit aufzubürden, die er selbst binnen Minuten hätte erledigen können. Viel zu erschöpft, um sich zu entscheiden, stapfte er die Treppe zu seinem Schlafzimmer hinauf. Er nahm sich dann kaum ausreichend Zeit, sich entkleiden zu lassen und Hände und Gesicht vom ärgsten Schmutz zu befreien, bevor er sich aufs Bett warf und binnen Minuten eingeschlafen war.
Oscar Bradford wäre allerdings nicht Oscar Bradford gewesen, wenn er sich nicht trotz allem dazu gezwungen hätte, bereits am frühen Vormittag wieder auf den Beinen zu sein. Er galt allgemein als vernünftig, verlässlich und diszipliniert und hatte schon so lange seine eigenen Bedürfnisse hintangestellt, dass ihm diese Tatsache gar nicht mehr auffiel. Beim einsamen Frühstück erkundigte er sich nach seiner Schwester und dem Onkel und erfuhr, dass die eine noch schlief, was ihn nicht überraschte. Und dass der andere die ganze Nacht nicht nach Hause gekommen war, was ihn ebenso wenig verwunderte. Der Earl – es war ihm noch niemals in den Sinn gekommen, den alten Herrn mit Onkel Horatio anzusprechen oder auch nur so von ihm zu denken – war in letzter Zeit häufig über Nacht bei White’s, ihrem gemeinsamen Club in London, geblieben. Oscar hatte keine Ahnung, was der Alte derzeit wieder ausheckte, und er hatte es längst aufgegeben, sich darüber den Kopf zu zerbrechen. Sein eigener Verstand war ohnehin nicht in der Lage, sich die Skurrilitäten auszudenken, mit denen ihm der Onkel seit Jahren das Leben schwer machte. Aber eines schwor er sich an diesem Morgen: Sollte es sich herausstellen, dass Glazebury bei dem Brand die alten, gichtigen Finger im Spiel gehabt hatte, dann würde er sich das nicht mehr länger gefallen lassen. Dann würde er … Zu seinem Leidwesen hatte er keine Ahnung, was er dann tun würde. Sein Freund Reginald Ashbourne, der in Kürze zum Duke of Warminster ernannt werden würde, lag ihm schon seit Jahren in den Ohren, den Greis mit Sack und Pack aus dem Haus zu jagen.
„Warum lässt du dich von ihm ausnehmen wie eine Weihnachtsgans, statt ihn eiskalt vor die Hunde gehen zu lassen?“, hatte er ihn nicht nur einmal gefragt. „Er hätte es doch allemal verdient.“
So gern Oscar diesen Rat auch befolgt hätte, er hatte es nicht übers Herz gebracht.
Der Butler trat ein und holte ihn aus den Grübeleien.
„Der Zimmermann Mr Mawbray wartet draußen, Sir. Er ist gekommen, um mit Ihnen über den Wiederaufbau der Stallungen zu sprechen. Angeblich hätten Sie ihn noch gestern Nacht darum gebeten.“
„So ist es.“ Oscar tupfte sich mit der Serviette die Mundwinkel ab, bevor er sie auf den Tisch legte. „Führen Sie ihn bitte in mein Arbeitszimmer, Carrock, ich komme sofort nach.“
Der hohe Bedienstete hatte den Raum schon beinahe wieder verlassen, als ihm noch etwas einfiel.
„Ach ja, übrigens, Sir“, sagte er, während er sich wieder zu ihm umdrehte. „Die Burschen haben noch in der Nacht sämtliche Blechwannen, die wir auftreiben konnten, auf dem Dachboden aufgestellt. Doch bedauernswerterweise ist das Dach inzwischen schon so undicht, dass das Regenwasser auf der Westseite in die Räume darunter eingedrungen ist.“
Keine zwei Stunden später saß Oscar wieder allein an seinem Schreibtisch. Er stützte die Ellenbogen auf die Tischplatte, vergrub das Gesicht in den Handflächen und fand, dass es ihm reichte. Und zwar in vielerlei Hinsicht. Der abgebrannte Stall war nur mehr das Tüpfelchen auf dem I gewesen. Er hatte es satt, in einem zugigen Landsitz zu wohnen, in dem der Wind durch alle Ritzen pfiff, man Blechwannen auf dem Dachboden aufstellen musste und das Wasser dennoch in darunterliegende Schlafräume drang. Er verfluchte sein Schicksal dafür, dass er dem Drängen seines Nachbarn Mr Netherby nun doch würde nachgeben müssen. Der lag ihm seit Jahren mit dem Wunsch in den Ohren, ihm das große Stück Land zu verkaufen, das im Norden an dessen Felder angrenzte und das nicht zum unveräußerlichen Erbbesitz gehörte. Obwohl Netherby bereit war, einen hohen Preis dafür zu zahlen, hatte sich Oscar bisher stets geweigert, seinen Überredungsversuchen nachzugeben. Sollte sich seine Schwester in einen Mann verlieben, der keinen Landsitz sein Eigen nennen konnte, hatte sich Oscar gedacht, so wollte er ihr dieses Grundstück als Aussteuer mitgeben, damit sie darauf ein Haus errichten konnten. Die Idee war nicht ganz uneigennützig, wie er sich selbst eingestand. Er liebte Emily und hätte sie gern für immer in seiner Nähe gehabt. Außerdem würde es ihn freuen, seine zukünftigen Nichten und Neffen aufwachsen zu sehen. Oscar richtete sich in seinem Stuhl auf und griff nach dem Kaufvertrag, den sein Nachbar bereits hatte anfertigen lassen. Es half alles nichts, er musste das Land verkaufen. Also konnte er es genauso gut umgehend hinter sich bringen und unterschreiben.
Das Dach gehört neu gedeckt, redete er sich gut zu, während er die Feder in die Tinte steckte, und zwar rasch.
Jeder weitere Regen würde die bereits vorhandenen Schäden noch erheblich verschlimmern. Dazu gab es jede Menge anderer dringend notwendiger Reparaturarbeiten am und im Haus. Und natürlich der Stall! Der musste so schnell wie möglich wiederaufgebaut werden.
Oscar zog an der silbernen Kette und fischte seine Taschenuhr aus der Hose. Schon vier Uhr! Sein Nachbar und Freund, der Baron Helmsbury, hatte sich für halb fünf angekündigt. Sie würden sich gemeinsam eine Übergangslösung für die Pferde überlegen. Im Stall des Barons war leider kein Platz mehr, aber man konnte die Tiere unmöglich bei Hitze und Regen ungeschützt auf der Koppel stehen lassen. Er unterschrieb den Vertrag, steckte die Feder ins Fässchen zurück und streute Sand auf das Dokument. Mit der anständigen Summe, die Netherby zahlen würde, und dem eigenen Notgroschen, der auf seinem Konto im Bankhaus Wivenhoe in London lag, sollten sich die nötigen Arbeiten allesamt finanzieren lassen.
Mr Mawbray und auch alle anderen Handwerker in der Gegend waren ihm wohlgesinnt. Er galt im Umkreis allgemein als besonders freundlicher, höflicher und kluger Gentleman, den man bei allen Problemen um Rat fragen konnte. Die Listen, auf denen er das Für- und Wider abwog und die geeigneten Maßnahmen notierte, waren legendär und, wie er sich selbst eingestand, bei manchen auch berüchtigt. Die Handwerker würden ihm daher einen guten Preis machen. Sie hatten ihm aber auch unmissverständlich mitgeteilt, erst dann zum Hammer greifen zu wollen, wenn vorab ausreichend Scheine den Besitzer gewechselt hatten. Es hatte sich längst im Landkreis herumgesprochen, dass die Schulden seines vermaledeiten Erbonkels beinahe seine gesamte Barschaft verschlungen hatten.
Oscar schnaufte unwillig. Wo nur war sein Onkel wirklich? Er hatte ihn seit dem vorigen Nachmittag nicht mehr gesehen. Und auch da nur kurz, als ihm der Alte, quasi im Vorübergehen, von einer Wette erzählt hatte, die angeblich eigentlich nicht zu verlieren gewesen wäre, die er aber dennoch verloren hatte. Oscar hatte ihm nur mit halbem Ohr zugehört und das Weite gesucht, bevor er dem Drang hätte nachgeben können, seine Hände um den Hals seines schadenfroh gackernden Onkels zu legen. Anscheinend ging es bei der Wette um Ringelsocken, aber so genau wusste er es nicht. Und er wollte es auch nicht wissen. Was er jedoch wusste, war, dass er in den nächsten Tagen, wenn er ohnehin nach London fuhr, um seine höchst ehrenvolle Rolle eines Trauzeugen seines Freundes Reginald zu erfüllen, auch im Club vorbeischauen musste, um diese Wettschulden zu begleichen. Schließlich konnte er es nicht zulassen, dass der gute Name seiner Familie Schaden erlitt. Oscars unwilliges Schnaufen ging in ein Seufzen über.
Es ist nicht nur das fehlende Geld, das mir Kummer und Sorgen bereitet, so gestand er sich ein, sondern auch die Tatsache, dass ich für alles und jedes immer ganz allein zuständig und verantwortlich bin.
Seit die anderen Heroes alle in festen Händen waren, lebten sie ihr eigenes Leben. Er konnte nicht mehr zu jeder Tages- und Nachtzeit bei ihnen aufkreuzen, wenn ihm der Sinn danach stand. Ja, natürlich, sie trafen sich einmal die Woche, aber da gab es so viel anderes zu besprechen und er wollte sie nicht jedes Mal mit seinen Sorgen langweilen. Apropos Sorgen. Auch Emily machte ihm welche. Es war nun schon die zweite Saison, die unter der Ägide der Baronin Tetbury in London zu Ende ging, und noch immer war kein passender Gemahl am Horizont erschienen. Das konnte er beim besten Willen nicht verstehen. Seine Schwester war hübsch, hatte die besten Manieren und ein freundliches Wesen, sie kam aus einer guten Familie und er würde von Netherbys Geld eine Summe abzweigen, um ihr eine kleine, aber doch ansprechende Mitgift geben zu können. Warum nur verbrachte sie ihre Zeit lieber bei ihm oder ihrer Freundin Clara, Baronin Helmsbury, die ganz in seiner Nähe wohnte, als sich in der Londoner Gesellschaft nach einem passenden Verehrer umzusehen? London! Wieder glitten seine Gedanken zum alten Earl of Glazebury zurück. Der trieb sich in letzter Zeit besonders viel in der Hauptstadt herum und Oscar wusste nie, welche Schreckensnachricht ihn am darauffolgenden Tag erwartete. Es war kein Geheimnis: Seit Onkels Bekannter, der Duke of Warminster, im hohen Alter noch geheiratet und offenbar einen Sohn gezeugt hatte, um seinem ungeliebten Erben einen Strich durch die Rechnung zu machen, war Glazebury von der Idee besessen, es ihm gleich zu tun. Allerdings war er nicht nur unansehnlich, sondern auch unausstehlich, sodass sich Oscar keine ernsthaften Sorgen machte, dass dieser Plan gelingen könnte. Außerdem hoffte er insgeheim immer noch, im Earl würde ein letzter Rest Familiensinn stecken. Nach allem, was er, Oscar, für ihn getan hatte und immer noch tat, nach all dem Geld, das der Onkel ihn schon gekostet hatte, da konnte der doch nicht wirklich daran denken, ihn von der Erbfolge auszuschließen. Da musste er doch noch irgendwo in seinem Inneren ein wenig Dankbarkeit und Gerechtigkeitssinn verspüren. Oscar verbot sich ja schließlich auch zu hoffen, sein Onkel würde sich den Duke of Warminster bei etwas anderem zum Vorbild nehmen, in dem er still und heimlich und möglichst rasch ebenfalls das Zeitliche segnete. Darauf würde er wohl noch viele Jahre warten müssen. Denn zum Unterschied zum korpulenten Duke war Glazebury klein und drahtig, er trank nicht und hielt sich von allen Gefahren fern. Außer von finanziellen, natürlich. Aber die kosteten schließlich nicht ihn schlaflose Nächte.
Apropos schlaflose Nächte. Oscar gähnte ausgiebig. Er war so unglaublich müde. Sobald er mit Baron Helmsbury die Pferdefrage geklärt hatte, würde er sich zu Bett begeben, um Kräfte zu sammeln. In drei Tagen musste er gesund und munter am Altar der Kirche von St. George stehen, wenn Reginald die schöne römische Contessa Amerina heiratete. Eigentlich hatte sein Freund damit gerechnet, sich da schon Duke of Warminster nennen zu können, doch seine Majestät der Prinzregent ließ sich mit der Unterzeichnung der Bestellungsurkunde mehr als ausreichend Zeit. Jetzt fand Oscar endlich wieder einen Grund zu lächeln. Der verstorbene Duke hatte alles versucht, Reginald als Erben auszubooten, während dieser als Folge eines Duells geglaubt hatte, quer durch Europa reisen zu müssen. Doch er war am Ende gescheitert. Reginald würde der Duke werden und es war er, Oscar selbst, gewesen, der auf die rettende Idee gekommen war, wie alle mit dem Erbe verbundenen Probleme gelöst werden konnten. Ja, ja, sollten seine Freunde nur bisweilen mit den Augen rollen und ihn „Oscar den Listenreichen“ nennen. Seine Vernunft, seine Umsicht und eben auch seine Listen hatten schon manchem von ihnen den Hals gerettet. Mit einem Schlag befand Oscar, dass er es satthatte, immer der zu sein, der vernünftig war und klug handelte. Er hatte es auch satt, immer pflichtbewusst und fleißig zu sein und nie einmal Fünfe grade sein zu lassen.
Am liebsten, so dachte er, würde ich stundenlang im Schatten eines Apfelbaums liegen und die Seele baumeln lassen.
Unter einem Apfelbaum? Er hielt in Gedanken inne: Warum, um Himmels willen, dachte er an einen Apfelbaum? Er mochte dieses Obst doch nicht einmal besonders gern. Nie wäre ihm eingefallen, sich einen Apfel einfach so vom Baum zu pflücken. Oder etwa gar hineinzubeißen, sodass der Saft in alle Richtungen spritzte. Wenn er Obst aß, dann nur fein aufgeschnitten von einem edlen Porzellanteller.
Aber, so beschloss er in diesem Augenblick, wenn ich je unter einem Apfelbaum liegen sollte, dann beiße ich in eine der Früchte hinein! Dazu lese ich ein gutes Buch und nichts und niemand kann mich davon abhalten, faul und unvernünftig zu sein und Gott einen guten Mann sein zu lassen.
Er seufzte selig. Ach, wie wäre das schön!
„Baron Helmsbury ist eingetroffen, Sir“, meldete der Butler von der Tür her. Es war Zeit, sich wieder der Realität zuzuwenden.
Das Gespräch mit seinem Besucher war so freundschaftlich und ging so schnell vonstatten, dass sie auch noch Zeit fanden, über andere Dinge zu sprechen. Der Baron bestand darauf, dass er schon seit Langem einen Bretterverschlag hatte bauen lassen wollen, um Ziegen zu züchten. Den würde er jetzt auf seine eigenen Kosten eilig errichten lassen, zuerst Oscars Pferde dort unterbringen und sich erst dann die Ziegen zulegen, wenn der neue Stall fertiggestellt war. Oscar glaubte ihm kein Wort, war aber viel zu froh über diese großzügige Unterstützung, um seine Zweifel laut auszusprechen.
„Wie geht es Timothy?“, fragte er stattdessen, als er dem Freund und sich ein Glas Whisky einschenkte. „Kann seine Aufnahme in Eton endlich stattfinden oder legen sie euch noch weitere Hindernisse in den Weg?“
Timothy war der um einiges jüngere Bruder des Barons. Er hatte sich als Kind bei einem Reitunfall beide Beine so unglücklich gebrochen, dass er sich nun nur mehr beschwerlich mit zwei Stöcken fortbewegen konnte. Inzwischen war er fünfzehn Jahre alt, wurde von einem Hauslehrer unterrichtet und sehnte sich nach nichts mehr als nach einer Zeit unter Gleichaltrigen.
„Mit dem neuen Hauslehrer seid ihr immer noch zufrieden, nicht wahr?“
„Neu? So neu ist der gar nicht mehr. Ja, wir sind mehr als zufrieden mit Mr Brown. Auch wenn ich dir die Aufregung damals gern erspart hätte, bin ich heute froh, dass sein Vorgänger mit deiner Schwester nach Gretna Green durchbrennen wollte. Anderenfalls wäre er wahrscheinlich immer noch in unseren Diensten und mein Bruder niemals derart aufgeblüht.“
„Das freut mich zu hören“, sagte Oscar. „Meine Aufregung hat sich längst gelegt. Damals kam schließlich niemand zu Schaden und durch die skandalöse Verwechslung lernte mein Freund Harold seine Amabel kennen.“
„Richtig. Und uns brachte sie Mr Brown ins Haus. Er tut meinem Bruder so gut. Timothy ist viel fröhlicher geworden. Er lacht mehr und saugt Wissen auf wie ein Schwamm. Brown ermuntert ihn auch, die Beine nicht länger zu schonen, sondern sie zu trainieren, soweit es eben möglich ist. Auch seine Arme sind kräftiger geworden, sodass er sich mit den Stöcken jetzt leichter fortbewegen kann. Dennoch …“ Helmsbury kniff die Lippen zusammen und seufzte.
„Dennoch?“
„Dennoch wäre es gut, wenn er einen oder besser noch zwei gleichaltrige Freunde hätte, die ihn nach Eton begleiten könnten. Er braucht stets jemanden um sich, der ihm bei den alltäglichen Verrichtungen hilft und seine Schulbücher trägt. Glaub mir, ich wäre gern bereit, mich an deren Schulgeld zu beteiligen, aber mir fällt in unserem Landkreis beim besten Willen niemand ein, der in Eton akzeptiert werden würde und den ich daher fragen könnte.“
„Mir leider auch nicht, aber ich werde die Augen offen halten“, versprach Oscar.
„Tu das, tu das, mein Freund. Es eilt allerdings nicht allzu sehr. Timothy wird erst im Januar in der Schule aufgenommen und ich konnte Mr Brown überreden, solange bei uns zu bleiben.“
„Wollte er denn weg?“, fühlte sich Oscar zu fragen verpflichtet. In Wirklichkeit interessierte ihn das Thema nicht mehr. Ihm lag viel mehr daran, herauszufinden, wo sich sein Onkel tatsächlich herumtrieb. Und wie viel Schuld er daran hatte, dass sein Stall in Schutt und Asche lag. Nur mit halbem Ohr hörte er seinen Freund irgendetwas von familiären Verpflichtungen erzählen, die der Hauslehrer angeblich hatte.
Kapitel 2
Auf dem Landsitz des jungen Baronet Ridgeway nahe der Ortschaft Uxbridge, etwa 16 Meilen westlich von HampsteadAm selben Vormittag
„Aber sie hat mir doch geschworen, dass sie mich liebt!“
Oscar Bradford war an diesem Tag nicht der Einzige, der litt. Ein gewisser Mr Leonard Linton übertraf ihn in seinem Seelenleid noch um einiges. Wenn auch aus einem ganz anderen Grund.
„Möchtest du nicht Platz nehmen, lieber Freund?“
Miss Virginia Ridgeway wies auf das Sofa neben dem Kamin und ging zum Klingelstrang hinüber, um für Erfrischungen zu sorgen.
„Ja, bitte, tu das, Leo!“, bekräftigte ihr Halbbruder Thommy, der Baronet. „Mir wird schwindlig, wenn ich noch länger zusehen muss, wie du hier vor uns im Kreis rennst, als wärst du ein aufgescheuchtes Huhn. Setz dich hin und dann erzähle uns in Ruhe, was Flora nun wieder angestellt hat.“
Mr Linton tat, wie ihm geheißen, stützte seine Ellenbogen auf die Knie und vergrub die beiden Hände in den Haaren. Allein die Tatsache, dass es ihm anscheinend völlig gleichgültig war, dass er damit seine kunstvoll arrangierte Windstoßfrisur in Mitleidenschaft zog, bewies den beiden anderen die Ernsthaftigkeit seines Kummers.
„Wenn ich dich richtig verstanden habe, dann hat dir unsere Schwester also einen Brief geschrieben …“, begann Virginia, nachdem sie selbst ihrem Gast gegenüber Platz genommen hatte. Sie war eine hübsche junge Frau von dreiundzwanzig Jahren, mit dunkelblonden Locken, einem wachen Verstand und ruhigem Gemüt, das sich sehr von dem ihres temperamentvollen jugendlichen Halbbruders unterschied. Nicht nur die Einrichtung des Wohnzimmers, auch ihr zartgrünes Morgenkleid zeugte von Geschmack, müheloser Eleganz und Wohlstand. Der Rock war aus feinem Batist und wies vier Reihen reicher Stickerei und zwei Volants auf. Das Dekolleté war kunstvoll verziert und das kleine Häubchen, das ihr Erscheinungsbild abrundete, war ein entzückendes turbanähnliches Gebilde, dessen Grün das Strahlen ihrer ebenfalls grünen Augen auf das Erfreulichste betonte. Mr Linton war jedoch blind für die Schönheit seiner Gastgeberin. Er nestelte in der Tasche seiner bisquitfarbenen Beinkleider und zog zwei zusammengefaltete Blätter Papier hervor, von denen er ihr eines nach einem kurzen Blick darauf wortlos weiterreichte.
„Lies vor!“, befahl der Baronet unnötigerweise und nicht gerade eben höflich. Virginia musste sich sehr beherrschen, ihn nicht zu ermahnen, er möge sich gedulden. Sosehr sie Thommy auch liebte, oftmals war es nicht leicht, die ältere Schwester eines Fünfzehnjährigen zu sein, dem es zu Kopf gestiegen war, bereits in so jungen Jahren die Würde eines Baronets zu tragen. Und der beschlossen hatte, dass ihm dies das Recht gab, sein Umfeld nach Belieben herumkommandieren zu dürfen.
Virginia entstammte der ersten Ehe ihres gemeinsamen Vaters, dem dritten, inzwischen verstorbenen Baronet Ridgeway. An ihre Mutter konnte sie sich nur mehr schemenhaft erinnern. Die Baronetesse starb, als Virginia noch keine fünf Jahre alt gewesen war. Der Witwer war zuerst untröstlich gewesen und hatte sich doch wieder auf Brautschau begeben, kaum dass das Trauerjahr vorüber war. Zuerst tat er das, wie er zu betonen nicht müde wurde, um seinem Töchterchen eine neue Mutter zu geben. Doch als er dann auf einem Ball im vornehmen, auch als Heiratsmarkt bekannten Almack’s Club der reizenden, blutjungen Sylvana Bromley vorgestellt wurde, war es um ihn geschehen. Obwohl er selbst die dreißig bereits überschritten hatte, warb er mit Feuereifer um die Sechzehnjährige, die nicht nur besonders hübsch anzusehen war, sondern in der Folge auch sein stilles, geordnetes Leben wie ein Wirbelwind auf den Kopf stellen sollte.
Sylvana entstammte einer angesehenen Familie. Ihr steinreicher Großvater war ebenfalls ein Baronet, dessen Titel nach seinem Tod allerdings nicht auf ihren Vater, sondern auf dessen älteren Bruder übergehen sollte, womit sie streng genommen nicht von Adel war. Diese Tatsache schrumpfte für Sir Ridgeway allerdings zur Kleinigkeit, war er doch über beide Ohren in das Mädchen verliebt. Sylvana, die genau wie ihre Mama nach Höherem strebte, war nur zu glücklich, als Baronetesse Ridgeway wieder in den Landadel aufzusteigen und reichte ihm daher die Hand zum Bund. Damals konnte noch niemand ahnen, dass sich ihr Großvater mit seinem Ältesten derart überwerfen würde, dass er das gesamte Vermögen, das nicht zum Titel gehörte, seinem zweiten Sohn, Sylvanas Vater, vermachte. Als dieser selbst verstarb, machte er seine Tochter zu einer ungeheuer reichen Frau. So reich, dass Sylvana ohne Probleme auch in den Hochadel hätte einheiraten können. Doch zu ihrem Leidwesen war sie damals schon seit fünf Jahren mit dem Baronet vermählt und hatte ihm zwei Kinder geboren, sodass es keinen Sinn hatte, diesen Traum auch nur eine Sekunde lang zu träumen.
Flora kam sechs Jahre nach Virginia zur Welt, Thomas folgte zwei Jahre später. Je älter Virginia wurde, umso weniger war Sylvana eine Mutter für sie. Obwohl sie elf Jahre jünger war, fühlte es sich eher so an, als hätte sie neben den beiden Halbgeschwistern mit der Baronetesse noch ein drittes, besonders anstrengendes Kind, um das sie sich kümmern musste. Seit der Baronet dann vor gut eineinhalb Jahren an einem heimtückischen Fieber verstorben war, hatte sie immer öfter der Verdacht beschlichen, die einzig vernünftig Denkende auf Ridgeway Manor zu sein. Irgendwann hatte Sylvana jedoch begonnen, sich dagegen aufzulehnen, dass Virginia alle wichtigen Entscheidungen im Haushalt traf. Sie nahm das Zepter selbst in die Hand, dekorierte die Gästezimmer neu und ließ ihre Stieftochter nur zu deutlich spüren, dass sie für sie nur mehr einen Klotz am Bein darstellte. Gerade gut genug, um eine bessere Gesellschafterin für den jungen Thommy zu sein, der ihre eigenen Nerven so stark strapazierte, dass sie mit dessen Erziehung nichts zu tun haben wollte.
Wie sich herausstellen sollte, hatte Virginias Vater einen Großteil des Vermögens, das Sylvana in die Ehe eingebracht hatte und das, wie es das Gesetz vorschrieb, auf ihn als ihren Gatten übergegangen war, an seine beiden jüngeren Kinder vermacht. Beide würden unermesslich reich sein, sobald sie die Volljährigkeit erreicht hatten. Den Bestimmungen des Testaments zufolge würde Flora allerdings durch eine Heirat bereits vorzeitig an das Erbe kommen. Auch wenn Virginia und Sylvana beide wohlversorgt zurückgeblieben waren, so erlaubte die monatliche Apanage, die ihnen aus einem Fond ausbezahlt wurde, nicht die großen Sprünge, die sich zumindest die Witwe gern erlaubt hätte. Virginia konnte ihrem Vater nicht genug dafür danken, dass er es Sylvana mit seinem letzten Willen unmöglich gemacht hatte, Ridgeway Manor niederreißen zu lassen, um einen modernen Neubau zu errichten. Auch ein Stadtpalais im vornehmen Londoner Stadtteil Mayfair zu kaufen erlaubte das Erbe nicht, wohl aber eines zu mieten. So verbrachten Sylvana und die siebzehnjährige Flora die Saison in der Hauptstadt, während ihre Stieftochter auf dem Land geblieben war, um wie immer ein Auge auf den fünfzehnjährigen Halbbruder zu werfen.
„Spann mich nicht länger auf die Folter, Virgi“, forderte Thommy nun ungeduldig und griff nach vorn, um seiner Schwester das Papier zu entreißen. „Was steht denn in dem Schreiben, verdammt noch mal?“
Virginia entzog es mit einer schnellen Handbewegung seiner Reichweite.
„Achte auf deine Wortwahl!“, rügte sie, ohne nachzudenken, und kam sich umgehend wie ihre eigene Großmutter vor.
„Ja wirklich“, fand sich Mr Linton verpflichtet, sie zu unterstützen. „Du solltest in Gegenwart einer Lady nicht fluchen, Thomas.“
„Das ist keine Lady, das ist bloß meine Schwester“, setzte sich dieser zur Wehr und ballte die Fäuste. „Wenn ich jetzt nicht endlich erfahre …“
„Teuerster Mr Linton“, begann Virginia zu lesen, um die Wogen wieder zu glätten.
„Teuerster Mister … was soll denn das für eine Anrede sein?“, bellte Thommy dazwischen. „Ihr kennt euch von Kindesbeinen an und sprecht euch doch für gewöhnlich mit dem Vornamen an.“
„Ich weiß.“ Der Besucher ließ seinen Kopf noch etwas mehr hängen.
Virginia hatte inzwischen den Brief im Stillen fertiggelesen und presste die Lippen aufeinander. „Verflixt, Sylvana!“, entfuhr es ihr, bevor sie unwillig schnaufte.
„Was hat denn Mama damit zu tun?“, fuhr ihr Bruder auf. „Ich dachte, es ginge um Flora?“
Nun reichte sie ihm doch den Brief hinüber.
„Ich schreibe Dir“, war es Thommy, der nun weiter vorlas, „um Dir mitzuteilen, dass ich seiner Lordschaft, dem Earl of Glazebury, die Hand zum Bund reichen werde. Was zum Teufel?!“ Er blickte von seiner Schwester zu Mr Linton hinüber. „Was soll denn das heißen? Habt ihr je von einem Earl of … wie hieß der noch schnell … Glazebury gehört?“
Die beiden schüttelten den Kopf, worauf Thommy sich wieder über das Schreiben beugte.
„Er ist zwar schon alt, aber meist recht freundlich zu mir und nur ganz selten aufbrausend oder bösartig. Die liebe Mama meint, sein Antrag würde unmittelbar bevorstehen. Wie Du Dir denken kannst, verehrter Freund, wenn ich Dich denn noch so nennen darf, ist sie außer sich vor Glück.“ Thommy unterbrach sich. „Oh, das kann ich mir nur zu gut vorstellen! Meine liebe Mama strebt stets nach Höherem.“
Dem konnte Virginia nur zustimmen. Nun, da die Saison zu Ende ging, war ihre Stiefmutter anscheinend ihrem größten Ziel einen Schritt nähergekommen. Wenn es ihr schon selbst verwehrt geblieben war, in den Hochadel einzuheiraten, so richtete sich ihr Ehrgeiz darauf, es zumindest ihrer Tochter zu ermöglichen. Durch eine solch vorteilhafte Vermählung würde sie zwar nicht selbst die Gattin eines Earls werden, konnte sich jedoch auf dem gesellschaftlichen Parkett zu Recht als die Mutter einer Countess bezeichnen.
Thommy ließ das Blatt sinken. „Eines verstehe ich nicht: Wie soll Flora den Antrag dieses Earls annehmen können, wenn sie doch mit dir verlobt ist, Linton?“
Sein Besucher seufzte tief. „Du vergisst, dass wir uns zwar als Kinder geschworen haben, Mann und Frau zu werden, aber nicht wirklich offiziell verlobt sind, Thomas. Dazu hätte ich Flora nämlich einen formellen Antrag machen müssen, aber …“ Weiter kam er nicht.
„Warum bist du auch so ein zögerlicher Wicht?!“, rief der Jüngere nicht wirklich wertschätzend aus und plusterte die Backen auf. „Ihr habt doch, seit ich zurückdenken kann, nur Augen füreinander. Vater hat eurer Verbindung seinen Segen gegeben. Meine kleine Flora wird einmal den jungen Linton heiraten, hat er immer wieder gesagt. Es ist beruhigend zu wissen, dass zumindest eine meiner Töchter die richtige Wahl getroffen hat.“
„Wie nett von dir, dass du uns daran erinnerst“, erwiderte Virginia bitter. Vater hatte ihren eigenen Verlobten nie leiden können, das wusste sie selbst nur zu gut. Doch das war nicht mehr wichtig, denn Charles war tot. In Spanien gefallen für König und Vaterland, nur wenige Tage nach dem Tod des Baronets. Während ihr Leonard mitfühlend die Hand drückte, beachtete ihr Bruder sie nicht. Der hatte mit Linton nämlich weiterhin ein Hühnchen zu rupfen.
„Was wäre denn so schwer daran gewesen, vor Flora hinzutreten und die entscheidenden Worte auszusprechen? Manchmal bist du so ein Feigling!“
Während Virginia scharf die Luft einzog, saß Mr Linton mit einem Schlag kerzengerade. „Ich verbitte mir solche Beleidigungen, junger Mann!“, sagte er streng.
„Du kannst mir gar nichts verbieten“, trumpfte der andere auf. „Ich bin ein Baronet!“
„Dann benimm dich auch wie einer“, lautete die trockene Antwort. „Eben hast du geklungen wie ein unerzogener Straßenjunge.“
Diese Rüge fiel nun doch auf fruchtbaren Boden. Immerhin war Leonard beinahe acht Jahre älter als er und ein ehrenwertes Mitglied der Gesellschaft.
„Ich bitte um Entschuldigung“, murmelte Thommy ungewohnt kleinlaut.
„Du willst wissen, warum ich Flora noch nicht um ihre Hand gebeten habe? Das kann ich dir leicht erklären“, sagte Mr Linton nun auch wieder friedfertig. „Deine Schwester war erst fünfzehn, als uns euer Vater seinen Segen gab. Das erschien mir zu früh, um von ihr eine Entscheidung fürs Leben zu verlangen. Dann starb euer Papa, und ich hielt es für angebracht, die Trauerzeit abzuwarten. Und gleich nach deren Ablauf verschwand Flora mit Lady Ridgeway nach London.“
„Na und?“ Thommy bekam schon wieder Oberwasser. „Warum bist du ihr nicht nachgereist? London ist doch nicht aus der Welt! Warum hast du die Saison nicht ebenfalls in der Hauptstadt verbracht und ihr dort den Hof gemacht?“ Er blickte siegessicher in die Runde, als wären diese Worte das Gelbe vom Ei.
„Mit welchem Geld hätte ich mein Leben in der Großstadt finanzieren sollen, du Heißsporn? Kannst du mir das vielleicht auch noch verraten? Es ist nicht jeder so reich wie du. Außerdem habe ich im Unterschied zu dir Verpflichtungen. Ich muss mich um meinen Landsitz kümmern. Ich kann nicht einfach in den Tag hineinleben und den Herrgott einen guten Mann sein lassen.“
„Du weißt genau, dass ich noch nicht an mein Geld herankomme!“, war es der Teil dieses temperamentvollen Ausbruchs, den sein jüngeres Gegenüber als Erstes nicht unwidersprochen hinnehmen wollte. „Bekanntlich hat unser Vormund, der alte Lord Bromley, also Mutters Onkel, die Hand darauf.“ Dann war es ihm doch noch wichtig, hinzuzusetzen: „Und in den Tag hinein lebe ich auch nicht!“
„Ich kenne die Höhe deiner halbjährlichen Apanage, Thommy, also spiel hier nicht den armen Jungen ohne Geld. Und eine wichtige Anmerkung noch: Deine ältere Schwester auf Trab zu halten, gilt nicht als allgemein anerkannte Beschäftigung“, antwortete Mr Linton ungewohnt sarkastisch und entlockte Virginia ein kleines Auflachen. „Solange du nicht in Eton zur Schule gehst, was deinem Alter angemessen wäre, so lange lebst du in den Tag hinein.“
„Das geht dich doch überhaupt nichts an!“, setzte sich Thommy empört zur Wehr. „Was kann ich denn dafür, dass mich der Alte nicht in Eton anmeldet? Solange mein Vormund nicht tätig wird, sind mir die Hände gebunden.“
„Hast du ihn denn darum gebeten?“
„Gentlemen!“, rief Virginia dazwischen. „Wir sollten uns wieder dem eigentlichen Grund von Leonards Besuchs zuwenden. Lies den Brief fertig vor, Thommy!“
„Da steht nicht mehr viel“, erklärte ihr Bruder. „Nur dass Mutter darauf besteht, dass sie den Antrag annimmt. Der Earl sei zwar laut Flora nicht wirklich ansehnlich. Aber Mama“, las er dann doch weiter vor, „meint, es schicke sich nicht, auf Äußerlichkeiten zu achten.“
Jetzt konnte sich Virginia ein sarkastisches Auflachen nicht mehr verkneifen. Sie kannte keine andere Person, die so sehr auf Äußerlichkeiten Wert legte wie ihre Stiefmutter. Um einen Fuß in die Tür zum Hochadel zu bekommen, war das Aussehen also plötzlich unwichtig. Vor allem, da es ja nicht sie selbst war, die mit dem Mann den Bund eingehen würde, sondern ihre Tochter.
„Du hast noch ein zweites Schreiben in der Hand, Leonard“, wandte sie sich an Mr Linton, bevor sie den bitteren Gedanken vertiefen konnte. „Ich will nicht neugierig sein, aber ist das ebenfalls für uns von Bedeutung?“
„Vielleicht, ja.“ Mit einem Schlag klang die Stimme ihres Besuchers ein wenig hoffnungsfroher. „Mein Großonkel Walton Baron Salcott hat mich zu sich nach Yorkshire bestellt. Er hat selbst keine Kinder und sein Erbe wird auf meinen ältesten Cousin übergehen, aber er lässt in diesem Schreiben hier anklingen, dass er bereit wäre, mir bereits zu Lebzeiten einen gewissen Geldbetrag zu überschreiben. Ich hoffe so sehr, dass das stimmt. Mit diesen Mitteln könnte ich Flora zwar auch noch kein Leben in Luxus bieten, aber zumindest in sicherem Wohlstand.“ Er seufzte tief. „Ich hätte ihr das bieten können, sollte ich wohl richtigerweise sagen. Denn wenn sie in der Zwischenzeit den Earl heiratet …“
„Du lieber Himmel!“, unterbrach ihn Thommy und wedelte mit dem Brief seiner Schwester in der Luft herum. „Jetzt erst habe ich den Satz entziffern können, den Flora hier oben an den Rand gekritzelt hat. Hast du den gelesen, Virgi? Mir scheint, jetzt hat die Gute endgültig den Verstand verloren.“
„Sprich nicht so von Flora!“, fuhr Mr Linton auf, um sich dann doch neugierig nach vorn zu beugen. „Was steht denn dort? Mir ist der Satz zwar aufgefallen, doch muss ich gestehen, dass ich mit dem Entziffern dieser Hieroglyphen überfordert war.“
Thommy starrte ihn an. „Wobei warst du überfordert? Hiero… was? Wovon redest du denn da?“
„Hieroglyphen sind ägyptische Schriftzeichen. Bisher ist es noch keinem Menschen gelungen, sie zu entschlüsseln“, erklärte Linton, um draufzusetzen: „Das sollte man in deinem Alter eigentlich wissen. Ich sagte doch, du gehörst umgehend nach Eton.“
„Ägyptische Schriftzeichen?“ Thommy runzelte die Stirn. „Was interessieren mich denn ägyptische Schriftzeichen, wenn …“
„Nun sag schon!“, forderte Virginia, bevor der nächste Streit hätte aufflammen können. „Was steht denn da am Rand?“
„Verzage nicht, mein lieber Leo“, las Thommy und ahmte dabei Floras Stimme so gekonnt nach, dass man fast hätte meinen können, sie säße mit im Wohnzimmer. „Vielleicht stirbt er bald und dann ist der Weg für uns wieder frei.“ Er ließ das Blatt sinken und starrte mit großen Augen in die Runde: „Habt ihr auch den Eindruck, dass sie nun endgültig den Verstand verloren hat?“
Leonard hingegen hörte aus diesen Zeilen eine ganz andere Botschaft. „Sie will immer noch mit mir zusammen sein.“ Er lächelte selig.
Virginia fand weder das eine noch das andere besonders hilfreich. „Du musst nach London fahren, um dem Antrag des Earls zuvorzukommen!“, rief sie, ohne länger nachzudenken. „Du kannst doch nicht zulassen, dass er sie heiratet, und dann abwarten, bis sie Witwe wird. Egal was Flora schreibt, bis zu dessen Tod kann es mit Sicherheit noch viele Jahre dauern. Außerdem kannst du nicht ernsthaft wollen, dass sie, dass sie …“
… mit ihm die ehelichen Pflichten vollzieht, hätte sie sagen wollen, brachte aber diese frivole Tatsache nicht über die Lippen.
„Was ich will, steht hier nicht zur Debatte“, entgegnete Linton nun wieder düster. „Solange ich nicht sicher weiß, dass ich Onkels Geld bekomme, um Flora den ihr zustehenden Wohlstand zu bieten, solange kann ich nicht …“
„Vergiss doch deine lästigen Skrupel, Leo!“, fuhr Thommy auf.
„Meine Schwester wird nach der Heirat mehr als genug Geld für euch beide haben.“
„Vielen Dank, dass du mich offenbar für einen schändlichen Mitgiftjäger hältst, junger Mann!“ Linton presste die Lippen zusammen. „Ich darf dir versichern, dass …“
Virginia hätte am liebsten die Köpfe der beiden zusammengeschlagen. „Das hilft uns doch nicht weiter!“, rief sie ungeduldig. „Leonard, du und Flora, ihr gehört zusammen. Egal, was in diesem Brief steht. Ihr liebt einander seit Jahren und Papa hat euch seinen Segen gegeben.“ Sie wartete, bis die beiden anderen genickt hatten, um dramatisch zu verkünden: „Unsere Schwester darf nicht auf dem Altar von Sylvanas Streben nach einem hohen Titel und gesellschaftlichem Aufstieg geopfert werden.“
„Siehst du denn einen Ausweg?“, erkundigte sich Linton zwischen Hoffnung und Verzagen hin- und hergerissen.
„Was immer du auch planst, Virgi, ich bin mit an Bord“, verkündete Thommy.
„Fahr du nach Yorkshire, Leonard, und sichere dir das Geld deines Onkels“, bestimmte Virginia. „Sobald das der Fall ist, fährst du ohne weiteren Aufschub nach London und bittest Flora, deine Frau zu werden. Thommy und ich werden uns in der Zwischenzeit in die Hauptstadt begeben und alles tun, um zu verhindern, dass unsere Schwester in der Zwischenzeit jemand anderem die Hand zum Bund reicht.“
„Dein Angebot, mich zu unterstützen, ehrt mich. Aber wie wollt ihr das denn anstellen?“, fragte Linton, offensichtlich nicht überzeugt.
„Zuerst werden wir Lord Bromley aufsuchen“, überlegte Virginia. „Er ist immerhin Floras Vormund. Wir werden ihn an Papas Segen erinnern. Wenn wir Glück haben, wird er sich daraufhin gegen die Heirat seines Mündels mit diesem Earl aussprechen. Dann kann auch Sylvana nichts dergleichen unternehmen.“
„Als wenn der Alte jemals zu etwas gut gewesen wäre“, murmelte Thommy bitter.
Diese Aussage war zwar äußerst respektlos, Virginia nahm sie jedoch unwidersprochen hin, da sie den Tatsachen entsprach.
„Sollte unser Besuch wider Erwarten nicht das gewünschte Ergebnis zeitigen“, sprach sie weiter, „dann werden wir Sylvana und Flora ins Gewissen reden.“
„Was, wenn das auch nichts bringt?“, erkundigte sich Mr Linton halb hoffend, halb resignierend.
„Dann wird mir bestimmt etwas anderes einfallen, verlass dich darauf, Leo“, erklärte Thommy mit einer Großspurigkeit, die seinem jugendlichen Alter geschuldet war. „Fahr du nach Yorkshire. Alles andere kannst du getrost uns überlassen.“
Kapitel 3
London, Palais von Baronet Wentworth BromleyZwei Tage vor der Entführung
„Nein, bitte niiiiiicht!“ Lord Bromley verzog den Mund wie ein quengelndes Kleinkind und griff zu einem Stück Shortbread, von dem eine reiche Anzahl auf einem silbernen Tablett bereitlag. Er hatte sich in seinen Fauteuil zurückgelehnt und die Beine unter Ächzen und Stöhnen auf einem Hocker abgelegt, der mit demselben gelbgoldenen Stoff bezogen war wie der Sessel selbst. Eine massige Gestalt, ganz in glänzendes Elfenbein gekleidet, und so konturlos, dass es schien, als würde sie mit dem Untergrund verschmelzen. Alles an Mr Bromley war elfenbeinfarben. Angefangen von den seidenen Hausschuhen, den Strümpfen und den Kniebundhosen bis zu der mit Pfauen und anderem Getier reichlich Ton in Ton bestickten Weste und dem achtlos geknüpften Halstuch. Der Onkel ihrer Stiefmutter wirkte, wie Virginia respektlos dachte, wie ein achtlos weggeworfener Klumpen Teig. Das Einzige, was das monotone Bild störte, waren seine blutroten und blauen Äderchen auf den feisten Wangen. Seine beiden ebenfalls elfenbeinfarbenen Hunde lagen schlafend zu seinen Füßen und klopften träge mit den Schwänzen.
„Lord Bromley, so leid es mir tut, wir können Ihnen die Wahrheit nicht ersparen.“ Virginia, die auf der Vorderkante ihres unbequemen Stuhls saß, hätte viel darum gegeben, ein Fenster öffnen zu dürfen. Es war unerträglich stickig im überladenen Wohnzimmer und es stank ganz erbärmlich. Um den Geruch von Schweiß und alten Hunden zumindest ein wenig besser ertragen zu können, fächelte sie sich stetig Luft zu. So hatte etwas, das sie eigentlich nur als hübsches Accessoire mitgenommen hatte, plötzlich eine sinnvolle Funktion bekommen. Nämlich der Fächer aus bemalter Seide, der ihr rauchblaues Tageskleid auf das Erfreulichste ergänzte.
Virginia war ein kleines Mädchen gewesen, als ihr Papa die um vieles jüngere Nichte von Lord Bromley geheiratet hatte. Dennoch hatte ihr seine Lordschaft nie gestattet, ihn Onkel zu nennen, wie es ihre Halbgeschwister selbstverständlich taten.
„Komm endlich zur Sache, Virgi!“, meldete sich Thommy nicht eben hilfreich vom Sofa her zu Wort. „Wir sind hier, Onkel Wentworth, weil Mama sich wieder einmal Flausen in den Kopf gesetzt hat und wir deine Hilfe brauchen. Seit Jahren schon steht der Bräutigam für Flora fest und plötzlich meint sie …“
„Flora? Wer ist nun Flora schon wieder?“, lautete die ebenso weinerlich wie gelangweilt vorgebrachte Frage, die Thommy unterbrach und dafür sorgte, dass ihm der Mund für einen kurzen Moment fassungslos offen stehen blieb.
„Wir sprechen von Ihrer Großnichte, Sir“, übernahm Virginia wieder das Wort. Sie gab ihrem Bruder mit einer Geste zu verstehen, dass er sich künftig besser zurückhalten sollte. „Der Tochter Ihrer Nichte Sylvana, Sie erinnern sich bestimmt an sie. Flora ist inzwischen siebzehn und gab in diesem Jahr ihr Debüt.“
„Na gut, wenn du meinst“, murmelte der Hausherr lustlos und griff zum nächsten Keks. „Sonst noch etwas oder sind wir hier fertig?“
Virginia wurde schmerzlich bewusst, dass sie noch gar nicht richtig angefangen hatte und Floras Vormund sie offensichtlich schon wieder loswerden wollte.
„Wir versprechen, Ihre wertvolle Zeit nicht allzu lange in Anspruch zu nehmen“, versicherte sie daher schnell. „Es geht darum, dass Papa bestimmt hat, dass Flora einen gewissen Mr Leonard Linton zum Gatten nehmen soll und dass sie ihm ihr Wort gegeben hat“, erklärte sie, nicht zu hundert Prozent der Wahrheit entsprechend. Doch darüber sah sie ohne schlechtes Gewissen hinweg. Sie war sich sicher, dass Flora Leo ihr Wort gegeben hätte, hätte er seine Skrupel nur rechtzeitig überwunden und sie gefragt.
„Dein Vater? Wer ist denn nun schon wieder dein Vater? Mein Gott, ist das anstrengend!“
Mit raschen Worten erinnerte Virginia ihn an ihr Verwandtschaftsverhältnis.
„Na gut, das soll mir recht sein“, meinte er schließlich und biss in das nächste Stück Shortbread. Da er sprach, während er dies tat, gesellte sich diesmal eine besonders große Anzahl Brösel zu denen, die sich bereits auf seinem vorgewölbten Bauch befanden. „Doch ich verstehe noch immer nicht, warum ich diese ermüdende Unterhaltung führen muss.“
„Herrgott noch mal!“, stieß Thommy einen Fluch aus, der Virginia dazu brachte, ein entsetztes Keuchen von sich zu geben. Warum bloß konnte sich ihr Bruder nicht wie ein wohlerzogener Fünfzehnjähriger benehmen? Musste er sich immer so vulgär ausdrücken? Wieder einmal wurde ihr bewusst, wie ungünstig es war, dass die Stallburschen die einzigen männlichen Altersgenossen waren, mit denen er Kontakt hatte. Da konnte sie tun und lassen, was sie wollte, er benahm sich zunehmend so, als wäre er einer von ihnen. Thommy gehörte nach Eton. Je eher, umso besser. Noch ein Thema, das sie mit seinem Onkel besprechen musste. Der Seufzer, der ihr entkam, entrang sich ihr aus tiefster Seele.
„Abgemacht ist abgemacht!“, setzte Thommy in wichtigem Tonfall fort. „Ein Handschlag unter Gentlemen besiegelt einen Vertrag, da stimmst du mir doch zu, Onkel Wentworth, nicht wahr?“
„Hmmm“, murmelte der Ältere, der keine Ahnung hatte, worauf sein Neffe hinauswollte und den dies auch nicht interessierte. Da inspizierte er doch lieber den Berg Shortbread, um sich das nächste, verlockendste Exemplar auszusuchen.
„Und jetzt kommt Mama plötzlich mit einem Earl of Glazebury um die Ecke“, ereiferte sich Thommy, „und zwingt Flora …“
Er schwieg abrupt, als ein Ruck durch die auf dem Lehnstuhl hingegossene, korpulente Gestalt ging.
„Glazebury?“, wiederholte Lord Bromley, und mit einem Schlag waren seine kleinen, braunen Äuglein interessiert aufgerissen. „Der Earl? Sieh mal einer an. Alle Achtung, gut gemacht, Sylvana!“
„Das ist alles, was Ihnen dazu einfällt?“, erkundigte sich Virginia fassungslos, während Thommy verdattert schwieg. Ihrer beider Hoffnung, Lord Bromley auf ihre Seite zu ziehen und ihn dazu zu bringen, die Verbindung zu untersagen, war ganz offensichtlich kläglich gescheitert.
„Nein, natürlich fällt mir mehr dazu ein“, sagte er und stemmte sich mühsam hoch, um auch an ein Stück Shortbread auf der anderen Seite des Tabletts zu gelangen. Virginia atmete auf. Vielleicht war doch noch nicht alles verloren.
„Eine verwandtschaftliche Beziehung zu einem Earl kann niemandem schaden“, setzte seine Lordschaft mit einem von der Anstrengung hochroten Kopf fort und machte damit ihre Hoffnungen gleich wieder zunichte. „Wahrlich bedauerlich, dass ich schon zu alt bin, um langfristig davon zu profitieren. Ich frage mich allerdings …“
Er biss abermals in das trockene Gebäck und weitere Brösel rieselten über seine Brust. Er wischte sie mit einer achtlosen Bewegung zu Boden. Einer der Hunde riss erschrocken die Augen auf und begann mehrmals lautstark zu niesen. Bromley beachtete ihn nicht. „Wird mir der Earl verraten, wo er seine bestickten Westen herbekommt? Die sind nämlich wahrliche Kunstwerke, das muss man frei heraus sagen.“
„Ja, aber“, versuchte Virginia einen weiteren Einwand.
„Wenn du den Namen des Schneiders nicht kennst, junge Dame, dann spar dir das Aber und lass mir meine Träume“, maulte ihr Gegenüber.
„Wenn ich verspreche, Ihnen die Adresse zu beschaffen“, wagte sie einen Vorstoß, ohne zu wissen, wie sie ihn je in die Tat umsetzen sollte, „werden Sie dann Ihre Nichte davon überzeugen …“
„Mit Sicherheit nicht!“ Bromley blies die Backen auf. „Weißt du denn nicht, wie ermüdend es ist, mit meiner Nichte auch nur zu sprechen? Ich tue es mir bestimmt nicht an, sie darüber hinaus auch noch von etwas überzeugen zu wollen. So, und nun geht, geht, ich bitte euch! Es ist höchste Zeit für einen kleinen Snack zur Mittagszeit. Und dabei seid ihr de trop.“
„Leonard Linton vertraut darauf, dass es uns gelingt, dich auf unsere Seite zu ziehen, Onkel Wentworth, und ich denke nicht daran, mit leeren Händen nach Hause zu kommen!“, meldete sich wieder Thommy zu Wort. Er schob trotzig das Kinn vor, als könnte er damit irgendjemanden beeindrucken.
„Wer hat denn dich gefragt, Junge?“, lautete da auch schon die gelangweilte Gegenfrage. „Wieso bist du überhaupt hier? Sollte ein junger Hüpfer wie du nicht in der Schule sein?“
„Danke, dass Sie das erwähnen“, griff Virginia dieses Stichwort freudig auf. Wenn sie schon in Floras Angelegenheit gescheitert war, dann wollte sie zumindest in der von Thommy erfolgreich sein. „Sie haben ja so recht, Sir. Thommy gehört nach Eton, und zwar so schnell wie möglich.“
„Na, dann soll er doch gehen“, meinte der Hausherr alles andere als interessiert. „Und nun seid ihr es, die hier gehen sollen, denn …“
„Heißt das, dass Sie ihn dort anmelden werden? Umgehend?“, wollte Virginia begierig wissen. Mehr als ein Jahr zu spät, ergänzte sie in ihrem Inneren.
„Ich?“, fuhr der Alte auf. „Wieso denn ich? Was habe denn ich damit zu tun?“
„Sie sind sein Vormund, Sir“, erinnerte ihn Virginia. Es fiel ihr zunehmend schwer, die Contenance zu bewahren. Es war so frustrierend, den Mann ständig auf etwas hinzuweisen, was er ohnehin wusste oder zumindest hätte wissen müssen, wenn er sein Gehirn auch nur ein wenig angestrengt hätte. Sie sah streng zu Thommy hinüber, um ihm zu signalisieren, er solle nicht wieder eine ungestüme Äußerung hören lassen, die seinen Onkel noch mehr verärgern und ihm damit ein Schlupfloch bieten würde, ihrem Begehr eine Absage zu erteilen.
Wenig erstaunlich brauchte der Alte kein solches Schlupfloch.
„Diese Mühen, diese Plagen!“ Mit einer theatralischen Geste strich er sich mit dem Handrücken über die Stirn. „Man kann doch von einem Gentleman meines Standes nicht verlangen …“
„Ich würde alles vorbereiten und in die Wege leiten, Sir. Sie bräuchten nur zu unterschreiben“, beeilte sich Virginia das Angebot zu wiederholen, das sie ihm bereits seit zwei Jahren in regelmäßigen Abständen brieflich machte.
„Ja, will er denn überhaupt dorthin?“, fragte der Alte, den Thommys Meinung bisher noch nie interessiert hatte.
„Ja, eigentlich schon“, stammelte der, von der Frage völlig überrumpelt. „Allerdings kenne ich dort niemanden und …“
„Na, siehst du.“ Die Patschhand des Älteren knallte auf einen seiner elfenbeinfarbenen Oberschenkel. „Er kennt dort niemanden. Also was soll er dort? Die Sache ist erledigt. Und nun, Mädchen, zieh am Klingelstrang. Der Butler soll euch hinausbegleiten.“
Genau in dem Augenblick, als Virginia und Thommy bitteren Herzens das Haus ihres Onkels verließen, um als Nächstes bei Lady Sylvana persönlich ihr Glück zu versuchen, stand Mr Oscar Bradford rechts vor dem Altar der prachtvoll geschmückten Kirche St. George am Hanover Square. Im Gegensatz zu den ihm unbekannten Geschwistern war sein Herz froh, denn er wurde Zeuge, wie seine Exzellenz, der Erzbischof von Canterbury, höchstpersönlich seinen Freund Reginald Ashbourne und Lady Amerina Windham, Duchesse of Warminster, geborene Contessa di Monteviale, zu Mann und Frau erklärte.
Kapitel 4
Am Ortsrand von Hampstead, etwa zwei Meilen vom Haus von Mr Oscar Bradford entferntAm Vorabend der Entführung
Man konnte dem alten Earl of Glazebury ohne Zweifel vieles vorwerfen, nicht jedoch, dass er beim Brand der Stallungen seines Großneffen die Finger im Spiel gehabt hätte. Das Feuer war, wie Oscars Stallmeister mit Erfahrung und Sachverstand am darauffolgenden Tag feststellte, viel eher auf die unsachgemäße Lagerung von Heu zurückzuführen gewesen. Dieses war, entgegen seinem ausdrücklichen Befehl, von zwei der Stallburschen zu bald nach der Mahd in die hintere Ecke des Stalls gebracht worden. Es war noch viel zu feucht, um schon in Haufen eingelagert werden zu dürfen, und hatte sich selbst entzündet.
„Hör auf, seine Lordschaft zu verdächtigen“, war der Stallmeister es dann auch, der William in die Schranken wies. „Gar nichts hast du gesehen! Weder eine weinrote Jacke noch eine weiß gepuderte Perücke. Mr Bradford wird entscheiden, was mit dir geschieht. In deinem eigenen Interesse kann ich dir nur raten, steh zu deinen Fehlern und hör auf, von deinem Versagen abzulenken, indem du seiner Lordschaft die Schuld in die Schuhe schiebst.“
Während der Brand also wütete, hatte der alte Earl of Glazebury etwa zwei Meilen vom Schauplatz entfernt ganz gemütlich im überladenen Wohnzimmer seines Freundes Viscount Hanningfield gesessen und hatte dessen Dienerschaft mit Sonderwünschen schikaniert. Der Viscount war für ein paar Tage zu einem Verwandtenbesuch nach Dover aufgebrochen, und da er das Haus nicht gern allein ließ, hatte er den Earl gebeten, für ein paar Tage nach dem Rechten zu sehen. An diesem Vormittag war er wieder zurückgekehrt und nun spielten die beiden mit zwei weiteren Gentlemen, mit denen sie sich jede Woche trafen, bereits die dritte Partie Whist. Als diese zu Ende war, standen die beiden anderen Herren bereits zum dritten Mal als Sieger fest.
„Was ist denn heute mit euch beiden los?“, erkundigte sich Emmet Walsh bei seinem Gastgeber und dem Earl, während er die Karten zu einem Stoß zusammenschob. „Wo seid ihr bloß mit euren Gedanken?“ Als keine Antwort kam, setzte er nach: „Du warst doch bei deiner Schwester in Dover, Hanningfield. Geht es ihr nicht gut? Machst du dir Sorgen um sie?“
„Ach was, meine Schwester! Nein, nein, mit der ist alles in bester Ordnung und mit ihrer Familie auch“, beeilte sich der so Angesprochene zu versichern. Daraufhin wurde es offensichtlich, dass er damit rang, ob er seine Freunde in das Thema einweihen sollte, das ihn tatsächlich beschäftigte. „Meine Gedanken kreisen um etwas ganz anderes.“
Der Earl of Glazebury hatte seinen Freunden, wie so oft, nicht zugehört.
„Kann eine Frau mit Mitte dreißig eigentlich noch ein Kind gebären?“, wechselte er nun so abrupt das Thema, dass die anderen, die eben Näheres vom Viscount hatten erfahren wollen, ihm fassungslos das Gesicht zuwandten. Was war denn das für eine schockierende Frage? So ein pikantes Thema war doch für einen seriösen Herrenabend völlig unpassend. Aber das war dem Alten natürlich wieder einmal egal. Die Lippen gespitzt, blickte er mit wachen Augen in die Runde. Wie stets trug er eine nur schlampig gepuderte altmodische Perücke, deren dichte graue Locken ihm in den Nacken rieselten. Mit der schwarzen, glänzenden Kniebundhose und der weinroten Samtjacke mit großen, silbernen Knöpfen wirkte er wie ein Besucher aus dem vergangenen Jahrhundert. Selbstverständlich trug er auch an diesem Abend wieder eine seiner reichlich bestickten Westen. Diesmal waren es bunte Vögel und Blätter in den Farben des Herbstes, die sie zierten. Das Schönheitspflaster auf dem rechten Wangenknochen rückte sein ohnehin schon ungewöhnliches Erscheinungsbild geradezu ins Groteske. Der Unterschied zu den anderen, dem Landleben entsprechend in gedeckte Farben und Tweed gekleideten Gentlemen hätte nicht größer sein können.
„Wie meinen?“, erkundigte sich Emmet Walsh verwirrt, während Walter Croxton, der Vierte im Bunde, „Gewiss kann sie das!“ ausrief. „Dem alten Warminster ist es schließlich auch gelungen, die römische Gräfin zu schwängern, bevor er das Zeitliche gesegnet hat. Die Frau war, dem Vernehmen nach, bereits Ende zwanzig, als sie seinen Sohn auf die Welt brachte. Ob Ende zwanzig oder Anfang dreißig, das wird wohl kaum einen Unterschied machen.“
„Um auf meinen Aufenthalt in Dover zurückzukommen …“ Mit einem Mal konnte es der Hausherr gar nicht mehr erwarten, nun doch über seine eigenen Erlebnisse zu berichten.
Und wieder beachtete ihn der Earl of Glazebury nicht.
„Gut, dass du Warminster ansprichst, Croxton“, sagte er stattdessen. „Was für ein Teufelskerl! Wer könnte besser zum Vorbild taugen als er? Abgesehen von seinem Tod natürlich. Aber war es nicht ein verdammtes Meisterstück, wie er Ashbourne, seinem unguten Erben, die Tour vermasselt hat? Ein Meisterstück!“ Er wedelte mit seinen Händen wie ein fahriger Dirigent in der Luft herum, was seine gestärkten Spitzenmanschetten zum Rascheln brachte.
„Nun, letzten Endes hat ihm aber auch dieses Meisterstück, wie du es nennst, nichts genützt“, meinte Walsh trocken. „Ashbourne wird in Kürze trotz alledem vom Prinzregenten zum Duke ernannt werden. Daher …“
„Du lieber Himmel“, rief Glazebury aus und die Spitzen an seinen dünnen, bläulich gefärbten Handgelenken raschelten ein weiteres Mal. „Jetzt sei doch nicht so schrecklich enervierend! Es ist mir piepegal, wen der dicke Prinny zum Duke ernennt.“ Diese Worte waren weder respektvoll noch logisch, aber das war nichts, was ihm auffiel oder was die anderen verwunderte. Und selbst wenn es ihm aufgefallen wäre, hätte er es nicht weiter beachtet. „Es geht darum, dass ich, ich, ich …“, sein langer, knöchriger Zeigefinger tippte im selben Rhythmus, in dem die Worte aus seinem Mund kamen, auf die eigene Brust, „einen Erben brauche. Also spiele ich ernsthaft mit dem Gedanken, mich zu verheiraten. Das wüsstest du, Emmet, wenn du mir endlich einmal ordentlich zuhören würdest.“
Walsh schwieg beleidigt und fragte sich, nicht zum ersten Mal, warum sie es sich eigentlich immer noch antaten, den Earl in ihrer Runde zu dulden. Allerdings fiel ihm beim besten Willen nicht ein, wer ihn ersetzen könnte, und sie brauchten nun mal einen Vierten für das Kartenspiel. Also kniff er die Lippen zusammen.
„Du willst heiraten?“, erkundigte sich Croxton. „Tatsächlich? Auf deine alten Tage? Wer ist denn die … wie soll ich sagen? Glückliche erscheint mir in diesem Zusammenhang nicht unbedingt passend.“
Walsh war über die offenen Worte seines Freundes so erfreut, dass er laut auflachte, was ihm einen weiteren bösen Blick des Earls eintrug.
„Ich habe mich noch nicht entschieden“, sagte dieser dann. „Entweder nehme ich die Witwe eines Baronets, Name tut hier nichts zur Sache. Sie ist Anfang oder Mitte dreißig, wohlversorgt, aber nicht allzu reich. Oder ich entscheide mich für ihre Tochter, sechzehn oder siebzehn oder so, die aufgrund einer erblichen Verfügung nach der Hochzeit vor Geld stinken wird.“
„Was gibt es da zu rätseln?“, fuhr Croxton auf. „Natürlich nimmst du die Jüngere. Stinkreich ist der Trumpf in diesem Spiel und Kinder bekommen kann die Jüngere in ihrem Alter allemal.“
„Hast du den Verstand verloren, mein Freund?“ Walsh starrte ihn mit großen Augen an. „Was soll er denn mit einem so jungen Ding? In seinem Alter? Er könnte der Großvater, was sage ich, der Urgroßvater des Mädchens sein! Das widerspricht doch nicht nur dem Hausverstand, das widerspricht allen guten Sitten. Für Glazebury ist selbst die Mutter noch zu jung.“
„Damit ist es entschieden“, rief der Alte, gackerte bösartig und schlug mit beiden Handflächen auf die Tischplatte. „Wenn unser guter Emmet hier mir so inständig davon abrät, dann nehme ich selbstverständlich die Jüngere!“
Während Walsh nach Luft schnappte, wandte sich Glazebury seelenruhig an den Gastgeber: „Warum erzählst du denn nicht endlich, was dir da in Dover passiert ist, Hanningfield? Es ist kein guter Stil, mit etwas zu beginnen und dann nicht fertig zu reden.“
Nun war also der Herr des Hauses dran, sich über den Earl zu ärgern. Währenddessen plusterte Walsh die Backen auf: „Was bist du doch für ein unmöglicher Mensch, Glazebury! Frag mich in Zukunft nie mehr um meine Meinung, wenn es dir dann so großes Vergnügen bereitet, anschließend das Gegenteil zu tun!“
„Nachdenken, Emmet!“, befahl der Earl und wedelte wieder mit den Armen durch die Luft. „Nachdenken! Wie könnte ich mich für das Gegenteil entscheiden, wenn ich deine Meinung nicht vorab wüsste?“