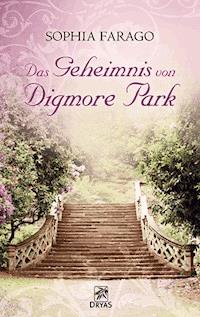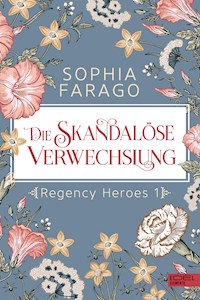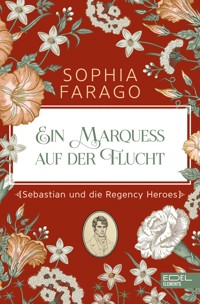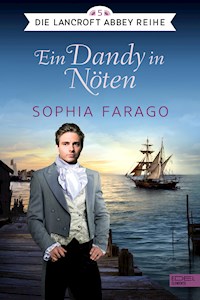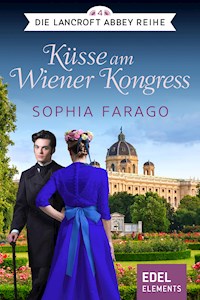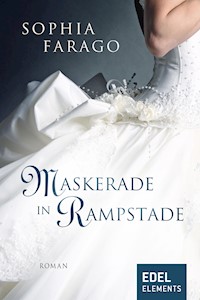
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Edel Elements - ein Verlag der Edel Verlagsgruppe
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein hinreißend romantischer Regency-Roman – von der Autorin des Bestsellers "Die Braut des Herzogs"! Die selbstbewusste Sophia Matthews folgt nur zu gerne der Bitte von George Willowby, ihrem Freund aus Kindertagen, sich auf Rampstade Palace, wo seine furchtgebietende Großmutter residiert, mit ihm zu treffen. Allerdings scheint schon die Anreise unter keinem guten Stern zu stehen - Sophias Kutsche hat eine Panne, die sie zwingt, das nächste Wirtshaus aufzusuchen - wie sich herausstellt eine üble Räuberhöhle. Ein faszinierender Fremder, den sie dort kennenlernt, bringt sie sicher zum nächstgelegenen Herrensitz. Schade nur, dass dieser Jojo, wie er sich nennt, trotz seiner eher gewählten Ausdrucksweise ganz offensichtlich ein Anführer des Gesindels aus dem Wirtshaus ist, vermutlich ein auf die schiefe Bahn geratener Adeliger. Schließlich doch noch auf Rampstade Palace angelangt, muß Sophia dann entdecken, dass der charmante Luftikus George ihr nicht etwa, wie sie angenommen hatte, einen ernstgemeinten Heiratsantrag machen will, sondern sie vielmehr – ungefragt – zum Schein als seine Verlobte ausgegeben hat, damit seine Chancen steigen, statt seines mustergültigen Vetters vom Nachbargut im Testament der Herzoginwitwe bedacht zu werden. Und zu allem Überfluß kann Sophia Jojo einfach nicht vergessen. So kommt es, dass sie sich nicht nur mit einem Scheinverlobten und dessen ihr unbekannten, aber wenig sympathischen Vetter herumzuschlagen hat, sondern auch noch dem galanten Räuberhauptmann helfen, wieder auf den Pfad der Tugend zurückzufinden …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 331
Veröffentlichungsjahr: 2013
Sammlungen
Ähnliche
Sophia Farago
Maskerade in Rampstade
Roman
Edel Elements
Copyright dieser Ausgabe © 2013 by Edel Elements, einem Verlag der Edel Germany GmbH, Hamburg.
Copyright © 1993 by Sophia Farago
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Michael Meller Literary Agency GmbH, München.
Covergestaltung: Agentur bürosüd°, München
Konvertierung: Datagrafix
Alle Rechte vorbehalten. All rights reserved. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des jeweiligen Rechteinhabers wiedergegeben werden.
ISBN: 978-3-95530-104-0
edel.comfacebook.com/edel.ebooks
Inhalt
Kapitel I
Kapitel II
Kapitel III
Kapitel IV
Kapitel V
Kapitel VI
Kapitel VII
Kapitel VIII
Kapitel IX
Kapitel X
Kapitel XI
Kapitel XII
Kapitel XIII
Kapitel XIV
Kapitel XV
Kapitel XVI
Kapitel XVII
Kapitel XVIII
Kapitel XIX
I.
Als ich das Gasthaus durch die niedrige Türöffnung betrat, wußte ich bereits, daß ich dabei war, eine große Dummheit zu begehen. Was aber wäre mir anderes übriggeblieben? Draußen, kaum eine Meile von hier entfernt, lag unsere altersschwache Kutsche umgekippt im Straßengraben.
Harry, der Kutscher, hatte sich bei diesem Unfall so unglücklich am Kopf verletzt, daß er nun bewußtlos auf dem aufgeweichten Boden des Weges lag. Ich hatte endlos scheinende Minuten damit zugebracht, die Pferde zu beruhigen und sie daran zu hindern, mitsamt der Kutsche durchzugehen. Es war mir gelungen, die Pferde auszuspannen und an zwei Bäumen in der Nähe festzubinden.
Hinzu kam, daß Mally, meine alte Kinderfrau, die mich auf meiner Reise begleitete, wie ein aufgescheuchtes Huhn hin und her gelaufen war, und dabei verzweifelt die Hände über dem Kopf zusammenschlug. Dabei hatte sie mit weinerlicher Miene, immer und immer wieder, unser Mißgeschick beklagt: »Ich habe es gewußt, Miss Sophia. Wir hätten nicht so überstürzt abreisen dürfen. Wir hätten niemals in diese altersschwache Rumpelkiste steigen dürfen, ohne einen starken Mann als Begleiter! Habe ich nicht prophezeit, daß das nicht gutgehen wird? Habe ich Sie nicht angefleht, das Angebot von Mr. Stinford anzunehmen? Ja, wenn er jetzt hier wäre, er wüßte genau, was zu tun ist. Ach, hätte ich mich bloß nicht überreden lassen. Wären wir doch …«
Ich hatte ihr Gezeter unwillig unterbrochen und mit mehr Selbstvertrauen, als ich tatsächlich empfand, verkündet: »Ich weiß auch genau, was zu tun ist, Mally. Also bitte beruhige dich doch. Am besten wäre es, wenn du ein Kissen aus der Kutsche holst, um es unter Harrys Kopf zu legen. Und nimm bitte auch gleich eine Decke mit, damit der arme Kerl nicht zu sehr friert.«
Niemals hätte ich zugegeben, daß es mir in der unangenehmen Lage, in der wir uns befanden, gar nicht so unangenehm gewesen wäre, wenn ich Edward Stinfords Begleitung doch nicht so brüsk abgelehnt hätte. Sicher hätte er das Ruder längst in die Hand genommen und eine Hilfstruppe organisiert, während ich nichts anderes zu tun gehabt hätte, als mich auf einen Baumstrunk zu setzen und meine Hände untätig in den Schoß zu legen.
Ja, er war wirklich ein tüchtiger Mann und so gewohnt, alles in seinem Sinne zu erledigen. Eine bewundernswerte Eigenschaft, gewiß. Doch genau das war auch der Grund, warum ich keinen von Edwards Heiratsanträgen je annehmen würde. Ich hatte schließlich meinen eigenen Kopf und war es gewohnt, selbständig Entscheidungen zu treffen. Energisch straffte ich die Schultern. Zum Teufel mit Edward Stinford! Ich würde auch alleine mit dieser Situation fertig werden.
»Hast du das Gasthaus gesehen, an dem wir vor wenigen Minuten vorbeigefahren sind?« fragte ich Mally, die sich eben unter Stöhnen niedergekniet hatte, um das Kissen, das sie aus der Kutsche geholt hatte, dem Bewußtlosen unter den Kopf zu schieben.
»Ich werde dorthin zurückgehen und den Wirt ersuchen, ein paar Burschen zu schicken, die die Kutsche wieder auf die Räder stellen. Vielleicht kann ich auch einen Schmied auftreiben, der sich die Räder ansieht. Auf jeden Fall werde ich für uns Zimmer mieten, denn, wie es aussieht, werden wir heute nicht mehr weit kommen.« Ich reichte meiner Begleiterin die Hand, während sie sich mühevoll erhob, und versuchte ein zuversichtliches Lächeln.
Da kam auch schon der erwartete entrüstete Widerspruch: »Nie und nimmer!« schnaufte sie mühsam. »Nie und nimmer werde ich Ihnen gestatten, allein ein Gasthaus zu betreten! Daß Sie überhaupt auf einen derartigen Gedanken kommen, Miss Sophia, ist schon eine Schande.« Sie schüttelte vielsagend den Kopf.
Ob ich Mally bitten sollte, mich zu begleiten? Es wäre wirklich angenehmer, nicht allein in ein gewöhnliches Gasthaus zu gehen. Auch wenn ich in ihrer Begleitung nur wesentlich langsamer vorankäme. Aber da war ja noch Harry, und zudem konnten wir die Kutsche keinesfalls unbeaufsichtigt lassen.
»Und dann erst der weite Weg!« fuhr Mally fort. »Ich habe Ihnen doch von dem Gesindel erzählt, das die arme Mrs. Malik überfiel, gerade als sie der kranken Frau des Pfarrers von Exeter ihre berühmte Taubenpastete bringen wollte?«
»Ja, das hast du«, bestätigte ich. »Aber bis Exeter sind es mehr als zweihundert Meilen, und ich glaube nicht, daß sich die Straßenräuber auf einen derart weiten Weg gemacht haben, nur um mich hier zu überfallen.«
Mally schnaubte ungehalten. »Unsinn. Sie wissen genau, was ich meine! Und hat nicht auch der nette junge Bursche, mit dem wir beim letzten Pferdewechsel gesprochen haben, gesagt, daß es hier von Straßenräubern nur so wimmelt.«
»Das hat er allerdings«, gab ich zu, »aber wer weiß denn schon, ob er die Wahrheit gesagt hat. Schließlich war er es auch, der uns diesen Weg gezeigt hat, als Harry ihn nach einer geeigneten Abkürzung fragte. Er versprach, die Straße sei in gutem Zustand. Und, stimmt das etwa?«
Diesen Einwand ließ Mally nicht gelten. »Gerade weil die Straße so abgelegen ist und keiner außer uns so verrückt ist, sie zu befahren, kann ich es nicht zulassen, daß Sie sich auf den Weg machen.«
»Siehst du jemand anderen, der das tun könnte?« fragte ich betont ungehalten, um meine eigenen Bedenken zu überspielen. »Du kannst mich unmöglich begleiten. Wir dürfen den armen Harry nicht allein zurücklassen. Und auch die Kutsche muß bewacht werden. Vielleicht suchst du dir schon einmal einen geeigneten Prügel, damit du dich im Notfall verteidigen kannst.«
Eigentlich hätte meine letzte Bemerkung scherzhaft sein sollen. Doch sie veranlaßte Mally, die Äste am Waldesrand einer näheren Begutachtung zu unterziehen. Es schien, als habe sie meinen Argumenten nichts mehr entgegenzuhalten. So machte ich mich auf den Weg.
»Mach dir keine Sorgen, Mally!« rief ich über die Schulter hinweg zurück. »Ich kehre in Kürze mit einigen Burschen zurück. Und dann können wir in Ruhe überlegen, wie es weitergehen soll!«
Für meinen Weg zum Gasthaus brauchte ich erheblich mehr Zeit, als ich angenommen hatte. Die Straße war durch die Regenfälle der letzten Tage aufgeweicht, der Boden schwer. Ich mußte meine Röcke ein gutes Stück anheben, um sie davor zu bewahren, durch Kot und Lehm unrettbar durchweicht und verschmutzt zu werden. Zudem trug ich keine geeigneten Schuhe, und die Nässe drang ungehindert in meine Lederstiefelchen ein. Mein Hauptproblem war jedoch der glitschige Boden. Ich mußte meine ganze Aufmerksamkeit darauf verwenden, nicht auszurutschen und der Länge nach in den Schmutz zu fallen. Dennoch warf ich immer wieder verstohlene Blicke zu den ausgedehnten, dichten Wäldern rechts und links der Straße. Zum Glück hatte es gegen Mittag zu regnen aufgehört. Nun drangen sogar ein paar Sonnenstrahlen durch die aufgelockerte Wolkendecke. Die Sonne stand jedoch schon beängstigend tief. Bald würde die Dämmerung hereinbrechen. Bis zur völligen Dunkelheit mußte ich die Kutsche und meine Begleiter in Sicherheit gebracht haben. Energisch beschleunigte ich meinen Schritt
Da – plötzlich begann mein Herz wie wild zu rasen. War das nicht ein Mann, der hinter einem dichten Ginsterbusch geduckt lauerte? Ich zwang mich ruhig durchzuatmen, die Stelle genau im Auge zu behalten, während ich langsam darauf zuging. Nichts bewegte sich. Kein anderer Laut war zu hören als jenes eigenartige Quietschen, das immer dann entstand, wenn ich einen Fuß aus dem weichen, lehmigen Morast zog. Dieses Geräusch kam mir mit einem Mal unnatürlich laut vor. Ich spürte, wie meine Hände unangenehm feucht wurden. Doch nichts geschah. Als ich näher kam, erkannte ich, daß es ein umgestürzter Baumstamm war, der mich in die Irre geführt hatte. Erleichtert atmete ich auf. Mally mit ihren ewigen Räubergeschichten! Sie hatte während unserer gesamten Reise oft von Straßenräubern gesprochen. Hatte sich all die Fälle in Erinnerung gerufen, die ihr durch Bekannte zugetragen worden waren, und hatte nicht das kleinste Detail der Greueltaten ausgelassen, die die bedauernswerten Überfallenen erleiden mußten. Ich hatte, sehr zu ihrem Mißvergnügen, die Erzählungen nicht mit dem gewünschten Ernst gewürdigt – und doch merkte ich jetzt, daß sie Wirkung zeigten. Je länger ich ging, je weiter ich mich von meinen Begleitern entfernte, desto unheimlicher war mir zumute. Ja, fast erwartete ich wirklich, daß plötzlich ein Reiter, hoch auf einem schwarzen Roß, ein Gewehr im Anschlag, zwischen zwei Bäumen hervorgeprescht käme. Da machte der Weg eine Biegung – und ich erblickte unverhofft das Gasthaus vor mir.
Im Vorbeifahren war mir das Haus zwar aufgefallen, und ich hatte es auf Grund des Schildes auch richtig als Gasthaus erkannt. Aber ich hatte nicht auf seinen Zustand geachtet. Beim Näherkommen bemerkte ich nun, daß es einen ungewohnt ruhigen, ja geradezu unbewohnten Eindruck machte. Obwohl es nun schon merklich dämmerte, war, zumindest in den zur Straße liegenden Räumen, kein Licht angezündet worden. Kein Rauch aus dem Kamin verkündete einladend, daß die Wirtin in der Küche dabei war, ein warmes Mahl für späte Gäste zu richten. Das Haus erschien zudem zwar nicht gerade verwahrlost, so doch wenig vertrauenerweckend. Es war fast völlig von Efeu überwachsen. Die mit Blei gefaßten kleinen Fensterscheiben waren beinahe blind. Die morsche Eingangstür stand offen und knarrte in ihren verrosteten Angeln. Auch das Wirtshausschild quietschte bei jedem Luftzug. »Zu den drei Bettlern« war darauf zu lesen. Und das Bild, das drei kaum mehr erkennbare zerlumpte Gestalten zeigte, wirkte auch nicht eben einladend. Ich blickte mich noch einmal um, ob es nicht doch ein menschliches Wesen gäbe, das mir helfen könnte und das mir den Weg in das Gasthaus ersparen würde. Aber es war niemand zu sehen.
Also trat ich durch den niederen Türstock in die düstere Schankstube. Ich sah mich um, und mein mulmiges Gefühl verstärkte sich, als ich sie völlig verlassen vorfand. Ich nahm all meinen Mut zusammen und rief nach dem Wirt. Hörte mich denn niemand? Jedenfalls erschien auf mein Rufen nur ein Hund. Ein Mischling nicht näher erkennbarer Rasse, der mich mit tränenden Augen musterte. Dann trottete er gemächlich näher und beschnupperte mich eingehend. Ich schien ihm vertrauenswürdig zu sein, denn er legte sich zu meinen Füßen und erwartete sichtlich, von mir gestreichelt zu werden.
»Na, wo ist denn dein Herr?« fragte ich ihn, während ich mich hinabbeugte, um seinen Kopf zu tätscheln.
Da vernahm ich plötzlich ein lautes Lachen. Ich fuhr auf und stellte fest, daß Stimmen und Gelächter durch eine verschlossene Türe an der Stirnseite des Schankraumes drangen. Das Haus war also doch nicht völlig verlassen. Vielleicht hatte ich mit meinem Anliegen zu guter Letzt doch noch Glück. Ohne lange nachzudenken, durchquerte ich den Raum und drückte die Klinke der Tür zum Hinterzimmer herunter.
II.
Als ich eintrat, brach jedes Gespräch jäh ab. Unzählige Augen schienen auf mich gerichtet zu sein. Bei genauerem Hinsehen erkannte ich, daß es fünf Männer waren, die da rund um einen roh gezimmerten Eßtisch zusammensaßen. Sie dürften gerade eine lebhafte Unterhaltung geführt haben, bevor ich sie gestört hatte. Nun starrten sie mich schweigend, mit unverhohlenem Mißtrauen an. Zuerst fielen mir ihre Gesichter auf. Wettergegerbte, unrasierte, verschmutzte Gesichter. Und dann bemerkte ich die abgetragene Kleidung, die mir sonderbar dunkel erschien, als ob sie mit Absicht ihren Träger möglichst unauffällig erscheinen lassen solle. Um ihm zu ermöglichen, sich in den Wäldern zu verstecken, ohne von jemandem gesehen zu werden?
O Gott, fuhr es mir durch den Kopf. Kein Wunder, daß mir auf dem Weg keine Straßenräuber begegnet waren. Sie saßen alle hier beisammen, und ich war mitten in ihr Quartier geraten. Mühsam unterdrückte ich den Impuls, kehrtzumachen und in blinder Hast aus dem Gasthaus zu laufen. Mein Verstand sagte mir, daß das ein sinnloses Unterfangen wäre. Man hätte mich schnell eingeholt, lange bevor ich Harry und Mally erreicht hätte. Und auch die beiden hätten mir nicht helfen können. Nein, ich mußte ruhig und überlegt handeln. Vielleicht konnte ich sie damit beeindrucken, daß ich mich kühl und unerschrocken gab?
»Guten Tag, meine Herren«, begann ich in einem, wie ich hoffte, Ehrfurcht einflößenden Tonfall. »Würden Sie mir bitte sagen, wo ich hier den Wirt finde?«
Der Mann, der der Türe am nächsten saß, ein junger, ernsthafter Bursche mit einem beängstigend muskulösen Oberkörper, stand auf und blickte mit verkniffenen Augen auf mich herab. Es schien, als wolle er etwas antworten, wurde aber, ebenso wie ich, davon überrascht, daß ein älterer Mann, der auf der Bank an der Längsseite des Tisches lümmelte, damit begann, meine Worte zu wiederholen: »Guten Tag, meine Herren!« meckerte er mit verstellter Stimme, die wohl meine nachahmen sollte. »Guten Tag, meine Herren!«
Ich verlor beinahe die Fassung. Was hatte dieses seltsame Verhalten zu bedeuten?
»Ach, halt’s Maul, du Esel!« murrte der Mann, der aufgestanden war, ungeduldig und wandte sich dann an mich: »Beachten Sie ihn gar nicht. Der Alte ist besoffen wie eine Auster. Ich weiß auch nicht, warum wir den überhaupt mitgenommen haben. Er wird uns noch die ganze Tour vermasseln.«
»Guten Tag, meine Herren!« wiederholte der Alte unbeeindruckt.
»So gib ihm doch endlich eine aufs Maul, Jeff!« brüllte der Mann neben mir. Jeff war vermutlich der kleine Bursche mit dem breitkrempigen, speckigen Hut, der neben dem alten Mann auf der Bank saß. Er hielt sich zwar nicht genau an den Befehl, doch schlug er dem Alten so heftig mit der flachen Hand auf den Rücken, daß dieser das Nachäffen bleiben ließ und, nach einem lauten Rülpsen, in dumpfes Brüten versank.
Ein Blick auf den Tisch überzeugte mich, daß auch die anderen Anwesenden kräftig dem Alkohol zugesprochen hatten. Zahlreiche Krüge standen auf der ungehobelten Tischplatte, halbvolle Flaschen, zum Teil verschüttete Gläser. So war es nicht verwunderlich, daß keiner mehr nüchtern zu sein schien.
»Sagten Sie wirklich, daß Sie den Wirt suchen?« fragte der große Mann neben mir. Da meldete sich der Kleine zu Wort, der Jeff genannt wurde.
»Glaub ihr kein Wort, Sam«, sagte er.
»Sie suchen also den Wirt«, wiederholte der große Sam, ohne auf Jeff zu achten. »Wissen Sie, das erscheint uns doch ein wenig seltsam.« Nachdenklich kratzte er sich am Hinterkopf.
»Was soll daran seltsam sein?« fuhr ich ihn an. Mir schien vielmehr das Verhalten dieser Männer seltsam.
»Und Sie wissen wirklich nicht, wo er ist, der Wirt, meine ich?« wollte Sam wissen.
»Kann nicht sein, daß sie den Wirt sucht«, meinte nun der, der an der Stirnseite des Tisches saß. Er blickte dabei gedankenverloren in sein Glas, während er langsam das dunkle Getränk, das sich darin befand, von einer auf die andere Seite schwappen ließ. »Kann gar nicht den Wirt suchen, wenn du mich fragst. Jeder weiß doch, daß …«
In diesem Moment wurde er durch seinen Sitznachbarn unterbrochen, der sich plötzlich erhob. Er war vermutlich zu betrunken, um dem eigenartigen Gespräch zu folgen, das da in dem kalten Hinterzimmer im Gange war. Nun schien er sich jedoch plötzlich an gewisse Formen von Höflichkeit zu erinnern. Jedenfalls sprang er auf, verbeugte sich, soweit er dazu in der Lage war, und murmelte, von heftigem Schluckauf begleitet: »John Finch, Mylady. Immer zu Ihren Diensten.«
Dann versagten ihm die Knie, und er sank zurück auf die Holzbank, wobei sein kahler Schädel auf der Tischplatte aufschlug. Dieser Schmerz schien ihm den Rest zu geben. Er blieb so liegen, wie er hingefallen war, und rührte sich fortan nicht mehr. Von dieser seltsamen Vorstellung belustigt, wurde ich für kurze Zeit von der Gefahr abgelenkt, in der ich mich befand. Doch dieses Bewußtsein kehrte schlagartig zurück, als der Mann, der an der Stirnseite saß, an Sam die Frage richtete: »Was sollen wir mit ihr tun?«
»Ich glaube, zuerst müssen wir sie einmal ausfragen«, beschloß Sam. »Dann wird uns sicher etwas einfallen.«
Hilfesuchend blickte ich mich um. Da fiel mein Blick auf eine Bank an der gegenüberliegenden Wand. Dort saß ein Bursche, die angewinkelten Beine auf die Sitzfläche gestellt, im schwachen Schein der untergehenden Sonne, die fahl durch ein Fenster über seinem Kopf in den Raum drang. Er hatte ein Buch auf den Knien und schien völlig darin vertieft zu sein. Er tat, als würden ihn die Geschehnisse um ihn nicht interessieren. Und doch hatte ich das Gefühl, daß er genau zuhörte, was sich Sam und der Mann an der Stirnseite zu sagen hatten. So als habe er meinen Blick gespürt, hob er nun seinen Kopf, und ich begegnete seinem klaren, offenen Blick. Als einziger der Männer im Raum machte dieser Bursche einen gepflegten Eindruck. Zwar war auch seine Kleidung nicht fleckenlos sauber und zudem reichlich verknittert, als habe der Bursche den ganzen Tag im Sattel zugebracht. Und doch hob er sich wohltuend von den anderen Gestalten ab. Hätte ich ihn nicht hier in dieser Räuberhöhle angetroffen, so hätte ich ihn vermutlich für den Reitknecht eines vornehmen Gutes gehalten.
»Wenn Sie sich dort drüben hinsetzen wollen, Miss«, unterbrach Sam meine Gedanken und wies auf einen freien Stuhl, der direkt neben dem zweiten Fenster an der Stirnseite des Tisches stand. »Wir möchten uns mit Ihnen unterhalten.«
Ich hatte nicht vor, den beruhigenderen Platz direkt neben der Eingangstüre zu verlassen, um mich inmitten der Männer niederzusetzen. Und überhaupt: Ich wollte Hilfe für die verunglückte Kutsche finden. Es blieb nur mehr wenig Zeit bis zum Hereinbrechen der Dunkelheit, und diese wollte ich keinesfalls damit vergeuden, irgendwelchen Schwachsinnigen unnötige Fragen zu beantworten. Ich beschloß, daß Angriff die beste Art der Verteidigung war: »Wenn Sie mir nicht weiterhelfen können, werde ich den Wirt eben selbst suchen.«
Mit diesen Worten wollte ich mich abwenden und das Zimmer verlassen, doch Sam war schneller.
»Nicht so hastig, Miss«, sagte er, und sein fester Griff umschloß schmerzlich meinen Oberarm. »Wir sind noch nicht fertig. Wenn Sie also dort drüben Platz nehmen wollen …«
Er wies abermals auf den freien Stuhl. Der Bursche auf der gegenüberliegenden Bank hatte bei diesen Worten den Blick gehoben und runzelte die Stirn, als er Sams Pranke auf meinem Oberarm sah. Seltsamerweise ließ mich dieser daraufhin umgehend los, worauf sich der junge Mann wieder in sein Buch vertiefte. Die Anwesenheit dieses Burschen wirkte beruhigend. Ich hatte das Gefühl, als könnte mir nichts passieren, solange er im Zimmer war.
So fügte ich mich also Sams Befehl. Bevor ich mich setzte, fiel mein Blick durch die Scheiben des kleinen Fensters, und ich sah hinter dem Haus eine Vollblutstute stehen, die mit Sicherheit noch nicht dort gestanden war, als ich das Gasthaus betreten hatte. Das Pferd war aufgezäumt und gesattelt. Hoffnung keimte in mir auf. Wo ein gesatteltes Pferd war, da konnte auch der Reiter nicht weit sein. Ob er mich wohl hörte, wenn ich um Hilfe rief? Das schien jedoch gar nicht nötig zu sein. Schon waren energische Schritte im Schankraum zu hören, die sich ohne Zweifel dem Hinterzimmer näherten. Sam zog scharf die Luft ein und warf einen unsicheren Blick von mir zur Tür. Alle bis auf den betrunkenen John, der noch immer, den Kopf auf die Tischplatte gelegt, schlief und nur ab und zu grunzende Laute von sich gab, starrten wie gebannt zum Eingang. Der Bursche von der gegenüberliegenden Bank hatte sich erhoben und verstaute gemächlich sein kleines Buch in der Rocktasche. Er schien die Spannung nicht zu spüren, die seine Kumpane erfaßt hatte.
Da wurde mit Schwung die Türe aufgestoßen, und ein Mann stand im Türrahmen. Er war breitschultrig und nicht allzu groß. Seine Reitkleidung war aus dunklem Stoff. Ungeduldig klopfte er mit seiner Reitgerte gegen seine über und über mit Lehm bespritzten hohen Schaftstiefel. Auf seinen dunklen Locken saß ein schwarzer, ungewöhnlich großer Hut, der wohl vor einigen Jahrzehnten einmal modern gewesen sein mochte. Er hatte diesen tief in die Stirne gezogen, so daß er einen großen Teil des Gesichts verdeckte. Auf den Wangen und dem energischen Kinn sproß ein mehrere Tage alter Bart.
Es war offensichtlich, daß dieser Mann den anderen Respekt einflößte. Sie blickten ihm erwartungsvoll und, wie mir schien, seltsam ergeben und schuldbewußt entgegen. Der kleine Jeff versuchte sogar seinen völlig betrunkenen Sitznachbarn dazu zu bewegen, sich zu erheben. Allerdings ohne Erfolg.
Ich musterte den gerade eingetretenen Mann eingehend. So sah also ein wahrhaftiger Räuberhauptmann aus! Wider Willen war ich fasziniert. Ich weiß nicht, was ich wirklich erwartet hatte, was jetzt geschehen würde. Würde sich der Anführer zu seinen Leuten setzen, einen Humpen ergreifen und sich an dem Saufgelage beteiligen? Vielleicht mißfiel ihm aber auch das unmäßige Saufen seiner Männer, und er würde in lautes, unflätiges Gezeter ausbrechen. Würde er mich anbrüllen, was zum Teufel ich hier zu suchen hätte? Vielleicht würde er mich bedrohen. Ich hatte mit allem gerechnet, nur nicht mit dem, was jetzt geschah.
Der Mann ließ einen kurzen Blick über die Anwesenden schweifen. Soweit ich das in diesem düsteren Zimmer erkennen konnte, lag deutliche Verachtung um seinen Mund. Dann wandte er sich an den Burschen, der gelesen hatte, befahl ihm per Handzeichen, ihm zu folgen, machte auf der Stelle kehrt und verließ, ohne ein Wort zu sagen, den Raum.
Der Bursche warf einen kurzen, sorgenvollen Blick auf mich. Es schien, als überlegte er, ob er den Anführer auf mich aufmerksam machen sollte. Dann entschied er sich jedoch dagegen, rief »Sofort, Hauptmann!«, hob grüßend die Hand und machte sich daran, seinem Herrn zu folgen.
Ich war wie vor den Kopf geschlagen. Es konnte doch nicht sein, daß mich der letzte Schutz, den ich hatte, verließ und mich seinen wilden Kumpanen auslieferte! Es konnte doch nicht sein, daß dem Anführer meine Anwesenheit völlig entgangen war! Es war mir noch nie in meinem Leben passiert, daß jemand meine Gegenwart so völlig mißachtet hatte. Sonderbarerweise ärgerte mich das am meisten. Ich mußte verhindern, daß man mich mit Sam und den anderen zurückließ.
»Halt, Herr Hauptmann!« rief ich daher, ohne weiter nachzudenken. Der Neuankömmling, der sich schon darangemacht hatte, den Schankraum zu durchqueren, blieb einige Augenblicke regungslos stehen, dann drehte er sich langsam um und kehrte in das Hinterzimmer zurück. Er hatte seinen Hut abgenommen, und seine dunklen, fast schwarzen Augen musterten mich mit einer Mischung aus Erstaunen und unverhohlener Belustigung. Es war wohl diese Belustigung, die mich dazu trieb, jede Vorsicht fallenzulassen. Eigentlich hatte ich doch den Anführer höflich ersuchen wollen, mich gehen zu lassen. Doch nun spürte ich, wie mein Temperament mit mir durchging: »Wie können Sie es wagen, mich hier mit Ihren ungehobelten Leuten zurückzulassen?« fuhr ich ihn an. »Sie müssen doch bemerkt haben, daß man mich gegen meinen Willen festhält.«
Mit diesen Worten hatte ich erreicht, daß die Belustigung aus den dunklen Augen verschwand. Er warf Sam einen durchdringenden Blick zu und hob fragend eine Augenbraue. Sam überragte seinen Anführer um Haupteslänge, und wenn man seine starken Arme sah, dann konnte er es an Kraft mit diesem sicher aufnehmen. Und doch war er nun überraschend kleinlaut, und die Arroganz, die er mir gegenüber an den Tag gelegt hatte, war verschwunden: »Die Lady fragte nach dem Wirt, Sir«, erklärte er stammelnd, »und da dachten wir, es sei nicht verkehrt, ein bißchen nachzufragen, wo doch der alte Styrabaker …«
Er unterbrach sich, da sich der Hauptmann schon wieder mir zugewandt hatte: »Sie suchten den Wirt?« fragte nun auch er, und seine Stimme klang überraschend angenehm. Seine Sprache war ohne eine Spur des breiten Yorkshire-Dialekts, der seinen Mannen eigen war. Und doch schien auch er so schwer von Begriff zu sein wie diese.
»Was erscheint Ihnen daran so seltsam?« fragte ich ungehalten. »Es ist doch keineswegs abwegig, in einem Wirtshaus einen Wirt zu erwarten, oder doch?«
»Nein, natürlich nicht«, gab der Mann zu. »Das Ungewöhnliche daran ist, daß ihn eine junge Dame sucht. Eine Dame ohne jede Begleitung, wenn ich mich nicht irre.«
Dieser Vorwurf war berechtigt, und vielleicht ärgerte er mich gerade deshalb. Wie kam dieser Mann dazu, mir Vorschriften zu machen?
»Vor dem Haus steht keine Kutsche. Deshalb vermutete ich, Sie seien mit den Männern hergekommen und dienten zu ihrer …« Er unterbrach sich und fuhr dann mit einem Lächeln fort: »… Unterhaltung.«
»Nein, das bin ich nicht und das tue ich auch nicht!« rief ich empört. »Ich bin zu Fuß gekommen. Alleine.«
Der Fremde hob erneut eine Augenbraue. »Ach, tatsächlich?« fragte er erstaunt. Dann ließ er seinen Blick über meine verschmutzten Rocksäume gleiten, bemerkte meine unansehnlichen, durchweichten Stiefelchen und schien mir zu glauben.
»Wo liegt denn die Kutsche?« fragte er.
»Wir haben einen Unfall gehabt …«, begann ich zu erklären.
Der Mann nickte. »Das dachte ich mir schon«, sagte er. »Allzuweit entfernt kann das nicht passiert sein, wenn Sie den Weg hierher zu Fuß gewagt haben. Sagen Sie mir, aus welcher Richtung Sie kamen, damit ich entscheiden kann, wie man Ihnen am besten hilft.«
Ich schnappte nach Luft. Damit er entscheiden konnte!
»Danke, ich komme gut alleine zurecht«, verkündete ich trotzig, schürzte meine Röcke und schickte mich an, erhobenen Hauptes an ihm vorbei hinauszurauschen. Seltsamerweise war ich sicher, daß er mich nicht aufhalten würde. Und er tat es auch nicht.
»Natürlich«, sagte er statt dessen und verbeugte sich leicht, während ich an ihm vorüberging.
Die anderen sprachen kein Wort. Ich war gerade dabei, die Schankraumtür zu öffnen und mich zu fragen, was ich wohl weiter unternehmen sollte, als mich die Stimme des Anführers veranlaßte stehenzubleiben.
»Sie wollten sich an den Wirt wenden, da Sie Hilfe brauchten«, sagte er ruhig.
Ich erschrak, da er so dicht hinter mir stand. Ich hatte nicht bemerkt, daß er mir gefolgt war.
»Nun ist der Wirt nicht da. Hilfe brauchen Sie doch trotzdem.«
Ich wandte mich um und blickte ihm direkt ins Gesicht, das ich wegen der inzwischen hereingebrochenen Dunkelheit nur schemenhaft erkennen konnte. Ich hatte noch nie einen Straßenräuber gesehen. Und nach den Geschichten, die Mally mir erzählt hatte, hatte ich mir brutale, verwegene Burschen vorgestellt. Männer, denen man ansah, daß sie stahlen, brandschatzten, daß sie nicht davor zurückschreckten, ihre erbarmungswürdigen Opfer zu erwürgen. Ich mußte mir nun eingestehen, daß ich mich geirrt hatte. Waren die Männer, mit denen ich es zuerst zu tun hatte, ungepflegt und grob in ihrem Verhalten, ungehobelt in ihren Ausdrücken, so waren sie mir doch nicht wirklich brutal erschienen. Und dieser Mann hier, der der Kopf, der Anführer der Bande war, wirkte beinahe wie ein Gentleman, wirkte weniger brutal als so mancher der Herren, die ich in Ballsälen und bei Konzerten kennengelernt hatte. Wie man sich doch irren konnte. Ich würde in Zukunft nie mehr dem äußeren Schein vertrauen können.
»Nun?« fragte der Fremde und neigte leicht den Kopf.
Ich spürte, wie die Röte in meine Wangen schoß. Ich hatte bei meinen Überlegungen vergessen, meinen Blick von seinem Gesicht abzuwenden. Was war das auch für ein Gesicht! Ich hatte noch nie so faszinierende Augen gesehen. Und dieser seltsame Kontrast zwischen den weichen wohlgeformten Lippen und dem harten energischen Kinn. Ich war ziemlich verwirrt. Ja, ich mußte sogar sehr verwirrt gewesen sein. Wie sonst war zu erklären, daß ich begann, diesem Straßenräuber zu vertrauen und ihm die genaue Lage unserer Kutsche und die unglückliche Situation meiner Begleiter zu verraten?
Nachdem ich ihm alles erzählt hatte, hätte ich mir allerdings am liebsten die Zunge abgebissen. Wie konnte ich nur so etwas Verrücktes tun? Für die Bande würde es nun ein leichtes sein, Mally und den bedauernswerten Harry zu überwältigen und all unser Hab und Gut mitsamt der Kutsche in ihren Gewahrsam zu bringen. Was für eine Närrin bin ich gewesen! Doch nun war es zu spät. »Falls Sie vorhatten, hier zu übernachten, so ist das leider nicht möglich«, sagte der Mann, als ich meine Erzählung beendet hatte.
»Gibt es denn sonst irgendein Gasthaus in der Nähe?« wollte ich wissen.
Der Fremde schüttelte den Kopf. Dann wandte er sich um und rief seinen Leuten, die uns durch die offene Tür schweigend beobachtet hatten, zu: »Fletcher, Stevens! Ihr habt gehört, wo die Kutsche liegt! Reitet dorthin und seht, wie ihr helfen könnt. Jem!« Auf diesen Ruf trat der Bursche, der zuerst gelesen hatte, aus dem Dunkeln einer Nische des Schankraumes hervor und kam näher.
»Du reitest nach Grandfox Hall und bereitest Palmer auf die baldige Ankunft von Miss …« Er wandte sich an mich: »Wie sagten Sie, war Ihr Name?«
»Matthews«, stammelte ich verwirrt. »Sophia Matthews.«
Für einen Moment hatte ich den Eindruck, als würde mein Name den Hauptmann überraschen. Doch ich hatte mich wohl geirrt, denn er wandte sich ohne einen Kommentar wieder seinem Burschen zu: »… auf das Kommen von Miss Matthews vor. Sage ihm, Miss Matthews sei, hmmm, eine Freundin von Lady Sylvia, und bitte Mrs. Lindon, sich um sie zu kümmern. Wenn du das geregelt hast, besorge eine Kutsche und fahre zum Unfallort, um die Begleiter von Miss Matthews abzuholen. Wir sehen uns anschließend.«
»Soll ich Miss Matthews nach Grandfox Hall mitnehmen, Hauptmann?« fragte der Bursche.
»Nein, das erledige ich selbst«, entschied dieser, worauf Jem die Hacken zusammenschlug, sich knapp verbeugte und das Gasthaus verließ. Sam und sein Freund trotteten ihm weniger dienstbeflissen hinterher. Der Anführer wandte sich abermals zum Hinterzimmer zurück und befahl dem kleinen Jeff, sich um seine betrunkenen Kumpane zu kümmern. »Und vergiß nicht den Hund mitzunehmen und alle Fenster und Türen dichtzumachen, wenn du das Haus verläßt. Kann ich mich darauf verlassen?«
Der Mann murmelte etwas Unverständliches und machte sich daran, mit Schreien und Hieben seinen Freund John aufzuwecken.
Nachdem der Anführer seine Befehle erteilt hatte und nun darauf vertraute, daß alles in seinem Sinne erledigt würde, wandte er sich wieder mir zu: »Sind Sie bereit, Miss Matthews? Können wir gehen?«
Er schien mein Einverständnis zu erwarten. Jedenfalls ergriff er die Klinke und hielt mir die Tür auf. Ich hatte nichts dagegen, das unwirtliche Haus endlich zu verlassen, und trat ins Freie.
Kalter Abendwind blies mir entgegen. Untertags, vor allem wenn die Sonne schien, vergaß man fast, daß bereits der September begonnen hatte und es nicht mehr lange dauern würde, bis der Herbst ins Land zog. Die Abende waren jedoch schon reichlich kühl, die Winde, die vom Meer her kamen, wurden zunehmend rauher. Mich fröstelte. Der Fremde schien das zu bemerken. Er legte einen Arm um meine Schulter, um mich zu wärmen. Ich wunderte mich selbst darüber, daß ich ihn gewähren ließ. Es war sonst nicht meine Art, fremden Männern zu gestatten, sich Freiheiten herauszunehmen. Aber an diesem Tag war wohl nichts so wie sonst. Und auch der Mann an meiner Seite unterschied sich grundlegend von den Männern, die ich bisher kennengelernt hatte. Seinen Arm auf meiner Schulter, gingen wir hinter das Haus, wo seine Stute noch immer wartete.
»Ich hoffe, es macht Ihnen nichts aus, sich vor mich auf den Sattel zu setzen«, sagte der Fremde. »Wir haben kein weiteres Pferd hierhergebracht. Wir wollten kein Aufsehen erregen.«
Er schwieg abrupt, als hätte er bereits zuviel gesagt. Hatte ich für kurze Zeit vergessen, daß es sich bei dem Mann an meiner Seite um einen Straßenräuber handelte, so fiel es mir jetzt um so nachdrücklicher wieder ein.
»Wohin wollen Sie mich bringen?« fragte ich und ignorierte die dargebotene Hand, die mir helfen wollte, das Pferd zu besteigen.
»Nach Grandfox Hall«, wiederholte der Fremde den Namen, den ich bereits im Gasthaus gehört hatte. »Das ist der Landsitz des Earl of Cristlemaine.«
Fassungslos blickte ich zu ihm auf. »Der Landsitz des Earl of Cristlemaine!« rief ich ungläubig. »Wie können Sie annehmen, daß ich zum Landsitz des Earl of Cristlemaine gebracht werden möchte? Ich kenne Seine Lordschaft doch gar nicht!«
»Ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn Sie nicht so laut sprechen würden«, sagte der Mann, ohne auf meine Worte einzugehen.
»Ich kenne den Earl of Cristlemaine nicht«, wiederholte ich nun flüsternd.
»Das weiß ich«, erwiderte der Mann. Die Sicherheit, mit der er das zum Ausdruck brachte, verwunderte mich.
»Wie können Sie das wissen?« fragte ich deshalb.
Der Mann zögerte und blickte mit einem eigentümlichen Lächeln zu mir herab: »Nun, sagen wir, ich habe es einfach vermutet. Aber Sie brauchen sich keine Sorgen zu machen. Seine Lordschaft ist nicht zu Hause. Er befindet sich bei Freunden zur Jagd. Mit seiner Rückkehr wird nicht vor nächster Woche gerechnet.«
»Sie sind ja gut informiert«, stellte ich fest.
Der Räuber grinste: »Man tut, was man kann.«
»Aber trotzdem, ich kann doch unmöglich in ein fremdes Haus …«
Der Mann unterbrach mich: »Wollen Sie im Freien übernachten?«
»Natürlich nicht«, gab ich zu.
»Nun denn. Darf ich Ihnen also in den Sattel helfen?«
Er wartete meine Antwort nicht ab, und ich wurde von seinen starken Armen hochgehoben und auf das Pferd gesetzt. Mir war ganz schwindlig zumute. In was für ein Abenteuer war ich denn da geraten? Ob ich wohl alles nur träumte und bald aufwachen würde, um festzustellen, daß ich mich daheim, im Hause meines Bruders, befand? Überrascht stellte ich fest, daß ich das gar nicht wollte. Um nichts in der Welt hätte ich darauf verzichten wollen, die Bekanntschaft dieses ungewöhnlichen Mannes gemacht zu haben. Er hatte sich hinter mich auf den Sattel geschwungen und sein Pferd in Bewegung gesetzt. Ich spürte seinen Körper dicht hinter meinem Rücken, spürte, wie die Wärme wohltuend durch mein dünnes Kleid drang. Unwillkürlich mußte ich mich wohl zurückgelehnt haben, denn ich vernahm ein kurzes, feines Lachen, das mich auffahren ließ. Sofort saß ich wieder mit steifem Rücken vor ihm im Sattel. Eine unbequeme Haltung, wie ich bald feststellte. Und auch nahezu unmöglich beizubehalten bei dem unebenen Boden, über den unser Ritt führte. Also ließ ich mich wieder zurücksinken und lehnte meinen Rücken an seine Brust. Niemand würde uns sehen, und es war sicherer, wollte ich nicht vom Pferd fallen. Und angenehmer war es auch. Da ich mich schon über die Maßen unschicklich benahm, beschloß ich, auch meine Neugierde nicht länger zu bezähmen.
»Haben Sie auch einen Namen?« fragte ich über die Schulter zurück.
Der Mann lachte: »Meine Freunde nennen mich Jojo«, antwortete er.
Jojo. Ich war mir nicht ganz schlüssig, ob ich fand, daß der Name zu ihm paßte. Ob ich ihn wohl auch fragen konnte, warum er Straßenräuber geworden war? Es war ja offensichtlich, daß dieser Mann schon bessere Zeiten gesehen hatte: Vielleicht war er vor nicht allzu langer Zeit Diener in einem vornehmen Hause gewesen und in Ungnade gefallen. Vielleicht aber war er selbst ein vornehmer Herr gewesen, den widrige Umstände dazu getrieben hatten, sich dem Unwesen auf der Landstraße zuzuwenden. Spielschulden vielleicht. Nein, ich wollte nicht an offene Wunden rühren.
»Wer ist Lady Sylvia, als deren Freundin ich mich ausgeben soll?« fragte ich statt dessen.
»Das ist die Schwester Seiner Lordschaft«, erklärte Jojo, als sei das nichts Außergewöhnliches.
»Sie glauben doch nicht wirklich, daß ich bereit bin, mich für die Freundin der Schwester Seiner Lordschaft auszugeben«, brüllte ich über die Schulter zurück. Der Wind war stärker geworden, und ich mußte laut sprechen, wenn ich von meinem Begleiter überhaupt gehört werden sollte.
»Die Dame weiß doch, daß sie mich noch nie gesehen hat, und wird …«
Jojo lachte. »Nichts wird sie«, sagte er amüsiert, »weil sie nämlich gar nicht da ist. Lady Sylvia weilt zur Zeit in London. Sie sehen also, es kann gar nichts passieren.«
»Kann gar nichts passieren?« wiederholte ich ungehalten über die Gelassenheit, mit der dieser Jojo mich in seinen unglaublichen Plan einweihte.
»Und was ist mit der Dienerschaft? Sie glauben doch nicht, daß ein herrschaftlicher Haushalt mir nichts dir nichts eine fremde Person bei sich beherbergt, allein auf ihre Aussage hin, sie sei mit der Schwester des Hausherrn befreundet!«
»Sie vergessen Jem«, erklärte Jojo ruhig. »Jem ist Stallbursche auf Grandfox Hall. Wenn er sagt, daß Sie die Freundin von Mylady sind, wird keiner der Dienstboten einen Anlaß sehen, daran zu zweifeln.«
Diese Bemerkung war wirklich überraschend. Was konnte einen Stallburschen, der auf einem gräflichen Landsitz eine gute Stelle hatte, veranlassen, sich einer Bande Straßenräuber anzuschließen?
»Ihr Wort in Gottes Ohr«, meinte ich ergeben und fügte mich meinem Schicksal. Vielleicht gelang der Plan dieses Straßenräubers wirklich, und ich würde mich in nicht allzu langer Zeit in einem weichen, sauberen Bett wiederfinden. Wirklich ein verlockender Gedanke. Den Rest des Weges ritten wir schweigend. Jojo kannte ohne Zweifel die Gegend ganz genau. Und so ritt er querfeldein über Felder und Wiesen, durch die dichten Waldungen. Obwohl nun schon alles in tiefstes Dunkel getaucht war und das fahle Licht des zunehmenden Mondes die Nacht kaum merklich erhellte, schien er keine Schwierigkeiten zu haben, sich zu orientieren oder mich vor Ästen zu warnen, die gefährlich tief auf unseren Weg herabreichten. Diese Fähigkeit wird sicherlich für seine Raubzüge unbezahlbar sein, dachte ich mit Schaudern.
Und doch, seltsamerweise fürchtete ich mich nicht mehr. Hätte mir einmal jemand prophezeit, ich würde mich freiwillig von einem Straßenräuber in ein Haus bringen lassen, das ich nicht kannte, hätte dieser Mensch gesagt, ich würde das Abenteuer nicht beängstigend, sondern angenehm aufregend finden, hätte man mir gesagt, ich würde mich in der Anwesenheit des Räubers ungewöhnlich wohl fühlen – ich hätte ihn beschimpft, ein Narr zu sein. Und doch waren das genau die Gefühle, die ich jetzt empfand.
Wir hatten eben den Wald verlassen und waren über eine schmale Wiese galoppiert, als Jojo das Tempo zügelte und das Pferd schließlich vor einem kunstvollen, schmiedeeisernen Gittertor zum Stehen brachte.
»So, da wären wir«, erklärte er. »Das ist ein Seiteneingang zu Grandfox Hall. Es ist besser, wir lassen Simplicity hier stehen und gehen das letzte Stück zu Fuß.«
Er schwang sich aus dem Sattel und streckte mir beide Arme entgegen, um mir hinunterzuhelfen. Ich spürte den warmen, festen Griff, mit dem er mich umfing und mich sanft und sicher auf die Erde stellte. Ich konnte in der Dunkelheit Jojos Blick nicht deuten, und doch hatte es beinahe den Anschein, als wolle er mich in seine Arme nehmen. Aber entweder hatte ich mich geirrt oder er hatte es sich anders überlegt, jedenfalls ließ er mich nach kurzem Zögern los.
»Ihr Verlobter sollte Ihnen nicht gestatten, so allein quer durch das Königreich zu reisen. Hat er denn wirklich so wenig Verstand, daß er nicht erkennt, in welche Gefahr sich ein Mädchen damit begibt? Noch dazu, wenn es so ungewöhnlich hübsch ist, wie Sie es sind?«
Dieses Kompliment traf mich unerwartet. Ich bin sicher rot geworden und war froh, daß man das auf Grund der Dunkelheit nicht sehen konnte.
»Mein Verlobter?« wiederholte ich und fühlte mich seltsamerweise dazu gedrängt, diesen Irrtum aufzuklären: »Aber ich bin doch gar nicht verlobt.«
Jojo zog eine Augenbraue hoch, und ich hatte den Eindruck, als würde er mir nicht glauben. »Das ist ja erstaunlich«, murmelte er.
Noch ein eindringlicher Blick in mein Gesicht, dann wandte er sich ab und begann vorsichtig, das Gittertor einen Spaltbreit zu öffnen, nur so weit, daß wir uns hindurchzwängen konnten.
»Das Tor quietscht, wenn man es vollständig öffnet. Ich darf nicht vergessen, es bei nächster Gelegenheit einmal ölen zu lassen.«
Er würde doch nicht vorhaben, das Herrenhaus eines Tages zu überfallen, schoß es mir durch den Kopf. Ob ich wohl die Dienerschaft auf dieses unversperrte Tor aufmerksam machen sollte? Es würde das mindeste sein, womit ich mich für die erwiesene Gastfreundschaft bedanken konnte, wenn sie mir überhaupt gewährt wurde.
Ich spürte, wie die Aufregung wieder in mir wuchs. Was für unangenehme Szenen würden mir mit der Dienerschaft bevorstehen? Ob sie mich wohl mit Beschimpfungen von der Türschwelle jagen würde? Und was würde dann aus Mally und dem verletzten Harry werden, wenn dieser Jem sie nach Grandfox Hall bringen würde? Falls er sie überhaupt dorthin brachte. Jojo schien meine Zweifel zu ahnen. Seine große warme Hand schob sich in meine.
»Du kannst mir wirklich vertrauen, Sophia«, meinte er schlicht.