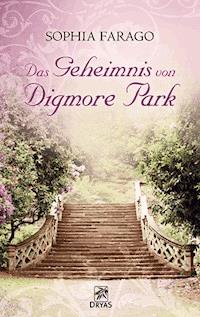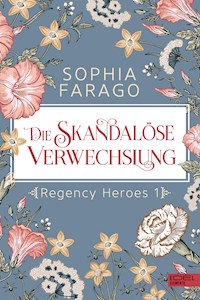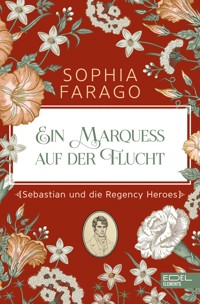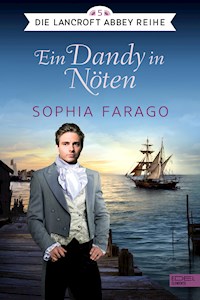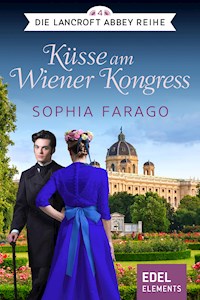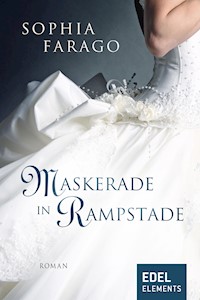4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Edel Elements - ein Verlag der Edel Verlagsgruppe
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein hinreißend romantischer Regency-Roman – von der Autorin des Bestsellers "Die Braut des Herzogs"! England im 19. Jahrhundert: Der ehrenwerte Mr. Richard Willowby befindet sich in einer üblen Klemme – er wurde auf frischer Tat bei einem intimen Tête-à-tête von dem Vater seiner Gastgeberin ertappt – der sich sofort erzürnt an seine Fersen heftet. Da ist guter Rat teuer! Gott sei Dank verfügt unser Held über die Geistesgegenwart, die tief verschleierte Dame, die er überraschenderweise in seinem Salon vorfindet, als seine Verlobte auszugeben...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 457
Veröffentlichungsjahr: 2013
Sammlungen
Ähnliche
Sophia Farago
Hochzeit in St. George
Roman
Edel Elements
Copyright dieser Ausgabe © 2013 by Edel Elements, einem Verlag der Edel Germany GmbH, Hamburg.
Copyright © 1993 by Sophia Farago
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Michael Meller Literary Agency GmbH, München.
Covergestaltung: Agentur bürosüd°, München
Konvertierung: Datagrafix
Alle Rechte vorbehalten. All rights reserved. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des jeweiligen Rechteinhabers wiedergegeben werden.
ISBN: 978-3-95530-105-7
edel.comfacebook.com/edel.ebooks
Inhalt
Kapitel I
Kapitel II
Kapitel III
Kapitel IV
Kapitel V
Kapitel VI
Kapitel VII
Kapitel VIII
Kapitel IX
Kapitel X
Kapitel XI
Kapitel XII
Kapitel XIII
Kapitel XIV
Kapitel XV
Kapitel XVI
Kapitel XVII
Kapitel XVIII
Kapitel XIX
Kapitel XX
Kapitel XXI
Kapitel XXII
I.
»Verdammt, Willowby, Sie haben schon wieder gewonnen!« Immer wenn sich der ehrenwerte Mr. Geoffrey Steanton erzürnte, dann färbten sich seine breiten Wangen rot, und der Schweiß, der ihm von seiner niedrigen Stirn in den Nacken rann, verdarb die Pracht seiner makellos weißen, gestärkten Hemdkragen. In diesem Augenblick war Mr. Steanton nicht nur auf das Äußerste erzürnt, sondern ebenso verbittert und wütend über sich selbst. Er kramte ein großes Taschentuch aus seiner Hosentasche und rieb sich Stirn und Nacken trocken. Warum hatte er sich auch auf dieses Spiel eingelassen? Wie hatte es Hugh genannt? Ein Abend unter Freunden! Mr. Steanton blickte in die Runde. Na, als seine Freunde würde er die hier anwesenden Herren nicht bezeichnen. Außer seinem Gastgeber Lord Hugh Deverell natürlich. Hugh war ein Ehrenmann, dafür konnte er seine Hand ins Feuerlegen. Er war etwa in seinem Alter, Anfang dreißig, und hatte zur selben Zeit die Universität in Cambridge besucht. Dort waren sie zwar nicht wirklich Freunde geworden, aber doch Bekannte, die sich achteten und schätzten. Dennoch war es ein verflixtes Pech gewesen, dass er gerade Hugh in die Arme gelaufen war, als er gestern für einige Tage in die Hauptstadt gekommen war.
Er hatte ein neues Gespann und mehrere Pferde im Tattersall kaufen wollen. Nun war all das Geld, das er für diese Käufe vorgesehen hatte, längst über den Spieltisch gewandert. Mr. Steantons Blick blieb an dem Gesicht seines Gegenübers hängen. Mr. Richard Willowby. Er hatte den Mann nie leiden können, doch noch nie mochte er ihn weniger als gerade eben. Er war ein Tunichtgut, ein Spieler, ein Dandy, der in den Tag hinein lebte, ohne einer einzigen Pflicht nachzugehen. Wie er da saß, lässig in seinen Stuhl zurückgelehnt, das rechte Bein in modischen zartgrauen Hosen neben dem Tisch ausgestreckt! Seine blonden Locken waren in Unordnung, das Halstuch gelockert, die Lippen zu einem spöttischen Grinsen verzogen. Mit einer fast liebevollen Geste strich er die Münzen, die er gewonnen hatte, ein und stapelte sie, je nach ihrem Wert, zu Häufchen, die sich bereits vor ihm auftürmten. Womit dieser Mann wohl seinen Unterhalt bestritt? Seines Wissens nach hatte sein Vater, der Viscount, bereits das gesamte Vermögen der Willowbys am Spieltisch und mit Frauen durchgebracht. Kaum anzunehmen, dass er seinem Ältesten eine reiche Apanage zahlen konnte. Nun, von dem, was Richard Willowby heute Abend gewonnen hatte, konnte er gut und gerne ein Jahr leben, wenn er sparsam damit umging. Es war allerdings nicht damit zu rechnen, dass er sich großer Sparsamkeit befleißigte. Schade um das gute Geld. Was würde wohl Mama dazu sagen, wenn er ohne das Gespann und mit viel weniger Pferden als geplant nach Kent zurückkehrte? Sie hatte ihm abgeraten, nach London zu fahren. Sie hatte gemeint, dort würden an jeder Straßenecke Gefahren auf ihren Sohn lauern. Mama hatte recht gehabt. Wie immer.
»Noch ein Spiel, meine Herren?«, meldete sich nun eine näselnde Stimme zu Wort. Mr. Steanton schreckte aus seinen Gedanken auf. Lord Peter Bridgegate war der vierte Mann in ihrer Kartenrunde. »Beau Bridge«, wie man ihn in der Gesellschaft für gewöhnlich nannte. Der älteste Sohn des Herzogs von Milster. Ein Adonis, wie man allgemein sagte. Mr. Steanton rümpfte die Nase. Natürlich sah Bridgegate gut aus. Die schwarzen Locken glänzten im Schein der Kerzen, die eng geschnittene, dunkelblaue Jacke betonte die breiten, durchtrainierten Schultern. Dennoch wirkte der Gentleman zu feminin für seinen Geschmack. Die dunklen Augen waren von einem Kranz dichter Wimpern umgeben, die Lippen wohlgeformt, die Nase schmal und gerade. Wie bei einem Mädchen, dachte Mr. Steanton kritisch. Und dann erst das blasierte Gehabe, das Seine Lordschaft an den Tag legte. Die routinierte Eleganz, mit der er seine reich verzierte emaillierte Schnupftabaksdose öffnete.
Die Wanduhr schlug die volle Stunde. Zwei Uhr früh. Spät genug, um aufbrechen zu können, ohne seinen Gastgeber zu beleidigen.
»Wenn Sie mich bitte entschuldigen wollen, meine Herren«, sagte er daher und stemmte seine breiten Handflächen auf die Tischplatte, um sich zu erheben. »Es war ein sehr angenehmer Abend. Aber ich muss Sie jetzt leider verlassen. Ich habe morgen einen anstrengenden Tag vor mir.« Sein Gastgeber war ebenfalls aufgestanden.
»Das kann doch nicht Ihr Ernst sein, Steanton«, meldete sich Richard Willowby mit spöttischem Grinsen zu Wort. »Was ist mit einer Revanche? Alles oder nichts.«
»Es ist schon spät, Ric«, wandte Hugh Deverell ein. »Ich denke, wir sollten diesen Abend beenden …«
Doch Mr. Steanton hatte sich bereits wieder auf seinen Stuhl zurückfallen lassen. »Einmal abheben, Willowby«, keuchte er. »Gewinne ich, bekomme ich all das Geld, das vor Ihnen auf dem Tisch liegt.«
»Aber sicher«, bestätigte sein Gegenüber gelassen. »Und wenn Sie verlieren, bekomme ich von Ihnen noch einmal den Betrag, den ich heute Abend bereits gewonnen habe.«
Mr. Steanton nickte mechanisch. Daran wollte er nicht denken. Willowby konnte nicht den ganzen Abend das Glück gepachtet haben. Sicher würde er selbst als Sieger aus diesem Spiel hervorgehen. Dann konnte er morgen in aller Ruhe all die Dinge erledigen, deretwegen er nach London gekommen war. Und Mama würde nichts von diesem unglückseligen Abend erfahren.
Beau Bridge stieß einen leisen Pfiff aus. »Jetzt wird es interessant«, näselte er. »Ich wette zehn zu eins, dass Richard verliert. Was meinst du, Hugh?«
Lord Deverell war nicht wohl zumute. Er mochte es nicht, wenn jemand große Summen verlor. Noch dazu in seinem Haus. Allerdings würde Richard eine Aufbesserung seiner Finanzen sicher sehr gelegen kommen. Und wie hätte er das waghalsige Spiel verhindern können, wenn Steanton einverstanden war? »Ich wette nicht«, erklärte er an den Beau gewandt. Dann zog er mit festem Griff an der Klingelschnur.
»Ein neues Paket Karten«, trug er dem Diener auf, der herbeigeeilt war.
Er mischte das frische Paket ausgiebig und legte es dann in die Mitte des Tisches.
»Wer die höhere Karte zieht, soll der Sieger sein. Möchten Sie, dass ich beginne, Steanton?«, fragte Richard Willowby. Mit keiner Wimper verriet er die Aufregung, die auch er verspüren musste, da so viel Geld auf dem Spiel stand. Dafür sah man die Anspannung dem armen Mr. Steanton doppelt an. Der Schweiß begann erneut von seiner Stirne zu perlen, die Hände zitterten.
»Nein, ich möchte beginnen, Willowby, wenn Sie gestatten«, sagte er und griff mit einem Blick auf sein Gegenüber nach der obersten Karte. Mr. Willowby nickte. Die Karte wurde umgedreht. Die Herzdame. Als Mrs. Steanton sie sah, atmete er auf. Es war nicht zu erwarten, dass ihn Willowby übertreffen würde.
Mit gewollt langsamer Bewegung drehte dieser nun die nächste Karte um, und er blickte sie zuerst regungslos nur für sich an. Endlich, als Mr. Steanton schon meinte, seine zum Zerreißen gespannten Nerven würden die Ungewissheit nicht mehr länger ertragen, ließ Willowby sie mit einem lauten Lachen auf den Tisch fallen. Es war der Karokönig.
»Du hättest doch wetten sollen, Hugh«, sagte Lord Bridgegate, der als Erster seine Sprache wiedergefunden hatte. »Unser guter Richard befindet sich zurzeit in einer überwältigenden Glückssträhne. Das ist man von ihm nun wirklich nicht gewöhnt.«
Mr. Steanton sah sich ohne Pferde nach Kent zurückkehren. Sah im Geiste das vorwurfsvolle Gesicht seiner Mama vor sich und wäre am liebsten in Tränen ausgebrochen.
Richard Willowby zählte in der Zwischenzeit die vor ihm aufgetürmten Münzen und nannte ihm schließlich den Betrag, den Steanton ihm schuldete. Es war noch mehr, als Mr. Steanton befürchtet hatte. Nun würde ihm nichts anderes übrigbleiben, als dem Nachbarn eines der Grundstücke zu verkaufen, die dieser schon lange von ihm haben wollte. Mühsam die Fassung bewahrend, sagte er: »Ich habe nicht so viel Bargeld bei mir, Mr. Willowby. Ich hoffe, Sie akzeptieren meinen Schuldschein? Ich werde das Geld umgehend von meinem Landsitz anfordern. Es kann möglicherweise eine Woche dauern …«
»Wenn es sein muss, auch zwei Wochen«, erwiderte sein Gegenspieler großzügig. »Ich habe es nicht eilig.«
»Vielen Dank, Mr. Willowby«, antwortete Mr. Steanton bitter.
Sein Gastgeber hatte einen weißen Bogen sowie Tinte und Streusand zum Trocknen bereitgestellt. Mit zitternden Fingern griff Mr. Steanton zur Feder. Er war kaum in der Lage, die Worte lesbar zu Papier zu bringen. Zu groß war sein Verlangen, diese Stätte des Unheils und des Lasters endlich verlassen zu können. Als er fertig geschrieben hatte, nahm er sich nicht mehr die Zeit, die Zeilen durchzulesen oder zu warten, bis sie getrocknet waren. Er erhob sich so abrupt, dass er mit voller Leibesfülle am Tisch anstieß. Der Brandy in den halb gefüllten Gläsern drohte überzuschwappen, und hätte Mr. Willowby nicht mit geistesgegenwärtiger Reaktion den Krug in Sicherheit gebracht, so wäre er sicher am Boden zerschellt.
»Ich bringe Sie hinaus«, machte sich der Gastgeber erbötig, der sich ebenfalls erhoben hatte. Grußlos hastete Mr. Steanton aus dem Zimmer.
Als sich die Tür hinter Seiner Lordschaft und seinem aufgebrachten Gast geschlossen hatte, herrschte im Spielzimmer ungewohnte Stille. Lord Bridgegate hatte sich in seinem Stuhl zurückgelehnt und die langen, wohlgeformten Beine von sich gestreckt. Schweigend und eingehend betrachtete er seine Fingernägel. Richard Willowby begann mit unverhohlenem Vergnügen, das vor ihm gestapelte Geld in seinen Rocktaschen zu verstauen.
»Was für ein öder, langweiliger Abend«, ließ sich der Beau schließlich vernehmen. Auch in Gegenwart seiner engsten Freunde verzichtete er nicht auf seinen nasalen Tonfall. »Wenn ich gewusst hätte, dass unser guter Hugh nichts Besseres im Sinn hatte, als diesen Mr. Nobody einzuladen, wäre ich nicht gekommen. Ich fühle mich nicht wohl in Umgebung von Leuten, denen die Landluft anhaftet. Mir war, als könne man den Stall förmlich riechen.«
»Du bist mir doch nicht böse, wenn ich dir nicht zustimme«, entgegnete sein Freund Willowby und klimperte fröhlich mit einigen Münzen. »Wahrlich ein einträglicher Abend. Und viel amüsanter, als dem armen Alfred seinen letzten Shilling abzugewinnen. Apropos Alfred: Wo steckt der Kerl eigentlich? Mir ist, als hätte ich ihn seit Tagen nicht mehr zu Gesicht bekommen.«
»Influenza«, entgegnete der Beau und griff mit seinen langen, weißen Fingern zum Brandyglas. »Das ist der Grund, warum ich es vorziehe, die Charles Street derzeit zu meiden. Ich habe keine Lust, mich anzustecken. Ich hoffe, dass Alfred in Kürze wieder auf den Beinen ist. Er wollte mich nach Hastings begleiten.«
»Du fährst doch nicht etwa schon wieder zu deinem Vater?«, fragte Hugh Deverell, der eben wieder im Türrahmen erschienen war. Mit resignierender Geste nickte der Beau. »Doch. Nächste Woche. Ich habe vor Tagen ein Schreiben meines alten Herrn erhalten, in dem er dringend mein Kommen wünscht.«
»Was hat denn dieses Mal den Zorn Seiner Gnaden erregt?«, wollte Hugh wissen.
Der Beau zuckte mit den Schultern. »Darüber möchte ich mir nicht den Kopf zerbrechen. Was immer es ist, es ist enervierend. Immer diese langen Fahrten, eingeschlossen in der engen Reisekutsche. Und dann das viele Gepäck, das jedes Mal mitgenommen werden muss. Man glaubt gar nicht, wie viel Garderobe man in wenigen Tagen auf dem Land benötigt. Dabei lasse ich alle topmodischen Jacken, die orientalisch bestickten Westen und die Stiefel mit den weißen Stulpen und den originellen Quasten zu Hause in London, um Papa nicht über Gebühr zu echauffieren. Mein Vater hängt einer nicht ganz zeitgemäßen Gesinnung an, wie ihr wisst …«
»Ich kann dir genau sagen, was deinen alten Herrn diesmal in Rage brachte. Du hättest nicht mit Lady Steverdon schlafen sollen«, stellte Richard Willowby mit einem frechen Grinsen fest.
»Du sei ganz still«, empörte sich der Beau. »Du bist ja schuld daran, dass mich mein Vater mit Verdächtigungen und falschen Beschuldigungen verfolgt.«
»Erstens sind das keine falschen Verdächtigungen, wenn wir ehrlich sein wollen, sondern Tatsachen«, unterbrach ihn sein unverbesserlicher Freund, »und zum Zweiten bin ich sicher nicht schuld, dass dein Vater ständig damit droht, dich zu enterben. Ich bin schließlich nicht sein Informant.«
»Nein, aber dein Vater ist es«, gab Lord Bridgegate anklagend zurück.
»Hast du wirklich mit Lady Steverdon geschlafen?«, meldete sich nun Hugh interessiert zu Wort.
»Warum sollte ich nicht?«, begehrte der Beau auf. »Ich bin ein freier Mensch und ungebunden.«
Richard Willowby konnte sich ein amüsiertes Auflachen nicht verkneifen. »Aber Lady Steverdon ist es nicht«, stellte er fest. »Sie ist verheiratet. Und noch dazu mit einem sehr guten Freund deines Vaters. Kein sehr kluger Schachzug, gerade sie zu deiner Geliebten zu machen, wenn du mich fragst.«
»Ich frage dich aber nicht«, entgegnete Seine Lordschaft in scharfem Ton. »Und überhaupt: Wie soll mein Vater sonst von der Affäre Wind bekommen haben? Steverdon ist bis Ende Mai in Schottland, und dein Vater befindet sich in Winchester.«
»Vater ist seit Jahren in Winchester«, meinte Richard. »Und dennoch gelingt es ihm immer wieder, auf dem neuesten Stand zu sein, was unser beider Leben betrifft.«
Der Beau seufzte vernehmlich. »Wirklich, Ric«, sagte er, »dein Vater ist eine echte Plage. Ich finde, du solltest mit ihm reden. Ja, es ist geradezu deine Pflicht, es zu tun. Er hat keinen Grund, mich bei meinem Papa anzuschwärzen.«
»Du vergisst Eliza, wie hieß sie doch gleich? Eliza Drevenham, wenn ich mich richtig erinnere.«
»Wer ist denn diese Dame nun schon wieder?«, wollte ihr Gastgeber wissen. »Auch eine von Bridges Geliebten?«
Der so Verdächtigte legte eine seiner schlanken Hände gegen seine Stirn: »Aber das ist doch schon eine Ewigkeit her. Kaum mehr wahr, würde ich sagen. Vergiss doch die alten Geschichten, ich bitte dich.«
»Ich vergess sie gerne«, gestand ihm sein Freund zu. »Aber Vater vergisst sie nicht. Er war einmal sehr verliebt in diese Miss Drevenham. Das muss vor etwa zehn Jahren gewesen sein, wenn ich nicht irre.«
»Erspare uns Details, Richard«, bat der Beau.
Doch sein Freund dachte nicht daran. »Damals war mein Vater noch ein flotter Bursche, liebte das Leben, die Liebe und das Spiel. Ihr wisst ja, dass er in den letzten Jahren prüde und rechtschaffen geworden ist. Nun lebt er zurückgezogen auf Wild Rose Manor und macht sich nur noch durch vorwurfsvolle Briefe bemerkbar. So wie dir dein Vater mit Enterbung droht, Bridge, so droht mir meiner ebenfalls. Natürlich hat mein Vater nicht mehr viel zu hinterlassen. Das meiste, was er je besaß, hat er verspielt oder zu Geld gemacht. Dennoch wäre es schmerzlich für mich. Ich habe ihn in den letzten Jahren nie besucht. Und er kommt nicht mehr in die Hauptstadt, die für ihn plötzlich der Inbegriff alles Verdorbenen und Lasterhaften darstellt. Ich habe meinen Vater schon nicht gemocht, als er noch der wilde Draufgänger war. Aber glaubt mir, Freunde, seit er auf die moralische Linie umgeschwenkt ist, mag ich ihn noch weniger. Falls das überhaupt möglich ist.« Er nahm einen kräftigen Schluck Brandy und blickte gedankenverloren in sein Glas. »Ich möchte bloß wissen, wodurch diese Veränderung bei ihm ausgelöst wurde.«
»Was auch immer es war, ich wünschte, es wäre nicht eingetreten«, sagte Lord Bridgegate mit leidender Miene. »Wenn dein lästiger Vater nicht wäre, dann hätte Papa keine Ahnung, was hier in London gespielt wird. Wenn ich nicht auf der Hut bin, dann bringt er es noch fertig, meinen Papa davon zu überzeugen, das gesamte Vermögen meinem langweiligen kleinen Bruder Jason zu hinterlassen. Wie kommt es überhaupt, dass dein Vater so gut Bescheid weiß? Irgendjemand muss ihn informieren.«
»Was siehst du mich denn dabei an?«, fuhr Richard Willowby entrüstet auf. »Ich wechsle seit Jahren kein Wort mehr mit meinem alten Herrn. Und Briefe schreibe ich schon gar nicht.«
»Ihr wolltet mir die Episode mit dieser Eliza erzählen«, unterbrach Hugh Deverell, der Gastgeber, das Gespräch, das wie so oft in einen Streit der beiden Freunde auszuarten drohte. »Was hat sich damals zugetragen?«
»Eigentlich gar nichts.« Der Beau machte eine wegwerfende Handbewegung. »Rics Vater hatte ein Auge auf die kleine Eliza geworfen. Kaufmannstochter aus Winchester. Sie war damals kaum sechzehn. Er sicher schon über fünfzig. Da konnte ich nicht zusehen …«
»Sie war mindestens schon zwanzig und mein Vater wenig über vierzig«, verbesserte ihn Willowby.
»Richard, du bist manchmal unangenehm penibel«, stöhnte Seine Lordschaft. »Was machen diese paar Jahre denn für einen Unterschied, ich bitte dich.«
»Hast du das Mädchen verführt?«, wollte Hugh Deverell wissen.
»Entführt!«, verbesserte Richard. »Aber er kam nicht weit. Miss Eliza hat ihn mit ihrem Sonnenschirm beinahe bewusstlos geschlagen.«
»Waaas?«, rief Hugh erstaunt. »Die Dame wollte sich nicht entführen lassen? Vom Beau? Du scheinst doch sonst immer Glück zu haben mit deinen unehrenhaften Anträgen, Bridge.«
»Ich wollte Eliza heiraten«, erklärte der Beau würdevoll.
Dafür hatten seine beiden Freunde nur ein lautes Lachen übrig.
»Was ist aus dem Mädchen geworden?«, erkundigte sich Hugh.
Der Beau zuckte die Schultern. »Aus den Augen, aus dem Sinn.«
»Ich dachte, du hattest vorgehabt, sie zu heiraten?«, wandte Richard Willowby spöttisch ein.
»Nachdem sie mich geschlagen hat?«, rief Lord Bridgegate fassungslos. »Das kann doch nicht dein Ernst sein. Zudem hatte ich mir im Fallen eine meiner Westen ruiniert. Feinste chinesische Stickerei …«
»Und nun rächt sich Viscount Willowby, indem er deinen Vater über alle deine Schandtaten informiert?«, vergewisserte sich Hugh.
Der Beau nickte. »So ist es«, stöhnte er, »und ich muss alle naselang die Strapaze einer Heimreise auf mich nehmen.«
»Wann fährst du?«, fragte Richard.
»Etwa in einer Woche, nach dem Ball bei Sally Jersey. Weil wir gerade von Ball sprechen: Sieht man euch morgen auf dem Ball der Greenhoods?«
Hugh lachte. »Also, Richard wirst du dort sicher nicht zu Gesicht bekommen. Ich glaube, du warst schon mehr als zwei Jahre nicht mehr auf einem Ball. Habe ich recht, Ric?«
Mr. Willowby grinste seinen Freund über das Brandyglas hinweg an. »Aber natürlich gehe ich auf den Ball der Greenhoods«, verkündete er und freute sich über die Überraschung, die er mit diesen Worten auslöste.
»Olala. Unser guter Ric wandelt auf Freiersfüßen, wie mir scheint«, näselte der Beau mit unüberhörbarem Spott in seiner Stimme. »Auf welche der Schönheiten hast du denn dein Auge geworfen?«
»Scheint ja wirklich etwas Ernstes zu sein, wenn du dich einer Dame zuliebe sogar auf das Tanzparkett wagst. Du gedenkst doch nicht etwa, dich zu verheiraten?«
»Alt genug wärst du ja«, warf Lord Bridgegate ein. »Zweiunddreißig Jahre und noch immer keinen Erben in die Welt gesetzt.«
»Für mich besteht gar kein Grund, mich in die Netze einer Frau zu begeben«, erklärte Richard großspurig. »Ich brauche auch keinen Erben in die Welt zu setzen, denn ich habe bereits einen. Oder hast du meinen Bruder George vergessen?«
»Wie könnte irgendjemand den guten George Willowby vergessen?«, näselte der Beau, »wo wir doch alle vor Bewunderung erstarren, da es ihm gelungen ist, von eurer Großmutter in Rampstade Palace als Alleinerbe eingesetzt zu werden. Seit ihm die alte Lady im letzten Winter die Freude machte, zu verscheiden, ist dein Bruder einer der reichsten Männer im Lande. Du hättest dich nicht mit ihm zerstreiten sollen, mein Lieber. Dann würdest du nun an seiner Fortune mitnaschen.«
»Ich habe mich nicht mit ihm zerstritten«, wandte Richard ein. »Wir Willowbys sind es gewöhnt, unsere eigenen Wege zu gehen. Seit Mama starb, hält uns nichts zusammen.«
»Bist du ihm böse, weil eure Großmutter ihm den Vorzug gab?«, wollte Hugh wissen.
Mr. Willowby schüttelte den Kopf: »Nein, ich hatte dieselben Chancen wie er. Es lag an mir, sie nicht zu nützen. Ich verspürte einfach keine Lust, mich aufs Land zu verkriechen und um meine gestrenge Großmutter herumzuscharwenzeln. Als ich mich dafür entschied, in London zu bleiben, hatte ich mir die Sympathien der alten Dame restlos verscherzt. Mich wundert nur, dass sie ihren Besitz nicht Cousin Max vermachte. Der war schließlich immer ihr erklärter Liebling.«
»Max? Du meinst Cristlemaine? Der ist doch selbst reich genug«, wandte der Beau ein. »Ist das Leben nicht seltsam? Da besitzt unser guter Richard einen reichen Bruder und einen reichen Cousin, der noch dazu ein Earl ist. Und was macht er daraus? Nichts. Er lebt in einem verlotterten Haus und hat keinen Shilling in der Tasche.«
»Ich habe meine Taschen voller Shilling«, entgegnete sein Freund merkbar gereizt. »Und außerdem habe ich eben kein Talent zum Erbschleichen und Speichellecken …«
»Soll das etwa eine Anspielung auf mich sein?«, fuhr der Beau auf. »Wenn ja, dann ist diese völlig verfehlt. Ich bin kein Erbschleicher, sondern ein Mann, der das Erbe zu verteidigen hat, das ihm von Rechts wegen zusteht. Und was den anderen Vorwurf betrifft …«
Wie immer, wenn ein Streit zwischen den beiden Freunden aufzuflammen drohte, wechselte Hugh das Thema: »Warum wirst du Greenhoods Ball besuchen, Richard?«, fragte er. Die beiden Streithähne waren sofort abgelenkt.
»Du kennst doch Constance Ridley«, sagte Richard, »die Witwe von Brian Ridley.«
Hugh nickte. »Natürlich kenne ich sie. Sie war eines der hübschesten Mädchen, als sie vor Jahren debütierte. Und dann wurde sie von ihrem Vater an den alten Ridley verheiratet. Der sicher dreißig Jahre älter war als sie. Es muss beinahe ein Jahr her sein, dass Ridley starb. Das Trauerjahr müsste in Kürze vorüber sein.«
»Es ist vorbei«, verkündete Richard. »Ich habe Lady Ridley bereits letzte Woche in den Vauxhall Gardens getroffen. Sie ist noch viel schöner geworden, als ich sie in Erinnerung hatte. Das Jahr auf dem Landsitz ihres Vaters in Surrey hat ihr gutgetan.«
»Denkst du daran, ihr einen Antrag zu machen?«, fragte Hugh.
»Warum sollte ich?«, lautete die Gegenfrage. »Ich sagte dir doch schon, dass ich vorhabe, mein Leben als Junggeselle zu beschließen.«
»Ja, was willst du denn dann von ihr?«, wollte Hugh wissen.
»Ja, was will ich denn dann von ihr?«, echote Willowby mit unverkennbarem Spott.
»Richard!«, rief Hugh Deverell entsetzt aus. »Sie ist die Tochter des Earl of Aberfield. Eines der unangenehmsten und einflussreichsten Männer des Königreiches.«
»Ich weiß, dass er ein aufbrausender, alter Esel ist«, entgegnete Mr. Willowby sorglos, »aber ich will schließlich ein Verhältnis mit seiner Tochter beginnen. Nicht mit ihm.«
»Wie man hört, wünscht Aberfield die Verbindung seiner Tochter mit dem Earl of Tremaine«, meldete sich Lord Bridgegate zu Wort. Diese Bemerkung schien seinen Freund nicht von seinem Vorhaben abbringen zu können. Im Gegenteil. »Fein«, sagte er. »Wenn sie wirklich abermals einen Mann heiraten soll, der um vieles älter ist als sie, wird sie sich umso mehr nach einem jugendlichen Liebhaber sehnen.«
»Und dieser jugendliche Liebhaber bist du?«, vergewisserte sich der ehrenwerte Hugh Deverell.
»Sehr richtig«, bestätigte Richard grinsend. »Und nun gehe ich nach Hause. Ich muss morgen Nacht bei Kräften sein. Danke für diesen Abend, Hugh. Er war wirklich äußerst erfreulich. Ich scheine eine wahre Glückssträhne zu haben, die Taschen voll Geld, die reizvollste Frau der Stadt in Kürze in meinem Bett. Herz, was willst du mehr?«
Hätte Richard Willowby in diesem Augenblick geahnt, wie sehr sich in den nächsten sieben Tagen sein Leben verändern würde, seine freudige Zuversicht wäre wohl schlagartig gebremst worden.
II.
Es begann damit, dass sich seine Schwester unerträglich langweilte. Neben ihren Brüdern Richard und George war Hetty die jüngste unter den drei Geschwistern Willowby. Eine fröhliche, aufgeweckte, bisweilen auch launenhafte Achtzehnjährige. Sie lebte seit dem Tod ihrer Mutter bei der kinderlosen Schwester ihres Vaters und deren Gatten in Brighton. Bis zu ihrem sechzehnten Geburtstag hatte sie das Institut für höhere Töchter der ehrenwerten Mrs. Lutham in Worthing besucht und ihre Verwandten nur in den Ferien gesehen. Wie jedes adelige Mädchen ihres Alters malte sie sich in dieser Zeit ihr glanzvolles Debüt in der Hauptstadt in den prächtigsten Farben aus. Doch es sollte ein Traum bleiben. Denn seit zwei Jahren wartete sie nun darauf, endlich ihre erste Saison in London verbringen zu dürfen. Vergebens. Immer wieder fanden Onkel und Tante einen Grund, den versprochenen Aufenthalt in der Hauptstadt zu verschieben. Zuerst war eine Reise auf den Kontinent, um Verwandte zu besuchen, wichtiger. Gut, das hatte Hetty verstehen können, und die Fahrt nach Frankreich war ja wirklich ein aufregendes und unterhaltsames Erlebnis gewesen. Im nächsten Jahr jedoch war der Aufenthalt in London wegen des verletzten Knies ihres Onkels verhindert worden. Er war kurz vor dem geplanten Termin vom Pferd gefallen, und für Tante Mable kam es nicht infrage, dass sie den armen Onkel Jonathan alleine ließ, um ihre Nichte nach London zu begleiten.
Das hatte Hetty nur zähneknirschend zur Kenntnis genommen. Und in diesem Jahr schien es lange Zeit so, als würden Onkel und Tante gar nicht auf die Idee kommen, nach London zu fahren. Also hatte Hetty die Initiative ergriffen. Sie begann, von nichts anderem mehr zu sprechen als von ihrem bevorstehenden Debüt. Sie schwärmte ihrer Tante vor, wie amüsant es für sie alle werden würde. Als diese Taktik nichts nützte, verlegte sie sich aufs Betteln, schließlich schmollte sie und war unausstehlich. Gerade als sie dachte, sie hätte ihre Verwandten überzeugt, bekam Tante Mable einen Schwächeanfall. Sie zog sich in ihre Gemächer zurück, und der sofort herbeigeholte Arzt der Familie riet dringend davon ab, dass Mylady die beschwerliche Reise nach London auf sich nehme. Und dann noch der Trubel, der in der Hauptstadt herrschte, die Veranstaltungen, die oft bis in den frühen Morgen dauerten! Keinesfalls sollte sich Mylady mit ihrer schwachen Konstitution diesen Strapazen aussetzen!
Während Hetty enttäuscht die Zähne zusammenbiss und sich verstohlen die Tränen aus den Augenwinkeln wischte, hatte sich die Tante mit befreitem Aufseufzen in ihre Kissen zurückgelehnt. Das war vor gut einer Woche gewesen. Tante Mable hatte sich erstaunlich rasch von ihrem Schwächeanfall erholt. Es ging ihr bereits wieder viel besser, und doch beteuerte sie, dass die Erwähnung des Wortes »London« allein ausreichte, um einen schlimmen Rückfall zu verursachen.
Hetty stand in ihrem Zimmer und betrachtete sich eingehend in dem mannshohen, in einen reich verzierten Holzrahmen gefassten Spiegel. Ihre blonden Locken fielen in leichtem Schwung auf ihre Schultern. Die großen, blauen Augen, auf die sie selbst besonders stolz war, unterstrichen die Zartheit ihres schmalen Gesichts. Sie war wirklich hübsch. Und auch ihre Figur konnte sich sehen lassen. Hetty drehte und wendete sich, um sich in Ruhe von allen Seiten zu betrachten. Sie fand nichts, woran sie etwas auszusetzen gehabt hätte. Es war eine Schande, eine Schönheit wie sie auf dem Lande zu verstecken.
Im Sommer, wenn die vornehme Gesellschaft nach Brighton übersiedelte, wenn das bunte Leben in den Straßen und Plätzen rund um den berühmten Royal Pavilion des Prinzregenten Einzug hielt, dann hatten ihre Verwandten jedes Jahr die Koffer gepackt. Sie waren mit ihrer Nichte nach Rye gefahren, um auf dem Landsitz von Onkels Bruder James den Sommer zu verbringen. Das Haus in der Marine Parade in Brighton wurde zu einem ansehnlichen Betrag stets an dieselbe Londoner Adelsfamilie vermietet. Das so verdiente Geld wurde den bereits angesammelten Ersparnissen dazugeschlagen. Ausgegeben wurde nur das Nötigste. Und so war Hettys Garderobe nicht so umfangreich, wie sie es sich gewünscht hätte. Wenn sie auch zugeben musste, dass sie eine Reihe ganz reizender Tageskleider besaß und das neue Reitkleid im Husarenstil mit Epauletten an den Schultern sogar in der Hauptstadt einen guten Eindruck machen würde.
Letzten Winter, als Großmutter, die Mutter ihrer leider so früh dahingegangenen Mama, in Rampstade Palace gestorben war und ihr Bruder George mit einem Male unermesslich reich geworden war, da hatte sie erwartet, George würde sie zu sich einladen. Er und seine Frau Henrietta, die wie sie selbst Hetty gerufen wurde, würden sie in die Gesellschaft einführen. Aber nichts dergleichen war geschehen. Es war ja wirklich ein dummer Zufall, dass sie einen Tag, bevor sie zu Großmutters Beerdigung abreisen sollte, an Masern erkrankte. Sicher hätte sie George überreden können, ihr Debüt in der Hauptstadt zu geben, wenn sie ihm erst einmal persönlich gegenübergestanden wäre. Aber so war das unmöglich gewesen. Und die Briefe, die sie ihm in sein neues Zuhause nach Rampstade Palace geschickt hatte, waren unbeantwortet geblieben.
Typisch George. Ein freundlicher, liebenswerter Mensch, aber viel zu egoistisch, um an die Zukunft seiner Schwester zu denken. Und schreibfaul war er überdies. Es blieb ihr nichts anderes übrig: Sie musste mit George sprechen. Sicher hielt er sich zurzeit, zu Beginn der Saison, im Haus, das er von Großmutter geerbt hatte, am Londoner Grosvenor Square auf. Dorthin musste sie gelangen. George würde es nicht übers Herz bringen, sie zurückzuschicken. Vor ihrem geistigen Auge erschien ihr Ebenbild in all den bezaubernden Abendroben, die ihr Bruder für sie schneidern lassen würde. Mit all den atemberaubenden Hutkreationen, umringt von einer nicht enden wollenden Schar von Verehrern. Hetty wandte sich energisch vom Spiegel ab. Sie würde nicht länger hoffen und träumen. Sie würde ihr Schicksal selbst in die Hand nehmen.
Mit raschen Schritten war sie bei ihrer Kommode und nahm eine prall gefüllte Ledermappe aus der obersten Schublade. Erst gestern hatte sie durch Zufall in einer der Lanes, einem der hübschen Gässchen des Ortes, ein Schreibwarengeschäft entdeckt, das eben das Büttenpapier mit dem zarten Goldrand führte, das George verwendet hatte, um ihr und ihren Verwandten den Tod der Großmutter mitzuteilen. Sie hatte einen Bogen davon besorgt. Nun musste sie sich nur noch bemühen, die Schrift so zu verstellen, dass sie der ihres Bruders ähnlich war. Hetty holte sein letztes Schreiben hervor und begann, mit trockener Feder die Schriftzüge nachzuvollziehen. Das erschien ihr nicht weiter schwierig. Zum Glück hatte sie den Briefumschlag aufgehoben. So konnte sie den Eindruck vermitteln, als sei ihr Schreiben tatsächlich aus London gekommen. Sollte es ihr Onkel seltsam finden, dass das Kuvert, obwohl an ihn gerichtet, bereits geöffnet war, so würde sie dies damit entschuldigen, dass sie so gespannt gewesen sei, was George schrieb, dass sie, ohne nachzudenken, den Umschlag geöffnet habe. Sicher würde ihr Onkel diese Neugierde verzeihen. Wenn er es überhaupt bemerkte. So weit war der Plan perfekt.
Schwieriger würde es allerdings werden, ihre Tante davon zu überzeugen, sie ohne Anstandsdame nach London reisen zu lassen. Aber Hetty wäre keine echte Willowby gewesen, wenn sie sich ernstlich Gedanken über dieses Problem gemacht hätte. Zu gegebener Zeit würde sich auch dafür eine passende Lösung finden. Um ein zügiges Schriftbild bemüht, begann sie zu schreiben. Zum Glück konnte sie den Brief kurz halten, denn George war kein Freund langer Worte. Verehrte Tante, verehrter Onkel!, schrieb sie und verglich ihre Schrift mit der ihres Bruders. War durchaus annehmbar. Meine Gattin und ichsind übereingekommen, dass wir, … Hetty stockte, sollte sie »liebe Schwester« schreiben, oder war das zu auffallend? Sie entschied, es bei Schwester Hetty zu belassen, … in die Gesellschaft einführen sollten. Euer Einverständnis vorausgesetzt, ersuche ich Euch, ihr Eure Kutsche zu leihen und sie nach London zu schicken. Für die Kosten des Debüts komme selbstverständlich ich auf. Euer Neffe George. Sie hatte das Schreiben beendet und wollte eben Sand auf das Blatt streuen, als sie Schritte vernahm, die sich ohne Zweifel ihrer Tür näherten. Rasch klappte sie ihren Sekretär zu.
Keine Minute zu früh, denn ihre Tante betrat das Zimmer. In ihrer Rechten schwenkte sie einen zartgelben Briefbogen, in ihrer Linken die Augengläser, die sie seit einiger Zeit zum Lesen benötigte.
»Stell dir vor, mein Kind, wir bekommen Besuch!« Sie stutzte und warf einen erstaunten Blick auf ihre Nichte. »Warum um alles in der Welt sitzt du hier regungslos vor deinem Sekretär? Warst du eben dabei, einen Brief zu schreiben?«
»Nein, nein!«, beeilte sich Hetty zu versichern, »ich wollte nur, ich war dabei …« Es fiel ihr nichts Passendes ein, was sie getan haben könnte. »Wer kommt zu Besuch?«, fragte sie stattdessen. Ihr Interesse war nicht wirklich echt. Onkel und Tante bekamen selten Besuch. Und wenn, dann waren es alte Leute wie sie selbst, die Erholung an der See suchten und sich dazu einige Tage oder Wochen bei ihnen einquartierten. Doch nun musste sie Neugierde vortäuschen, um ihre Tante abzulenken. Das gelang zum Glück.
»Catharine de la Falaise«, erwiderte Tante Mable nun zu Hettys wirklicher Überraschung. »Du kannst dich doch noch an sie erinnern, nicht wahr? Wir haben sie vor zwei Jahren in Frankreich besucht.«
Hetty war aufgesprungen. »Aber natürlich erinnere ich mich an Catharine!«, rief sie aus. »Wir haben eine so schöne Zeit in La Falaise verbracht! Wann kommt sie? Wie lange wird sie bleiben? Wird ihr Gatte, der Marquis, sie begleiten?«
»Aber Henrietta!«, rief ihre Tante aus. Sie nannte Hetty nur dann bei ihrem vollen Namen, wenn sie ernsthaft entrüstet war. »Der Marquis de la Falaise ist vor einem Jahr gestorben. Wir haben dir doch davon erzählt. Wie kannst du das vergessen haben?«
»Oh, jetzt erinnere ich mich. Wie froh muss Catharine sein, dass er tot ist!«
»Henrietta!«, rief Mylady erneut.
»Aber war er denn nicht ein unangenehmer Mensch und noch dazu um so vieles älter als sie?«, wandte Hetty ein.
»Über Tote spricht man nur Gutes«, mahnte Mylady, obwohl sie im Stillen ihrer Nichte recht geben musste. »Nun, da das Trauerjahr sich dem Ende zuneigt, hat Catharine beschlossen, in ihre Heimat zurückzukehren. Der Brief hat geraume Zeit gebraucht, bis er uns erreichte. In der Zwischenzeit hat Catharine sicher bereits die Reise nach Calais angetreten. Sie wird in Kürze das Schiff besteigen, und wir können sie in den nächsten Tagen erwarten. Catharine ist die Nichte meines Mannes, wie du weißt. Die Tochter seiner Zwillingsschwester Samantha, mit der ihn ein sehr inniges Verhältnis verband, bevor sie leider allzu früh verstarb. Dein Onkel ist einer ihrer nächsten Verwandten. Daher wird sie zu uns kommen, bis sie sich entschieden hat, wo sie sich niederlassen wird.«
»Aber sie hat doch einen Bruder«, fiel Hetty ein.
»Sprich in meiner Gegenwart nicht von Milwoke!«, befahl die Tante und griff mit der Hand an ihr angeblich so schwaches Herz. »Ein unmöglicher Mensch. Wie übel er seiner Schwester mitgespielt hat. Ich will gar nicht daran denken. Ich werde sofort Bescheid geben, dass das Rosenzimmer vorbereitet wird. Du kannst dich in der Zwischenzeit umziehen. Wir essen in einer Stunde.« Mit diesen Worten verließ sie das Zimmer und ließ ihre Nichte mit klopfendem Herzen zurück.
»Geschafft! Ich habe es geschafft!«, rief diese aus und tanzte in freudiger Erregung, sich ständig um die eigene Achse drehend, durch den ganzen Raum. Catharine de la Falaise war ein Geschenk des Himmels! »Geschafft, geschafft!«, jubelte Hetty immer wieder, bevor sie sich schließlich erschöpft auf ihr Bett fallen ließ. Die erste vage Idee begann rasch Gestalt anzunehmen. Ihre Tante und ihr Onkel hätten nie gestattet, dass sie sich alleine auf die Reise nach London begab. Doch nun war sie nicht länger alleine. Catharine würde sie begleiten! Ihre Tante hatte gesagt, Catharine wüsste noch nicht, wo sie sich niederlassen würde. Aber das beunruhigte Hetty nicht ernsthaft. Wo sonst sollte es eine junge, gut aussehende, vermögende Witwe hinziehen, die endlich ihre Freiheit genießen wollte, wenn nicht in die Hauptstadt? Nun brauchte sie den Brief, den angeblich George geschrieben hatte, nur noch ihren Verwandten unterzujubeln. Am nächsten Morgen würde sie sich neben das Tablett mit der Post stellen, das Mebrough, der Butler, der zugleich Kammerdiener ihres sparsamen Onkels war, stets auf das Buffet im Frühstückszimmer stellte. Dann würde sie so tun, als habe sie das Schreiben eben geöffnet. Nicht mehr lange, und sie würde nach London aufbrechen. Mit einem glücklichen Lächeln auf den Lippen machte sie sich daran, sich für das Dinner umzukleiden.
III.
Die junge Witwe in ihrem tiefschwarzen Kleid aus schwerer Seide stand an der Reling und blickte mit wachsender Besorgnis auf die unruhig auf und ab rollenden Wogen. Ihr langer, bis zur Taille reichender schwarzer Spitzenschleier flatterte im aufbrausenden Wind. Hoffentlich war diese Fahrt bald vorüber. Sie hatte Seereisen noch nie gut vertragen, doch so übel wie dieses Mal war es ihr noch nie ergangen. Ihre Hände umklammerten das eiserne Geländer. Hoffentlich muss ich mich nicht noch einmal übergeben, dachte sie beunruhigt. Das flaue Gefühl im Magen schien sich von Minute zu Minute zu verstärken. Erschrocken zuckte sie zusammen, als sie von der tiefen Stimme des Ersten Offiziers angesprochen wurde. Sie hatte nicht gehört, wie er näher gekommen war.
»Ich würde Ihnen empfehlen, die Kabine aufzusuchen, Madame«, sagte dieser nach einer höflichen Verbeugung. »Die Wolken über uns zeigen, dass wir in eine Regenzone einfahren.«
Wie um seine Worte zu bestätigen, klatschten die ersten dicken Tropfen auf die Planken des Schiffes. Catharine de la Falaise bedankte sich für diesen Rat und beeilte sich, ihn zu befolgen. Das Schiff schaukelte unruhig auf den Wellen, und sie brauchte geraume Zeit, um die Tür aufzusperren und die Schiffslampen in ihrer düsteren Kabine anzuzünden. Aufseufzend ließ sie sich auf den einzigen, fest verankerten Stuhl gleiten. Dabei fiel ihr Blick zufällig in den kleinen Spiegel, der oberhalb des Waschtisches angebracht worden war. Wie blass sie aussah! Die Wangen waren eingefallen, tiefe, dunkle Ringe hatten sich um ihre Augen eingegraben. Die Strapazen der Reise standen ihr deutlich ins Gesicht geschrieben. Und dann noch dieser schreckliche Schleier, der ihre dunkelblonden Haare fast zur Gänze verdeckte.
Catharine presste ihre Lippen aufeinander. Gervais, dachte sie bitter. Er verfolgte sie über seinen Tod hinaus. Wie konnte er nur in seinem Testament bestimmen, dass sie diesen schweren, unkleidsamen Schleier tragen musste. Ein ganzes Jahr lang. Zehn Tage noch, dann war das Trauerjahr vorüber. Dann würde sie die ungeliebte schwarze Garderobe eigenhändig verbrennen. Wo sie sich wohl aufhalten würde, in zehn Tagen? Sofort nach ihrer Ankunft wollte sie zu Onkel Jonathan nach Brighton fahren. Hoffentlich hatte er rechtzeitig ihr Schreiben erhalten. Es würde ihr guttun, ein paar Tage in Ruhe auszuspannen. Doch sie würde nicht lange bleiben.
Sie musste sich endlich entscheiden, wo sie ihr weiteres Leben verbringen und wie sie es gestalten wollte. Zumindest bis das Geld kam, das ihr nach dem Tod ihres Gatten rechtmäßig zustand. Gervais hatte sie, zur Überraschung aller Anverwandten und nicht zuletzt zu ihrer eigenen, zur Haupterbin eingesetzt. Seinem Neffen Roger de la Falaise, dem Erben des Titels, sollte nur ein relativ kleiner Teil des Vermögens zufallen. Es war abzusehen gewesen, dass Roger sich damit nicht zufriedengeben würde. Seit seiner Kindheit hatte er sich als Alleinerbe seines Onkels gefühlt. Nun dachte er nicht daran, kampflos aufzugeben. Ohne zu zögern, hatte er das Testament angefochten. Catharine ballte ihre Hände zu Fäusten. Roger. Sie würde ihn am liebsten ein für alle Mal vergessen. Und doch war die Erinnerung an diesen gut aussehenden jungen Mann so lebendig wie immer. Wie hatte sie sich je einbilden können, gerade ihn zu lieben?
Catharine seufzte und begann langsam ihr Kleid aufzuknöpfen. Ohne die Hilfe einer erfahrenen Zofe war das gar nicht so einfach zu bewerkstelligen. Zudem begann das Schiff immer stärker zu schlingern. Endlich konnte sie sich auf dem schmalen, harten Bett ausstrecken. Sie zog die Decke bis zum Kinn. Noch etwa vier Stunden, dann würde das Schiff anlegen. Sie lag regungslos und starrte auf die graue Decke ihrer Kabine. Ihre Gedanken wanderten fünf Jahre zurück, zu jenem sonnigen Frühlingsnachmittag, an dem sie Roger de la Falaise zum ersten Mal begegnet war. Sie war gerade siebzehn Jahre alt geworden und sollte in dieser Saison in die Gesellschaft eingeführt werden. Papa lebte damals noch. Ihr Bruder Henry hatte sich kürzlich mit Lady Esther Linchford, der einzigen Tochter eines Barons, verehelicht. Von dem Tag dieser Hochzeit an hatte sich Catharines Leben drastisch verändert. Sie war immer Papas Liebling gewesen. Nach dem frühen Tod der Mutter wurde sie von ihm und ihrem um zehn Jahre älteren Bruder verwöhnt und umsorgt. Sie war Mittelpunkt der kleinen Familie gewesen, in der man es sich, obwohl die finanziellen Mittel nicht zum Besten standen, gut gehen ließ. Zu dritt unternahm man Jagdausflüge auf dem Land, man besuchte die Oper oder Theateraufführungen zusammen. Und es wurde viel gescherzt und gelacht. Das änderte sich schlagartig, als Henrys Frau, Esther, in die Familie eindrang und unbarmherzig das Kommando an sich zog. Sie war Anfang dreißig, fünf Jahre älter als ihr Gemahl. Eine forsche, dominierende junge Frau, die es gewöhnt war, ihren Willen überall durchzusetzen. Und sie setzte ihn auch hier durch. Denn Esther war reich. Mit ihrem Geld wurden die längst notwendigen Reparaturen auf dem Landsitz Berdington Hall bezahlt. Mit ihrem Geld wurde das Stadthaus am Hanover Square neu eingerichtet. Ihr Geld ermöglichte Henry die elegante Garderobe, mit der er sich, stolz wie ein Pfau, seinen Freunden präsentierte. Ihr Geld verschaffte Papa ein langersehntes Gespann vollblütiger Rotfuchsstuten. Sie erreichte, dass ihr sowohl ihr Mann als auch ihr Schwiegervater zu Dank verpflichtet waren. Und beide Männer, ohnehin nicht von entschlossenem und starkem Charakter, ließen es zu, dass Esther künftig über ihr Leben bestimmte. Zu ihrer Dankbarkeit gesellte sich nach kurzer Zeit auch die Furcht vor der spitzen Zunge der neuen Hausherrin, die jede Äußerung, die ihren Plänen zuwiderlief, im Keim erstickte.
Die einzige Bewohnerin des Hauses, die sich gegen die Veränderung in ihrem Leben entschieden zur Wehr setzte, war Catharine. Kategorisch lehnte sie jedes noch so kleine Geschenk ihrer Schwägerin ab. Wohl wissend, dass diese als Gegenleistung immerwährenden Gehorsam erwartete. Nein, sie würde sich nicht für Geld zur Marionette machen lassen. Sie würde die erste Möglichkeit nützen, das Haus zu verlassen, in dem sie sich nun nicht mehr länger zu Hause fühlte. In dieser Situation war Roger de la Falaise in ihr Leben getreten. Im Sattel eines stolzen Rappen sitzend, ritt er im Hydepark direkt auf die Kutsche zu, in der sie in Begleitung ihrer ungeliebten Schwägerin eine Ausfahrt unternahm. Es kam nicht oft vor, dass sie mit Esther zusammen eine Spazierfahrt unternahm. Doch an diesem Tage hatte ihre Schwägerin so vehement darauf bestanden, dass Catharine um des lieben Friedens willen zugestimmt hatte. Catharine hätte sich noch jetzt dafür ohrfeigen können. Wie hatte sie damals nur so dumm sein können? Warum hatte sie dieses abgekartete Spiel nicht durchschaut? Wie hätte sie aber auch ahnen sollen, welchen schändlichen Plan Esther und dieser gut aussehende französische Edelmann gemeinsam ausgeheckt hatten? Nein, sie war an diesem Nachmittag weit davon entfernt gewesen, Böses zu ahnen. Sie hatte nur Augen gehabt für diesen hübschen jungen Mann mit den kurz geschnittenen schwarzen Locken. Die azurblaue Reitjacke unterstrich die tiefblaue Farbe seiner Augen, die, wie es schien, bewundernd auf sie gerichtet waren. Ein Blick in diese Augen hatte genügt, und Catharine hatte sich Hals über Kopf in ihn verliebt. Damit hatte sie sich den beiden Intriganten ausgeliefert. Esther hatte sie loswerden wollen. Sie duldete keine Person in ihrem Haus (und nachdem sie so großzügig investiert hatte, betrachtete sie das Palais am Hanover Square als ihr Haus), die ihr widersprach und die auch ihren Mann ermutigte, sich gegen sie aufzulehnen. Und sie dachte auch nicht im Traum daran, sich den Mühen auszusetzen, ein junges Mädchen in die Gesellschaft einzuführen. Noch dazu ein Mädchen, das viel hübscher war, als sie je gewesen war und das bei Weitem mehr Anklang finden würde. Sie hatte längst beschlossen, Catharine zu verheiraten. Und zwar so rasch wie möglich und an einen Mann, der sie von London fernhielt.
Catharine hatte nie erfahren, wo Esther Roger kennengelernt hatte, noch ob ihr Bruder in die Pläne seiner Frau eingeweiht gewesen war. Sie hatte sich darüber oft den Kopf zerbrochen. Sie konnte es einfach nicht glauben, dass ihr Bruder, der liebenswürdige, etwas unbeholfene Henry, eine derartige Idee gutgeheißen haben konnte. So kam es, wie es kommen musste. Roger ging im Haus am Hanover Square ein und aus. Er war ein stets gern gesehener Gast, hatte Catharine ins Theater und in Konzerte geführt. Und auf dem ersten Ball, den sie besuchen durfte, tanzten die beiden zwei aufeinanderfolgende Tänze miteinander. Damit war für erfahrene Beobachter klar, dass sich die hübsche Tochter des Herzogs von Milwoke für den vornehmen, aber verarmten Emigranten Roger de la Falaise entschieden hatte, noch bevor ihre erste Saison richtig begann. Was die Beobachter nicht wussten und was Catharine nicht im Entferntesten ahnte: Roger war bereits verheiratet. Nicht glücklich allerdings. Seine Frau Jeannette war nicht mit nach England gekommen, sondern im Landhaus des Onkels ihres Gatten in der Normandie zurückgeblieben.
Roger hatte seine eigenen Gründe, Catharine nicht in seine Familienverhältnisse einzuweihen. Stattdessen fragte er sie eines Abends, ob sie ihn heiraten wollte. Es war ein sternenklarer Frühsommerabend gewesen, nur der Vollmond hatte die abendliche Stille erleuchtet. Catharine erinnerte sich, als wäre es gestern gewesen. Und sie erinnerte sich daran, mit welch ehrlich empfundener Freude sie den Antrag angenommen hatte. Ihr Vater war zwar traurig gewesen, seine geliebte Tochter schon so bald zu verlieren. Und doch wollte er sich ihrem sehnsüchtigsten Wunsch nicht widersetzen. Die Hochzeit wurde im kleinen Rahmen in der St.-George-Kirche am Hanover Square gefeiert, direkt gegenüber ihrem Elternhaus. Roger hatte darum gebeten. Er wollte kein Aufsehen erregen. Schließlich lag England mit seinem Heimatland im Krieg. Auch wenn er als Mitglied des alten Hochadels vor dem Regime des korsischen Ungeheuers Napoleon geflohen war, würden doch ihm als Franzosen viele Leute nicht mit Wohlwollen begegnen.
So waren nur ihr Vater und Henry als die beiden Trauzeugen anwesend. Und natürlich Esther. Mit einem triumphierenden Lächeln auf ihren schmalen Lippen saß sie in der ersten Reihe des leeren Kirchenschiffes. Catharine hatte dieses Lächeln wohl bemerkt, doch sie konnte sich keinen Reim darauf machen. Dass der Pfarrer sie fragte, ob sie bereit war, Gervais Roger de la Falaise zu ihrem Ehemann zu nehmen, ihn zu lieben, ihm zu gehorchen und ihn zu achten, bis dass der Tod sie scheide, hatte sie nicht weiter verwunderlich gefunden. Ihre beste Freundin aus dem Institut für höhere Töchter, das sie besucht hatte, hieß auch Anne Sophia und wurde doch von allen Sophia gerufen. Warum sollte daher nicht auch Roger einen anderen ersten Vornamen haben?
Die Trauungszeremonie war rasch vorüber, die Heiratsurkunden für Gervais Roger und Catharine ausgestellt. Und schon standen die Kutschen bereit, die das junge Paar nach Dover bringen sollten. Rogers Plan, seine Braut nach Frankreich zu bringen, war ihr anfangs unverständlich erschienen. War nicht Roger erst kürzlich aus dem Lande seiner Väter geflohen? Papa war alles andere als begeistert von diesem Gedanken. Viel zu riskant war dieses Unternehmen, eine zu große Gefahr für seine einzige Tochter. Doch Roger hatte nicht lockergelassen. Er kenne alle Wege, seine geliebte Braut unbeschadet in die Normandie zu bringen. Und auf La Falaise sei sie vor jeder Gefahr sicher. Er jedoch spüre das innere Verlangen, seine Braut seinem Onkel vorzustellen. Ohne den Segen des Familienoberhauptes war für ihn die Ehe nicht richtig geschlossen. Catharine lachte bitter auf: den Segen seines Onkels! Wie hatten sich nur alle so täuschen lassen können? Für Roger hatte keinerlei Segen auch nur die geringste Bedeutung. Ihr Vater hatte schweren Herzens die Zustimmung zur Abreise gegeben.
Der Schock, der Catharine in Frankreich erwartete, war groß. Es dauerte nicht lange, und der liebende Bräutigam zeigte sich als das, was er war: ein Glücksritter, der bereit war, für Geld seine Seele zu verkaufen. Und Geld hatte er zweifach erhalten. Einmal von Esther, um ihr ihre unliebsame Schwägerin vom Leib zu schaffen. Einmal von seinem Onkel dafür, dass er ihm eine junge englische Lady als seine zweite Gemahlin zuführte.
Der Marquis de la Falaise war bereits einmal verheiratet gewesen. Corinne, seine erste Gattin, mit der er zwanzig Jahre mehr oder weniger glücklich verheiratet war, hatte ihm keine Kinder geschenkt. Darunter hatte er immer sehr gelitten und beschlossen, eine zweite Ehe zu wagen, um endlich den ersehnten Erben zu bekommen. Aus unerfindlichen Gründen war er zu der Ansicht gelangt, dass die jungen Mädchen in England fruchtbarer waren als gleichaltrige Französinnen. Also hatte er seinen Neffen gebeten, eine passende junge Dame nach Frankreich zu bringen. Das war der Hintergrund gewesen, der Roger zur Reise nach England veranlasst hatte. Denn Anlass für eine Flucht hatte es nie gegeben. Er und sein Onkel hatten es meisterhaft verstanden, sowohl in der Zeit unter Ludwig XVI. als auch später unter dem neuen Regime gut zurechtzukommen. Mit geschickten Worten und passenden, großzügigen Geschenken in die richtigen Hände war es dem Marquis gelungen, für sich und die Seinen ein Leben in Ruhe und Wohlstand auf La Falaise zu sichern.
Catharine fand sich auf einem einsamen Landsitz wieder, hoch auf den Klippen erbaut, die steil zu den brausenden Wogen des Atlantiks abfielen. Zitternd vor Empörung musste sie zur Kenntnis nehmen, dass sie nicht Roger, sondern dessen Onkel Gervais als ihren rechtmäßigen Gatten anzusehen hatte. Einen Mann, der mehr als vierzig Jahre älter war als sie, von einem stillen, unergründlichen Gehabe und einem wenig einnehmenden Äußeren.
»Ich musste es tun, Chérie», antwortete Roger, als sie ihn zur Rede stellte. »Hättest du mich je nach Frankreich begleitet, wenn es diese Scheintrauung nicht gegeben hätte?«
»Natürlich nicht«, hatte sie schroff erwidert.
»Na, siehst du«, sagte Roger, als sei es das Selbstverständlichste auf der Welt. »Ich jedoch hatte meinem Onkel versprochen, ihm eine junge Engländerin als Gattin zu präsentieren. Dieses Versprechen konnte ich nicht brechen: Schließlich bin ich ein Ehrenmann.«
Die letzten Worte waren von einem amüsierten Grinsen begleitet. Catharine hatte sich veranlasst gesehen, ihm ganz undamenhaft den erstbesten Gegenstand, dessen sie habhaft werden konnte, an den Kopf zu werfen. Zu ihrem Missvergnügen traf sie daneben, und die reich verzierte Vase zerschellte an der breiten Wand des Salons.
Es half ihr alles nichts. Vor Dritten beteuerte Roger Stein und Bein, dass er Catharine niemals geheiratet hatte. Im Gegenteil, er selbst sei dabei gewesen, als sein Onkel die reizende Engländerin zur Frau nahm. Sicher hätte sie ihm auch gefallen, fügte er dann jedes Mal mit einem scheinbar charmanten Lächeln hinzu. Doch seiner geliebten Jeannette wäre es nicht recht gewesen, wäre er mit einer Zweitfrau nach Hause gekommen. Mit diesem Scherz brachte er alle Zweifler schnell auf seine Seite. Zumal auch sein Onkel jedem erzählte, wie glücklich er war, so eine hinreißende Braut gefunden zu haben, und wie ergreifend die Zeremonie in der wunderschönen St.-George-Kirche gewesen sei. Sollte es da verwundern, dass auch die Dienerschaft, allesamt seit Jahren oder Jahrzehnten auf La Falaise tätig, jedem, der es hören wollte, erklärte, Onkel und Neffe seien zusammen in London gewesen?
Catharine suchte einen Anwalt auf. Die unter so falschen Voraussetzungen zustande gekommene Ehe musste doch aufgelöst werden können! Doch der Maître hörte sich ihre Version der Geschichte an, prüfte die Heiratsurkunde eingehend und schüttelte schließlich bedauernd den Kopf. Das Dokument war ohne Zweifel echt. Ob es wohl möglich wäre, dass Madames Nerven ein wenig angegriffen waren nach der weiten Reise? In Frankreich wurden viele Ehen nicht aus Liebe geschlossen, meinte der gütige alte Herr. Besonders nicht in Kreisen des Hochadels. Und trotzdem würden sie im Allgemeinen recht glücklich, wenn sich die Ehegatten erst einmal besser kennengelernt hätten. Catharine hatte die Anwaltskanzlei wütend verlassen.
Warum glaubte ihr niemand? Sie musste sofort zurück nach England! Auf dem schnellsten Wege! Doch leider war gerade das nicht möglich. Ihre Mitgift war, soweit es sich nicht um Möbelstücke oder Gegenstände handelte, die in London verblieben waren, von Roger an Gervais ausgehändigt worden. Natürlich hatte sich Roger einen beträchtlichen Betrag davon zur Abgeltung seiner Reiseunkosten einbehalten. Sie zählte die Münzen, die sich in ihrer Geldbörse befanden. Damit würde sie nicht einmal bis Calais kommen. An das Bezahlen der Überfahrt gar nicht zu denken. Sie schickte verzweifelte Briefe an ihren Vater. Sicher würde er sie nicht im Stich lassen. Seltsamerweise befassten sich die Briefe, die sie zahlreich von ihm zurückerhielt, in keiner Weise mit ihrem Problem. Er freue sich zu hören, dass es ihr gut gehe, schrieb der Herzog stattdessen. Und dass sie ihn nicht vergessen solle, in ihrem Glück. Viel später erst fand sie heraus, dass einer der Diener den Auftrag hatte, ihre Briefe abzufangen. Roger war ein Meister im Nachahmen von Schriften. Ohne Mühe hatte er gefälschte Briefe verfasst, um sie nach London zu schicken. Bis sie hinter diesen neuerlichen Verrat kam, hatte es Monate gedauert. Und kurz darauf war ihr Vater gestorben, ohne dass sie ihn wiedergesehen hatte. Ihr Bruder Henry erbte den Titel, und Esther war auf dem Gipfel ihres Triumphes. Von nun an war aus England keine Hilfe mehr zu erwarten.
Catharine begann sich in ihr Schicksal zu fügen. Es ging ihr nicht schlecht auf La Falaise. Roger war viel unterwegs. Das erleichterte ihren Aufenthalt. Die Gegenwart dieses Mannes, der ihre Gefühle mit Füßen getreten und sie schamlos hintergangen hatte, war nur schwer zu ertragen. Der Marquis de la Falaise, als dessen Frau sie ja nun galt, verbrachte die Tage auf der Jagd oder mit Ritten zu den Pächtern seiner ausgedehnten Besitzungen. Wenn er spätabends zurückkehrte, war er meist so müde, dass er sich nach dem gemeinsamen Abendessen bald in sein Schlafgemach zurückzog.
Er ließ seine junge Frau auf dem Landsitz frei schalten und walten. Sobald sich Catharine mit dem Leben abgefunden hatte, in das sie so unerwartet geraten war, begann sie ihre Rolle als Herrin des Hauses mit Eifer und Energie auszufüllen. Es gelang ihr, Ordnung in das Chaos zu bringen, das seit dem Tod von Gervais’ erster Frau auf La Falaise geherrscht hatte. Die vielen Aufgaben, die sie zu erfüllen hatte, die zahlreichen Pflichten, die sie sich selbst auferlegte, halfen ihr, den Kummer zu überwinden, den Roger ihr zugefügt hatte. Und sie verhinderten, dass sie in Selbstmitleid versank und damit ihr Dasein verschlimmerte. Trotz der weitreichenden Besitzungen schien die finanzielle Lage auf La Falaise nicht gerade rosig zu sein. Die Mittel, die der Marquis Catharine für die Haushaltsführung zur Verfügung stellte, waren äußerst knapp bemessen. Ein Umstand, der ihr seit ihrer frühesten Jugend nur zu gut bekannt war.
Aber hatte sie es nicht trotz des spärlich vorhandenen Geldes geschafft, ihr Vaterhaus umsichtig zu führen? Mit Improvisationstalent und Geschick war es ihr auch hier gelungen, diese Aufgabe mit Erfolg zu meistern. Manchmal fragte sie sich allerdings, ob ihr Gatte die vielen Veränderungen, die sie auf La Falaise bewirkte, überhaupt zur Kenntnis nahm. Er wechselte kaum ein persönliches Wort mit seiner jungen Frau. Auf Lob und Anerkennung aus seinem Munde wartete sie vergeblich. Und doch schien er allgegenwärtig zu sein. Manchmal tauchte er mit leisen Schritten hinter Catharine auf, wenn sie ihn am wenigsten erwartete. Sie erschrak dann heftig, doch aus seiner Miene war nicht zu erkennen, ob es sich bei diesen Vorfällen um Zufall handelte oder ob eine makabere Laune ihn dazu trieb, seine Gattin zu erschrecken.
Im Allgemeinen behandelte er sie mit der ihm eigenen Art wohlwollender Zerstreutheit. Die meiste Zeit schien er vergessen zu haben, dass sie überhaupt existierte, und wenn er doch einmal das Wort an sie richtete, dann nur, um sich zu erkundigen, ob sie nicht endlich den ersehnten Erben erwartete, oder ihr Aufträge zu erteilen, die sie an die Dienerschaft weiterzugeben hatte. Sie sprachen kaum miteinander, und der Marquis lebte das Leben weiter, das er vor der seltsamen Eheschließung geführt hatte.
Es geschah auch nicht oft, dass er darauf bestand, dass sie das Lager mit ihm teilte. Und wenn es doch einmal vorkam, dann war das eine rasche, völlig unerotische Angelegenheit. Catharine dachte mit einer Mischung aus Wehmut und Abscheu an jene Nächte zurück, da sie gedacht hatte, Roger sei ihr rechtmäßig angetrauter Gemahl. Es war typisch für seinen verderbten Charakter, dass er diese Situation ausgenützt hatte, obwohl er wusste, dass sie für seinen Onkel bestimmt war.
Der einzige Mensch, mit dem Catharine auf La Falaise Freundschaft schloss, war Jeannette, Rogers Frau. Sie war ein kleines, zartes Wesen,