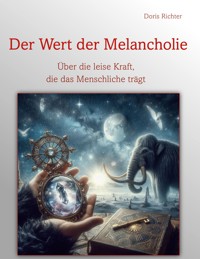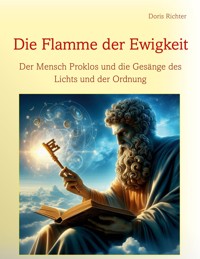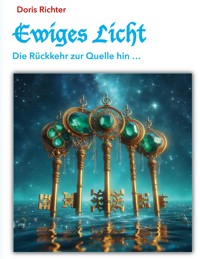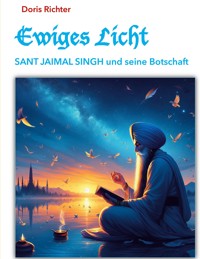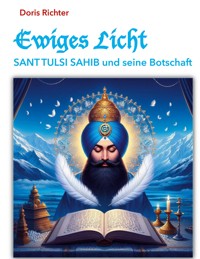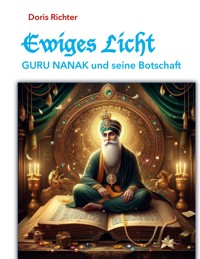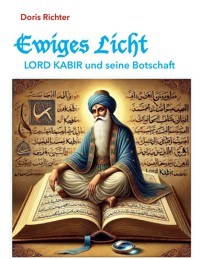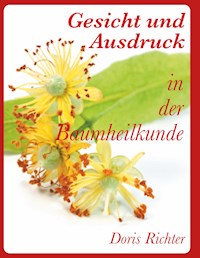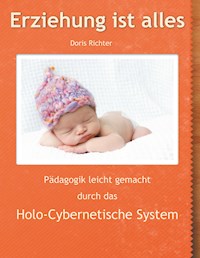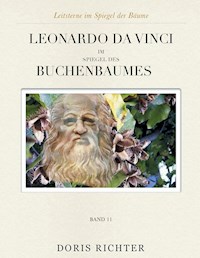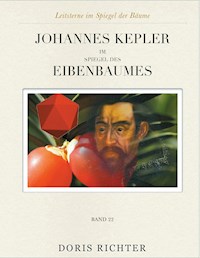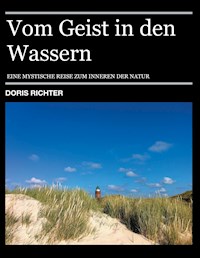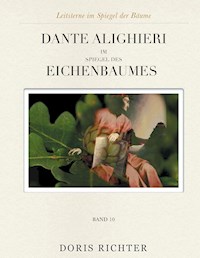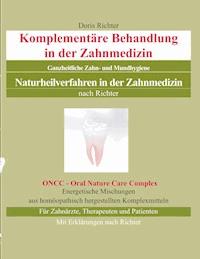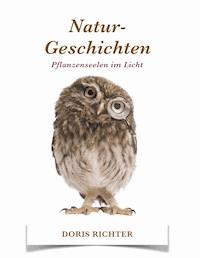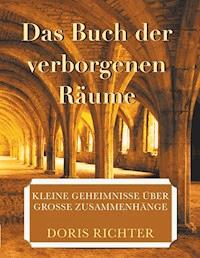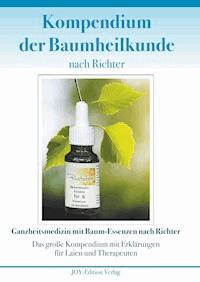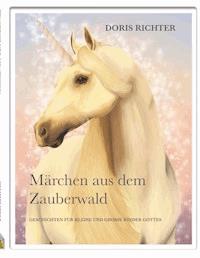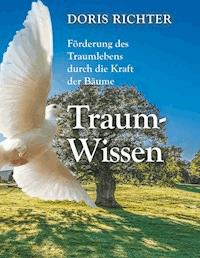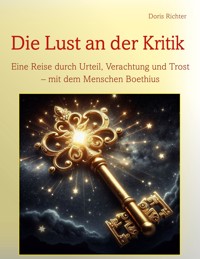
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die Autorin schreibt aus einer inneren Notwendigkeit heraus. Es geschieht mit Klarheit, Empathie und einem unbedingten Willen zur Deutung der "Lust an der Kritik". In ihrem Denken wird Kritik zur existenziellen Bewegung: nicht regressiv distanziert, nicht verschönernd oder dekorativ, sondern eingebettet in persönliche Erfahrung. Die Lust an der Kritik ist bei ihr kein bequemer Genuss, sondern ein riskanter Weg: Kritik kann aufrichten, aber auch verletzen. Kritik ist ein scharfes Werkzeug, das Verantwortung verlangt. Der große Philosoph Boethius steht im Zentrum dieser Auseinandersetzung. Als Gefangener im Kerker ringt er nicht nur mit Fragen des Schicksals, sondern mit dem Gewicht eines Urteilssystems, das sich selbst nicht mehr befragen lässt. Sein Trost der Philosophie ist eine stille, prüfende Form der Kritik. Sie ist getragen von Gedanken, welche niemals verstummen dürfen. Wenn sich die Autorin unsterblich gebliebenen Boethius zuwendet, begegnen sich zwei Haltungen, die Weigerung, sich mit einfachen Antworten zufriedenzugeben, und die Beharrlichkeit, weiterzudenken auch dort, wo es schmerzt. Kritik wird zur Form innerer Treue, zum Denken, zur Sprache und zur menschlichen Würde. Die Erkenntnis über das URWORT ist im EWIGEN LICHT. Das kluge Denken im bewussten Menschen wird zur Pflicht. "Das höchste Ziel des Menschen ist das Streben nach Wahrheit, nicht nach Meinung."
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 162
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über die Autorin
Doris Richter, geboren 1957, ist eine angesehene Heilpraktikerin, Autorin und Verlegerin mit über vier Jahrzehnten Erfahrung in der Komplementärmedizin. Seit 1988 führt sie ihre eigene Praxis für Komplementärmedizin und Naturheilverfahren in der Schweiz.
Als Gründerin des Verlags joyedition verbindet sie Wort und Bild auf einzigartige Weise, um ganzheitliches Wissen zugänglich zu machen.
Doris Richter ist weithin bekannt für ihre zahlreichen Veröffentlichungen über Baumheilkunde, Mystik, Philosophie, Spiritualität sowie naturheilkundliche Verfahren. Ihre Arbeit ist geprägt von tiefer Naturverbundenheit, spiritueller Weisheit und praktischer Heilkunde.
Sie leitet regelmässig Seminare und Workshops in diesen Bereichen und inspiriert Menschen dazu, Heilung, Erkenntnis und inneres Wachstum in Einklang mit der Natur zu erfahren
Widmung
Dieser Weg im Wort, getragen von Bildern,
Gedanken und innerem Sehen,
sei dir gewidmet, Mutter,
die du mir dieses Buch einst in die Hände gelegt hast
mit einem Wissen, das über das Wissen hinausging.
Du hast gespürt, dass das Schicksal von Boethius
in meinem Inneren eine Saite berühren würde,
die lange darauf gewartet hatte, zu klingen.
Dieses Werk geht in deine Hände zurück –
als Zeichen der Dankbarkeit, der Erinnerung
und des stillen Verstehens.
„Wenn du dein wahres Selbst erkennst, wirst du auch erkennen, dass du durch keine äusseren Umstände verletzt wurdest, sondern durch das Bild, das du von ihnen hattest.“
„Alles Dichten und Trachten der Menschen, wie es sich in ihren so mannigfaltigen Bestrebungen bestätigt, schlägt zwar äusserlich sehr verschiedene Wege ein, aber schliesslich läuft es doch immer auf das eine letzte Ziel hinaus, die Erlangung der Glückseligkeit.“
Anicius Manlius Severinus Boethius (480-524 n. Chr.)
INHALT
Vorwort
Einführung
I. Im Schatten der aufgehobenen Zeit – Wer war Boethius?
II. Zwischen den Zeiten – Boethius im Übergang
III. Die Philosophie – eine Begleiterin im Kerkerlicht
IV. Der Mensch im Kreis der Sphären
V. Der grosse Spiegel – Boethius erkennt sich selbst
VII. Das Schicksalsrad – Drehung des Irdischen und die Stille der Ordnung
VIII. Die Macht der Fortuna – Das verborgene Gericht
IX. Der innere Sturz – Macht, Misstrauen und die Geburt des Selbst
X. Das Leiden als Weg zur Freiheit? – Boethius und die Würde des inneren Menschen
XI. Die Lust an der Kritik – Prüfung, Freiheit und der Wille zum Sinn
XII. Trost als philosophische Kraft – Aufrichtung im Denken
Trost im Licht der Einsicht – Alfred Adler und die Bewegung zur Stärke
XIII. a - Kritik als Form der Selbsterkenntnis – Der innere Spiegel
Der Spiegel der Kritik – Das Auge der Welt und das Auge des Selbst
Der Stich der Kritik – Der Skorpion in der Enge
Fortuna, die Seelenärztin – Wandlung durch das Feuer
Das Gift als Medizin – Vom Stich zur Wandlung
Die eherne Schlange – Numeri 21, 4–9
XIII. b – Die eherne Schlange – Das Gift, das heilt
XIV. Philosophie und Therapie – Zwei Wege, ein Ursprung
XV. Kritik als Verwandlungskraft – Vom Zorn zur geistigen Klarheit
XVI. Das Wort im Angesicht der Ewigkeit – Denken als kosmische Spur
XVII. Die Musik der Sphären – Kosmos als Trost
XVIII. Das schweigende Denken – Das bleibende Werk des Boethius
XIX. Die Imagination der Seelenärztin – Das Bild im Auge des Denkens
XX. Die Vision der Seelenärztin – Im Garten des Lichts
Fortuna entrollt das Bild – Die Wandlung im Garten der Weisheit
Wer war Boethius – Eine Gestalt zwischen Welten
Die letzte Stunde
Anicius Manlius Severinus Boethius – Leben und Werk im Überblick
Hauptwerke des Boethius
1. De consolatione philosophiae (Der Trost der Philosophie)
2. Logische und philosophisch-theologische Werke
Bedeutung und Nachwirkung
Der lange Atem des Trostes – Die Nachwirkung des Boethius
Sein Trost, geboren aus der Zelle, wurde zu einem Licht, das sich in viele Räume ergoss
Der Trost der Philosophie – Ein inneres Buch, das bleibt
Von der Würde des Denkens in der Dämmerung der Welt
Eine Betrachtung über Boethius’
Trost der Philosophie
Über das feine Werkzeug des Geistes
Eine kulturgeschichtliche Betrachtung über Vernunft, Neid und die Kunst der
Unterscheidung
Das leuchtende Bestehen
Die Geschichte des Buches, das Licht trug
Der Kristall des Wissens
Das Leuchten im Innern – und das Ende des Spiels.
Über das Eine Gute
Boethius und sein ehrgeiziges Werk
Vom Kreis und dem Maß des Geistes
Boethius, Albertus Magnus und Thomas von Aquin – Eine Linie des Geistes
NACHWORT
Das Denken, das bleibt – Nachklang zu Boethius
„Woher kommt Streit, woher Krieg unter euch?“
MENSCHENWERK UND MENSCHENZEIT – SEELENEWIGKEIT
„Wie alt bist Du?“ - „Und weisst Du, wie alt wir wirklich sind?“
Wissenschaft
Das Gefühl
Der Geist
Die Seele
„Wie alt bist Du?“
Am Ufer Stehende
Das Buch im Buch zum Thema, Das Gift der Begriffe – Eine Fabel vom Denken, das erwacht / Ein poetisch-philosophisches Werk - Acht Kapitel und ein Nachwort
Einleitung: Der Ruf des URWORTES
I. Der Kreis der Gifte
„Das Gift der Begriffe“ – Teil I: Eine Tier-Anekdote über Porphyrios’ Frage
II. Die Logik der Arten
„Das Gift der Begriffe – Teil II: Die Wissenschaft spricht“
III. Der evolutionäre Spiegel
„Das Gift der Begriffe – Teil III: Die Evolution antwortet“
IV. Das Brot, der Wein und das Unsichtbare
„Das Gift der Begriffe – Teil IV: Boethius spricht“
V. Die schöpferische Kraft des Denkens
„Das Gift der Begriffe – Teil V: Brot, Wein und Wirklichkeit“
VI. Die Alchemie der Wandlung
„Das Gift der Begriffe – Teil VI: Vom Werden der Dinge“
VII. Die Kritik als Initiation
„Das Gift der Begriffe – Teil VII: Die Schöpferkraft des Denkens“
VIII. Das Erwachen der Dinge
Das URWORT – jenseits der Religionen
Das kreative Bewusstsein als Einweihung
„Das Gift der Begriffe – Teil VIII: Boethius und das Erwachen der Dinge“
Nachwort
Von Gift, Wandlung und Heilung
„Vom Stachel der Kritik“ – Ein letzter Blick
Das Geheimnis der goldenen Blüte im menschlichen Denken
Über die Autorin
Weitere Quellen und Empfehlungen
Weitere Quellen und Empfehlungen
Literatur Doris Richter
Empfehlung: Ewiges Licht –Lord Kabir (1398–1518), Bd. 1
Empfehlung: Ewiges Licht –Guru Nanak (1469–1539), Bd. 2
Empfehlung: Ewiges Licht – Sant Tulsi Sahib (1763–1843), Bd. 3
Empfehlung: Ewiges Licht – Sant Jaimal Singh Ji (1839–1903), Bd. 4
Empfehlung: Ewiges Licht – Die Rückkehr zur Quelle hin Bd. 5
„Die Lust an der Kritik“ – Boethius im Kerker
Ein Lied erhebt sich, schwach, im Kerkerdunkel,
ein Faden Ton, in Steinen kaum gehört.
Die Nacht ist schwer, das Denken tastet, funkelt,
ein Leuchten, das in Fesseln nicht zerstört.
Die Masse schweigt in mächtigen Systemen,
in Syllogismen kalt gestapelt Stein.
Doch durch das Denken dringen leise Themen,
die Fragen sind – und darum ewig sein.
Die Melodie, sie ringt in Akkordkaskaden,
in Dissonanz mit Welt und Machtgestellt.
Was Recht genannt wird, drückt in stummen Lagen,
was Wahrheit ist, wird nieder nur gezählt.
Doch in dem Innern tobt ein andres Streben:
Ein Geist, der aufrecht durch das Schweigen geht.
Was lebt, das fragt. Und was noch fragt, will leben,
selbst wenn das Urteil längst am Tore steht.
Vorwort
Wenn in dunkler Zeit der Lärm der Welt verstummt, beginnt das Denken zu sprechen. Es spricht leise, tastend, wie ein Bach durch dornige Täler, nicht laut, doch unaufhaltsam. So spricht auch dieses Buch, dessen Seiten nicht belehren, sondern einladen sollen, zum Nachdenken, zum Prüfen, zum stillen Widerstand gegen das schnelle Urteil.
Die Autorin folgt dem Pfad der Kritik nicht als Triumphzug, sondern wie jemand, der durch einen dichten Wald geht. Es geschieht mit gespannter Achtsamkeit, verwundbar, dennoch hellwach. Die Lust an der Kritik ist hier kein kühnes Gefecht, sondern ein inneres Gespräch. Es ist ernst, erschüttert. Es ist klar. Kritik, so zeigt sich, ist nicht bloß eine Bewegung des Verstandes, sondern eine des Herzens, das sich nicht abwendet.
In Boethius findet diese Haltung ein frühes Echo. Er, der im Kerker saß, verstoßen und verraten, wendet sich nicht der Rache zu, sondern der Philosophie. Sie tritt zu ihm wie eine stille Gefährtin, nicht tröstend im Sinn des Vergessens, sondern prüfend und aufrecht. Und in diesem ernsten Zwiegespräch blüht ein Gedanke auf, der durch die Jahrhunderte reicht: dass Denken Halt geben kann, wenn alles andere zerfällt.
Was die Autorin hier sucht und findet, ist nicht nur die Stimme eines alten Textes, sondern ein Maß für das eigene Sprechen. Kritik, das lehrt dieses Buch, ist eine Form der Treue: zu sich selbst, zur Sprache, zum Weltgewissen. Und wie bei vielen Philosophen und Dichtern zwischen den Zeilen oft ein fernes Lied erklingt, so tönt auch hier, leise und trotzig, ein Gedanke weiter.
Cham ZG in der Schweiz 2025, Doris Richter
Nun schauert das Feld,
Nun ruhen die Wälder,
Der Himmel wölbt
Sich einsam und weit.
Die Seele wird still
In den dämmernden Feldern,
Und horcht, wie die Zeit
Im Dunkel vergeht.
Joseph von Eichendorff
Einführung
„Woher kommt Streit, woher Krieg unter euch? Kommt’s nicht daher, aus euren Gelüsten, die da streiten in euren Gliedern? Ihr seid begierig und erlangt’s nicht, ihr mordet und neidet und gewinnt nichts, ihr streitet und kämpft, ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet, ihr bittet und empfangt’s nicht, weil ihr in übler Absicht bittet, nämlich damit ihr’s für eure Gelüste vergeuden könnt.“
Jakobus 4,1–3
In den weiten Hallen des Denkens, durch die der Mensch seit Jahrhunderten schreitet, erhebt sich ein stiller Widerhall, älter als jedes geschriebenes Wort, gegenwärtig in jedem ernsten Gedanken. Dort, wo sich der Geist nicht zerstreut, sondern sammelt, vollzieht sich ein Werk, das mehr dem Schmieden gleicht als dem Sprechen, ein Werk von Wärme, Form, Beständigkeit.
Seit Äonen entstehen hier geistige Werkzeuge, hervorgebracht nicht aus Eile, sondern aus innerer Glut. Klingen der Einsicht, Waagen der Gerechtigkeit, Spiegel der Selbsterkenntnis werden dort gestaltet. Wer denkt, lebt in dieser Werkstatt, im Bezirk des Prüfens, im Feld der Unterscheidung, im Tempel der Maßhaltung.
Jeder, der dort verweilt, trägt sein eigenes Feuer, hütet es, formt daraus das, was Bestand sucht im Wandel. Gedanken steigen auf, leicht und kühn, gelenkt vom Wunsch nach Erkenntnis, geführt vom Licht, das Klarheit bringt. Und je höher sie kreisen, je heller sie leuchten, desto stärker wächst die Würde der Verantwortung, die sie tragen.
In der Freiheit der Gedanken liegt ein weites Feld. Dort wachsen Klarsicht, Güte, Ordnung. Doch dieselbe Freiheit öffnet auch Räume für Sorge, für Trug, für Machenschaften, geboren aus dem Zustand der Gesellschaft, aus den Bewegungen der Kulturen, aus den inneren Wegen einzelner Menschen.
Jeder Gedanke gleicht einem Vogel. Er hebt sich mit Leichtigkeit, getragen von Vertrauen, vom Streben nach Licht, vom Gespür für Maß. Er kann aber auch sinken, durchzogen vom Gewicht fremder Kräfte, gebunden an weltliche Strömung, gelenkt von einem Willen, der seinen Ursprung vergaß.
Die Hallen des Geistes sind voller Bewegung. Kein Gedanke verharrt, kein Bild bleibt stumm. Es ist ein lebendiges Spiel aus Aufsteigen und Abgleiten, aus Schweben und Sinken, aus innerer Musik und äußerer Spannung. Aus diesen Bewegungen formt sich das Feld, in dem der Mensch erkennt, wächst, spricht.
In diesem Werk steht Boethius. Er, der späte Römer, der fromme Denker, der Staatsmann, dem die Welt die Hand entzog, während der Geist zu seiner höchsten Form fand. Sein Trost der Philosophie entstand im Gefängnis, doch strahlt aus ihm eine Freiheit, die über Zeit, Macht und Unglück hinausreicht.
Er schrieb, ohne Bitterkeit, mit Würde. Er fragte, ohne zu richten, und fand Antwort, ohne den Weg zu verlassen. Boethius verband Ordnung mit Gefühl, Weisheit mit Geduld, Denken mit Hingabe. Seine Philosophie ist keine Flucht, sondern Heimkehr. Keine Entsagung, sondern Sammlung. Kein Rückzug, sondern Wiedergewinn des Eigentlichen.
Dieses Buch folgt seinem Weg. Es betritt, Kapitel für Kapitel, jenen inneren Raum, wo sich Gedanken begegnen, wo Kritik zur Klärung wird, wo das Selbst dem Ursprung lauscht. Der Leser bewegt sich durch diese Hallen, nicht in Hast, sondern in leisen Kreisen, gleich einem Flug, der von Weite getragen wird, und von Rückkehr kündet.
„Ein festgegründetes Herz kann nicht durch das Glück erschüttert werden. Denn wenn es sich an sich selbst erfreut, dann kann kein Verlust es betrüben.“
Boethius, De consolatione philosophiae
I. Im Schatten der aufgehobenen Zeit – Wer war Boethius?
Es gibt Gestalten in der Geschichte, die wie durch einen Schleier zu uns sprechen. Fern in ihrer Zeit, nah in ihrer Erfahrung. Ihre Worte sind wie Echos aus einer Welt, die uns fremd scheint und doch genau den Kern trifft, den wir heute nicht mehr zu benennen wagen. Einer von ihnen war Anicius Manlius Severinus Boethius römischer Denker, Grenzgänger der Zeiten, ein Mensch zwischen Licht und Dunkel.
Boethius lebte in einer Welt, die sich leise auflöste. Die Ordnung Roms war verwittert. Der Glanz antiken Wissens war von christlicher Dogmatik umwölkt. Es war eine Welt, in der der Himmel schweigend über einer bröckelnden Erde stand. Und mitten in diesem Übergang, wo nichts mehr ganz antik, aber auch noch nicht mittelalterlich war, stand Boethius: ein Mann der Bildung, durchdrungen von Logik und Musik, von Philosophie und Politik und doch heillos ausgeliefert an die Willkür einer neuen Macht.
Einst Kanzler am Hofe des Ostgotenkönigs Theoderich, stieg Boethius auf in jene Höhen, von denen der Fall umso tiefer droht. Intrige, Neid, Machtspiel und ein Vorwurf, ein Prozess ohne Recht, und dann: Gefangenschaft. Keine Verteidigung, keine Rettung, keine Stimme mehr, die ihm beistand. Nur noch die Einsamkeit und das Näherkommen des Todes. Doch wo andere verstummt wären, begann Boethius zu sprechen und zu schreiben.
Und das, was aus seiner Gefangenschaft hervorging, ist mehr als ein Buch. Der Trost der Philosophie ist ein stilles Monument. Kein Werk des Aufbegehrens, sondern des inneren Widerstands. Boethius spricht darin mit der Philosophie selbst. Es ist eine Frauengestalt, würdevoll, klärend, streng, die ihn daran erinnert, was Bestand hat, wenn alles Äussere zerfällt.
Boethius war kein Philosoph, der nur spekulierte. Er dachte mit dem Herzen. Er verband Logik mit Ethos, Metaphysik mit Musik, das Rationale mit dem Schicksalhaften. Seine Philosophie war kein blosses System, sondern ein Ort der inneren Sammlung. Und vielleicht deshalb vermochte er, was wenige vermögen: dem Tod mit Klarheit ins Auge zu sehen und zwar nicht als Held, sondern als Mensch.
So war Boethius: ein letzter Lichtträger der Antike, der mit würdevoller Ruhe die Fackel der Vernunft durch eine Zeit trug, in der selbst die Sterne zu flackern schienen. Und wenn wir heute von Kritik sprechen, von Philosophie und ihrer Macht, dann sprechen wir auch von ihm und von jenem letzten Moment, in dem Denken sich als Trost erwies, als alles andere versagte.
II. Zwischen den Zeiten – Boethius im Übergang
Ein Zeitalter ging zu Ende, ohne dass es selbst davon wusste. Die Ströme der Geschichte hatten ihre Richtung verändert, leise, beinahe unmerklich und doch unwiderruflich. Wo einst das Imperium den Rhythmus vorgab, kehrte sich nun alles ins Ungewisse. Alte Formen standen noch, wie Schatten ihrer selbst. Die Begriffe waren dieselben geblieben, doch ihr Klang war hohl geworden.
In dieser Zwischenzeit, wo das Licht der Antike sich ins Halbdunkel der kommenden Jahrhunderte zurückzog, stand Boethius. Er stand nicht als Letzter, sondern als einer, der in sich trug, was viele schon verloren hatten: die Harmonie von Geist und Welt, die Einheit von Denken und Sein.
Nicht laut war seine Stimme. Kein Ruf über Marktplätze, kein Streiter mit den Waffen des Zorns. Boethius war still, gesammelt, durchdrungen von der Idee, dass alles Irdische nur Echo sei. Ein Echo einer höheren Ordnung, die nicht vergeht. Inmitten der politischen Machtkämpfe, der Intrigen und Umbrüche, hielt er fest an jenem Ton, der leise bleibt und doch das Ganze durchdringt: die Philosophie.
Sie war ihm nicht Lehre, nicht System – sie war Begegnung. Eine Weise, die Welt zu fühlen und zu formen, aus ihrem Innersten heraus. Und so wie das Wasser seine Form im Becken sucht, und doch nie stillsteht, so bewegte sich auch Boethius’ Denken: nie starr, nie festgelegt, immer rhythmisch, atmend, suchend und tief verbunden mit einem Ursprung, der sich im Schweigen verbarg.
III. Die Philosophie – eine Begleiterin im Kerkerlicht
Als er fiel, fiel nicht sein Geist. Der Leib war gefesselt, aber die Gedanken blieben frei. In der Enge der Gefangenschaft, im kalten Gemäuer, das kein Licht und keine Gnade mehr kannte, trat sie zu ihm: die Philosophie. Keine abstrakte Idee, sondern eine Frauengestalt, aufrecht, licht, streng und zugleich tröstend.
Sie fragte nicht nach Schuld, sie zählte keine Taten auf. Sie erinnerte. Und Boethius, der fast vergessen hatte, wie sehr er aus ihr lebte, erkannte sie wieder wie ein Kind, das nach langer Zeit seine Mutter sieht. In ihrem Blick lag kein Mitleid, sondern Klarheit. Und im Klang ihrer Stimme lag der Ton, der ihm einst Ordnung gab, als die Welt sich noch nicht in Lüge und List verwandelt hatte.
Sie war nicht gekommen, um ihn zu retten. Sie war gekommen, um ihn zurückzuführen und zwar nicht in ein früheres Leben, sondern in die Tiefe dessen, was bleibt. Die Ordnung des Kosmos, das Kreisen der Sphären, das Spiel von Notwendigkeit und Freiheit. Und je mehr er sprach, je mehr sie ihm antwortete, desto deutlicher wurde: Hier, im Angesicht des Todes, geschah nicht das Ende, sondern die Rückkehr der Seele zu sich selbst.
IV. Der Mensch im Kreis der Sphären
Boethius dachte weder linear, auch nicht in blossem Fortschritt. Für ihn war das Leben eher ein Kreis, ein ewiges Zurückkehren zu sich selbst. Wie die Musik aus Ton und Gegen-Ton, wie das Wasser in Welle und Tal, so erkannte er auch im Schicksal den Rhythmus. Glück war nicht Besitz, sondern Bewegung. Weisheit nicht Anhäufung, sondern Reinigung.
Was er in seiner letzten Schrift formte, war nicht nur Philosophie, es war ein Lebenslied. Ein Gesang aus Logik und Klage, aus Vernunft und Vision. Der Mensch, so zeigte er, sei nicht nur das leidende Wesen. Er sei auch das erkennende. Und in der Erkenntnis wohnt Trost.
Dieser Trost ist nicht süss. Er ist nicht warm. Er ist klar. Und genau in dieser Klarheit, im Loslassen der Äusserlichkeiten, im Rückbesinnen auf das Wahre liegt die Würde, mit der Boethius seinem Ende entgegensah.
V. Der grosse Spiegel – Boethius erkennt sich selbst
„Wenn du dein wahres Selbst erkennst, wirst du auch erkennen, dass du nicht durch das Unglück verwundet bist, sondern durch deine eigene falsche Vorstellung davon.“
(Boethius, Der Trost der Philosophie)
Es war nicht die Welt, die ihn zerstörte. Es war das Bild, das er von ihr hatte und das zerbrach. In jenem dunklen Raum, in dem die Zeit nicht mehr floss, stand ein Spiegel. Es war keiner aus Glas, keiner von Menschenhand. Es war der Spiegel des Innersten, in den Boethius nun blicken musste. Nicht aus Neugier, sondern aus seiner Not. Nicht aus Eitelkeit, sondern aus der tiefsten Erschütterung heraus.
Was sah er? Nicht den Mann, der einst Macht hatte, der glänzte im öffentlichen Wort, der sich sicher wähnte im Spiel der Ränge. Er sah das Gesicht eines Menschen, der gefallen war. Aber gerade darin erkannte er zum ersten Mal: das Wahre. Nicht das, was die Welt ihm zugeschrieben hatte, sondern das, was in ihm blieb, wenn alles andere abfiel, – sein denkendes Wesen, sein fragender Blick, seine Fähigkeit, sich im eigenen Innersten zu spiegeln.