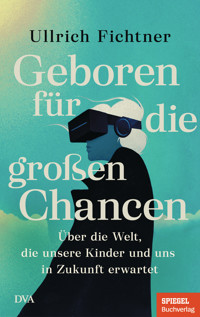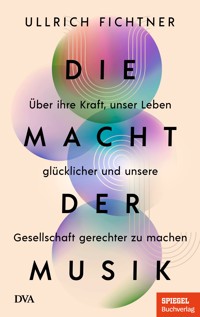
19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Deutsche Verlags-Anstalt
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Was das Leben zum Klingen bringt
Musik hat die Macht uns zu bewegen, unser Leben zu bereichern und uns im tiefsten Innern zu berühren. Sie ist die universelle Sprache, die uns mit Menschen auf der ganzen Welt verbindet. Doch Musik kann noch viel mehr.
Ullrich Fichtner, vielfach ausgezeichneter SPIEGEL-Journalist und Musikliebhaber mit Herz und Seele, hat sich aufgemacht, ihrem Wesen und ihrer transformativen Kraft auf den Grund zu gehen. Seine Gespräche mit Musikern, Wissenschaftlern und Medizinern zeigen: Musik macht uns nicht nur ausgeglichener und glücklicher, sondern steigert nachweislich unsere Intelligenz und Sozialkompetenz. Selbst ganze Gesellschaften können von ihrem Potenzial profitieren, macht ihr Einsatz öffentliche Räume doch entspannter, Gefängnisse konfliktärmer, Demenzpatienten gelassener und Frühgeborene gesünder.
Ein wahrer Lesegenuss, der zeigt, wie wir die Macht der Musik nicht nur genießen, sondern auch nutzen können – das ganze Leben lang.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 342
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Zum Buch:
Musik hat magische Wirkung auf den Menschen: Sie löst Gänsehaut, Herzklopfen oder Bauchkribbeln aus, kann fröhlich oder traurig stimmen, Stress lindern oder Schmerz stillen. Aber sie kann noch viel mehr: Neueste Studien aus Neurologie und Hirnforschung zeigen nicht nur, wie positiv sie sich auf Gesundheit, Psyche und soziale Fähigkeiten auswirkt. Sie trägt auch maßgeblich, bei jungen wie bei alten Menschen, zur Ausbildung und Stärkung vieler kognitiver Fähigkeiten bei.
Ullrich Fichtner, Musikliebhaber und vielfach preisgekrönter SPIEGEL-Reporter, stellt in seinem neuen Buch die enorme Welthaltigkeit von Musik dar: Anhand seiner eigenen vielfältigen Erfahrungen, die er mit Musik und Musikern aller Genres rund um die Welt gemacht hat, und neuester Erkenntnisse aus der Forschung lüftet er mit uns das Geheimnis, inwiefern Musik eine so immense Bedeutung für den Einzelnen und die Gemeinschaft hat, was die Wissenschaft darüber weiß, welches gewaltige gesellschaftliche Potenzial ihr innewohnt und wie wir alle mit mehr Musik gesünder, glücklicher, friedlicher, in einem Wort: besser leben können.
Zum Autor:
Ullrich Fichtner, Jahrgang 1965, ist Reporter des SPIEGEL mit Dienstsitz Paris, wurde für seine Arbeit vielfach ausgezeichnet und gehört zu den renommiertesten Journalisten Deutschlands. Bei der DVA veröffentlichte er das essayistische Buch Tellergericht (2004), eine kritische Bestandsaufnahme der deutschen Esskultur, sowie Billionenpoker (2012, gemeinsam mit Cordt Schnibben) über das internationale Finanzwesen. Zuletzt erschien Geboren für die großen Chancen, das für den Deutschen Sachbuchpreis 2024 nominiert war.
Besuchen Sie uns auf www.dva.de
Ullrich Fichtner
Die Macht der Musik
Über ihre Kraft, unser Leben glücklicher und unsere Gesellschaft gerechter zu machen
Deutsche Verlags-Anstalt
Die Zeit, in der wir Musik nicht nur als Einzelne, sondern als Gesellschaft bitter nötig haben, ist: jetzt.
Joana Mallwitz
Wer Musik liebt und innig versteht, für den hat die Welt eine Provinz, ja eine Dimension mehr.
Hermann Hesse
Musik ist eine Heilerin.
Andrew Lloyd Webber
Musik ist der Jackpot sensorischer, kognitiver, motorischer und belohnender Reize durch Klang.
Nina Kraus
Musik ist die einzige Sphäre, in der sich der Mensch seiner Gegenwart bewusst wird.
Igor Strawinsky
Musik ist keine Sprache, sondern ein Spiel.
Henkjan Honing
We don’t make music – it makes us.
David Byrne
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Copyright © 2025 by Deutsche Verlags-Anstalt, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München, und SPIEGEL-Verlag Rudolf Augstein GmbH & Co. KG, Ericusspitze 1, 20457 Hamburg
(Vorstehende Angaben sind zugleich Pflichtinformationen nach GPSR.)
Umschlaggestaltung: Favoritbuero, München
Umschlagabbildung: © Marish/Shutterstock
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
ISBN 978-3-641-33382-9V001
www.dva.de
Inhalt
Vorwort
1 Musik ist ein – biologisches – Wunder
Ohren auf im akustischen Chaos
Wie 86 Milliarden Gehirnzellen das Weltgeräusch präzise wegsortieren und uns von Kopf bis Fuß bewegen
Kein Mensch ist unmusikalisch
Wir sind alle geborene Musikologen – und obendrein ausgestattet mit der Fähigkeit zum lebenslangen Lernen
2 Musik ist das Fest des Lebens
Ein Klaviergipfel höher als der Wetterstein
In Schloss Elmau regiert neue Exzellenz auf den Trümmern alten Elitedünkels
Auch der König der Löwen ist Weltkulturerbe
Der Mainstream: wirksamstes akustisches Heilmittel zur persönlichen Stimmungsregulierung
Dancing Queen in der globalen Dorfdisko
Der Streaming-Markt mit seinen Klickmilliardären besteht aus ein bisschen mehr als Taylor Swift
Der weise Fritz und seine schwarzen Hits
Wie sogar die Europäer lernten, dass die richtig gute Musik aus Afrika und Amerika kommt
Im Lake House tanzen die Verhältnisse
An den Ufern der musikalisierten Zukunft: Montreux
3 Musik braucht Menschen, die sie machen
Von kinderleicht bis ganz schön schwer
Wie man im Alleingang Millionen Menschen zum Gitarrespielen bringt
Lob des Lernens
Ein altes Orchester macht in Bremen vor, wofür der Bildungspolitik noch immer die Fantasie fehlt
Das Fremde ist das Eigene
Die Weltmusikmesse Womex – ein Leuchtturm der Offenohrigkeit
Vom Segen des Singens
Die Stimme ist eine unerschöpfliche Quelle von Glück, die die Deutschen um ein Haar für immer verschüttet hätten
4 Musik vernetzt Zeiten und Menschen
Lob des Schwierigen
Es ist nicht alles gut, was in Donaueschingen scheppert, aber es wird in dieser Welt dringend gebraucht
Zurück in die Zukunft
Gustav Mahlers berauschende Zeitlosigkeit in Amsterdam
Im Flechtwerk ewiger Lieder
Das uralte Gespinst der Musik ist neuronaler als jede KI und hat bislang noch jeden technologischen Sprung überstanden
Schlussplädoyer
Kleines Geld für große Wirkung
Epilog
Literaturverzeichnis
Personen- und Sachregister
Vorwort
Weiches Rüstzeug für harte Zeiten
Der Entschluss, ein Buch über die Macht der Musik wirklich zu schreiben, fiel an einem wintergrauen Freitagmorgen in Bamberg. Dort, am linken Arm der Regnitz, im schönen Joseph-Keilberth-Saal, waren um kurz nach 9 Uhr die Symphoniker zum Dienst angetreten. Erste und zweite Geigen, Bratschen, Fagotte, Hörner nickten sich kurze Grüße zu und richteten sich auf der Bühne ein. Sie produzierten bald das übliche Chaos musikalischer Fetzen wie vor jedem klassischen Konzert, eine Kakofonie durcheinander spielender Instrumente, Melodien ohne Anfang und Ende, Trompetenstöße, Streichertöne, gluckernde Klarinetten.
Vorne saß mittig Jan Lisiecki am Steinway-Flügel, ein Kanadier im Jeanshemd mit der Statur eines Zehnkämpfers, Anfang dreißig erst, aber schon ein erstrangiger Pianist unserer Zeit. Mit Mitte zwanzig hat er innerhalb von ein paar Tagen alle fünf Beethoven-Konzerte live in Berlin eingespielt, und mustergültig. Hier in Bamberg saß er vor einem leeren Haus.
Abseits der Bühne gingen drei, vier Leute auf leisen Sohlen herum, die mit dem Geschehen das Ihre zu tun hatten, ich saß in der Weite des Konzerthauses verloren auf der Galerie, vorne rechts über dem Orchester. Die Szene ließ an eine Probe denken, aber tatsächlich begann eine Aufnahmesitzung der Deutsche-Grammophon-Gesellschaft. Ein Mozart-Album mit Lisiecki war in Arbeit, zwei Klavierkonzerte sollten festgehalten werden für die Ewigkeit.
Auf der Bühne und im Saal waren vierzig Mikrofone aller Art eingerichtet, verbunden über einige Kilometer Glasfaserkabel, die in einem Abstellraum des Gebäudes zusammenliefen. Dort schimmerten die Laptops der Tonmeister und Technikerinnen neben Tüten mit Nüssen und Rosinen. Dort lagen Mozarts Partituren aufgeschlagen und sahen aus, mit Anmerkungen übersät, wie durchkorrigierte Schulhefte.
Im Saal kehrte Stille ein. Die Oboe spielte einsam ihr immer irgendwie klagendes, reines A. Das Orchester folgte, das Ensemble stimmte sich ein, Kleidung wurde ein letztes Mal zurechtgezupft, die Sitzposition geprüft, ein Notenblatt gerade gerückt. Manfred Honeck erschien, gefeierter Chefdirigent in Pittsburgh, ein gebürtiger Vorarlberger im schwarzen T-Shirt. Auch er nickte reihum, legte Papiere ab und baute sich hinter dem Pult auf. Er machte eine Ansage, die ich nicht verstand, nahm dann Haltung an mit erhobenem Taktstock, und mit seiner ersten Geste, es mag 9.35 Uhr gewesen sein …
… platzte die Musik hinein in diesen Wintertag, das Wunder der Töne sprang heraus aus dem Nichts, ein fulminantes Allegro, das die Welt bis unter die Decke mit festlicher Heiterkeit füllte, mit fröhlichen Schüssen wie aus Konfettikanonen. Verscheucht war mit den ersten Takten jeder Gedanke an die trübe Stadt draußen, die eisgraue Regnitz, vergessen und vergeben waren Kälte und Nässe, vertrieben die Sorgen des Alltags, die hässliche Hektik des Berufsverkehrs, die ganze sonstige Welt. Aus einem dunklen Freitagmorgen im Winter war unverhofft ein Fest geworden.
Ein anderer, hellerer Raum ging auf, hervorgebracht von einer Musik, die vor 240 Jahren komponiert worden ist und doch immer noch direkt zu uns heutigen Menschen spricht. Musik sei die einzige Sphäre, in der sich der Mensch seiner Gegenwart bewusst wird, schrieb Igor Strawinsky, der Schöpfer der einst skandalösen BallettmusikLe Sacre du Printemps. Ansonsten verdammt dazu, zwischen Vergangenheit und Zukunft sorgenvoll herumzuschweifen, seien wir in der Musik, und nur in ihr, von dieser Last befreit, beruhigt und aufgehoben in einem musikalischen Jetzt.
Musik, um es weniger philosophisch zu sagen, macht glücklich, sie tut dem Menschen gut, überall, immer wieder. So groß ist ihre Macht, dass sie uns manchmal himmlisch vorkommt. Aber sie ist von dieser Welt, vom Menschen hervorgebracht und ihm zugleich tief eingeschrieben, ein Wunder aus dem Reich der Evolution und dem Herrschaftsgebiet der Künste, ein Totalphänomen mit so vielen Aspekten, dass sich die Forschung vor lauter Fragen mit den Antworten schwertut.
Über Musik zu reden, ist keine leichte Übung. Wenn sie eine Sprache ist, wie häufig gesagt wird, dann eine, die ganz anderen Regeln gehorcht als die gesprochene. Sie vergeht im Augenblick ihres Entstehens. Aufblühen und Verwelken sind eins. Aber solange sie spielt, werden wir Menschen buchstäblich ver-rückt. Wir betreten andere, unbegreifliche Sphären. Andere Zeiträume. Innere Zustände. Wir fühlen uns von Tönen erfasst, von Melodien betroffen, von Singstimmen bewegt, von Klangfarben gemeint.
In Dissonanzen und melodischen Unwägbarkeiten hören und verstehen wir eigene Zweifel und Hoffnungen. In harmonischen Höhepunkten und dynamischen Aufwallungen bilden sich Sehnsüchte ab, in Pausen und stillen Momenten lauern unsere Fragen. »Die unaussprechliche Tiefe der Musik, so leicht zu verstehen und doch so unerklärlich«, schrieb Arthur Schopenhauer, »ist dem Umstand zu verdanken, dass sie alle Gefühle unseres innersten Wesens nachbildet, jedoch vollkommen ohne Wirklichkeit und fern allen Schmerzes.«
Verstand und Gefühle, Hirn und Hormone, selbst Lunge und Herz führen zur Musik ihre eigenen Tänze auf. Jede Begegnung mit ihr beweist uns, dass Körper und Geist nicht voneinander zu trennen sind und dass sich Leib und Seele nicht einfach so in separaten Käfigen halten lassen.
Wenn die Musik im zweiten Satz von Mozarts 22. Klavierkonzert ihre ständigen Tongeschlechtsumwandlungen von Moll nach Dur spielend vollzieht, wenn sie hier und da stufenlos von einer in die andere Tonart gleitet, dann geht Unbeschreibliches vor, mit Worten Unsagbares. Es tut sich eine Stimmung des melancholischen Zwielichts auf, die nur Musik so ausdrücken kann in ihrer erstaunlichen, widersprüchlichen Ganzheitlichkeit und Gleichzeitigkeit.
Johann Sebastian Bachs Werk, sagt der Dirigent Raphaël Pichon, gebe Hoffnung selbst in seinen allertraurigsten Passagen. Und noch im Jubel erinnert es daran, dass die Tage des Lebens gezählt sind. Der Schriftsteller Richard Powers nennt es eine Schule des Trauerns über die Vergänglichkeit. Vielleicht fängt Musik einfach genau da zu reden an, wo dem Menschen die Worte ausgehen. Und alles das, diese Qualität, ein Spiegel der Welt zu sein, abbilden zu können, was unsagbar ist, den ganzen Menschen zu meinen mit seinen vielen verkreuzten Gefühlen, das gilt für alle Musik aller Zeiten, überall.
Es gilt für indische Ragas wie für den Tango, den Fado und das Chanson. Die Macht der Musik entfaltet sich in nordischen und alpenländischen Jodlern, im Spiel von Dudelsackpfeifern, in den Liedern von Kinder-, Pop- und Kirchenchören. Sie treibt DJs, Drummer und Mezzosoprane, Klavierlehrerinnen, Musiktherapeuten. Sie kommt in Gestalt der Nachtigallen aus Bollywood, der Fürstinnen des Mambo, der Meisterinnen und Meister der Afrobeats. Den ganzen Menschen zu meinen, das stimmt für den Jazz, für arabische Makamlar, für die sizilianische Blasmusik und für Solène Pichon aus Dijon, eine Krankenschwester, die dafür Sorge trägt, dass die Frühchen auf ihrer Station mit murmelndem Gesang am Leben gehalten werden.
Spiegel des Menschlichen in der Musik zu sein, dafür steht Tina Turner genauso wie Van Halen, Metallica wie Pete Townshend, Taylor Swift, Elvis Costello, Ludwig Göransson und Michel Legrand, es zeichnet große und kleine Rock- und Pop- und Hiphop-Stars aus. Die Ehre gebührt den J- und den K-Poppern, Fred Again, den Oud-Spielern, Organisten und Balafonisten, Abba natürlich, Pink Floyd, Amy Winehouse, dem Blues, dem Funk, den Sex Pistols. Prince lebe hoch und mit ihm Judy Garland, Renata Scotto, John Coltrane, Brian Eno, Robert »Bob« Moog und Peter Bursch aus Duisburg, der quasi im Alleingang Hunderttausenden Menschen beigebracht hat, wie man Gitarre spielt, wenn es nicht sogar Millionen sind.
Unsagbares wurde in Musik umgeformt von Nat King Cole und Jessye Norman, von Fritz Wunderlich und Gloria Gaynor, von Elton John und Oum Kalthoum. Zu ehren sind Kendrick Lamar, Wilhelm Furtwängler, Barbra Streisand, Ravi Shankar, Martha Reeves und Saskia Urbach, die Tambourmajorin des Spielmannszugs der Rotjacken aus Eschwege.
Ein Hoch: auf Daniel Barenboim, Ella und Aretha. Auf Little Richard, Lady Gaga, Monteverdi und Fauré. Auf Youssou N’Dour, Miriam Makeba, Jacques Brel, Edita Gruberová. Auf Gustav Mahler. Billie Eilish. Beethoven. Barbara. Die Beatles. Bach. Wäre es nicht so vermessen, würde ich ihnen allen, in Demut, dieses Buch widmen.
Dank gebührt ihnen, weil sie mit ihren Stimmen und Stimmungen, ihren Klängen und Rhythmen, ihren Beats und Passionen, ihren Songs und Symphonien, ihrem Drive, ihrem Puls unsere Gehirne auf Trab und unsere Herzen im Takt halten und uns buchstäblich elektrisieren. Dank dafür, dass sie unsere Seelen nähren, Schmerzen lindern, beim Trauern helfen und beim Feiern, dass sie Mut geben, Zuversicht und Kraft. Dank, weil sie Erinnerungen schenken und fixieren für immer, weil sie unseren Alltag mit Wärme füllen und mit Wundern.
Aber nun ist es so: Angesichts ihrer unzähligen Qualitäten, ihres ästhetischen Reichtums und Reizes, angesichts ihrer zahllosen Effekte auf unser Wohlbefinden, die Gesundheit, die Gemeinschaft müsste Musik eigentlich im Mittelpunkt unseres Lebens stehen – aber das ist nicht der Fall. Wir gehen mit ihr nachlässig, ja, sogar achtlos um.
Es ist eine der großen Paradoxien des Alltags: dass Musik von Menschen weltweit gehört, geliebt, gebraucht, gespielt, gesungen und gepfiffen wird. Dass sie gerade junge Menschen buchstäblich auf Schritt und Tritt begleitet. Dass Musikerinnen und Musiker aller Niveaus, Profis, Amateure, Anfänger, alle begeisterten Hörerinnen und Liebhaber wissen, wie gut sie tut und wie wichtig sie für ein erfülltes Leben ist – dass sie aber trotz alledem nicht ernst genommen wird.
Große gesellschaftliche Mehrheiten behandeln sie wie eine hübsche Nebensache. Musik gilt den meisten Leuten als Beilage, die zum Sattwerden nicht gebraucht wird. Von Regierungen wird sie regelmäßig als Last diskutiert, als Haushaltsposten und Kostenfaktor, und das ausgerechnet in einem so traditionsreichen Musikland wie Deutschland. Die unerschöpflichen Potenziale der Musik, der unfassbare Mehrwert, den sie immerfort schafft, werden auf eine verblüffende Weise unterschätzt.
Musik wird auch gebremst durch fruchtlose Debatten darüber, was genau an ihr wertvoll oder wertlos sei, was in den Hängeordner E wie ernst und erhaben oder U wie unwichtig, weil »nur« unterhaltend gehört. Jahrzehntelang wurde Musik aufgehalten von einer steril wirkenden akademischen Debatte darüber, ob die Musikalität dem Menschen evolutionär eingeschrieben sei oder nicht. Die Möglichkeiten, die in der Musik für den Menschen liegen, werden im Zuge solcher Streitereien kleingeredet oder schlicht übersehen.
Das ändert sich seit Kurzem, allein deshalb braucht es ein neues Buch über die Macht der Musik. Seit einigen Jahren verdichten sich Forschungsergebnisse zu der Erkenntnis, dass der Mensch ein musikalisches Wesen ist. Dass Musik existenziell für unser Leben und Überleben ist, dass gerade Kinder ohne sie verkümmern und mit ihr regelrecht aufblühen. Ist dies als Wissen einmal etabliert, steht uns eine Musikalisierung der Verhältnisse ins Haus, ein bedeutender kultureller Umbruch.
Welche Regierung wollte dann noch die Mittel für schulischen Musikunterricht kürzen, statt sie massiv aufzustocken? Wäre ein Totalumbau der Schul- und Bildungssysteme in Richtung einer Musikalisierung etwa nicht zwingend? Wie könnte, wenn Musik als eines unserer Wesenselemente dingfest gemacht ist, die Gesundheitsversorgung bleiben, wie sie ist?
Die segensreichen Effekte des Musikhörens, -machens, -spielens und -singens auf unser Leben, die messbaren Vorteile und Gewinne der Musik sind ein von Politik, Forschung, Behörden, Gesellschaft und Medien sträflich schlecht bestelltes Feld. Dass Musik weiches Rüstzeug für harte Zeiten ist, eine Art Schweizer Offiziersmesser im Werkzeugkasten der Resilienz, hat sich unter Entscheidungsträgern noch nicht herumgesprochen. Sie sind häufig sogar die Ersten, die die Bedeutung von Kultur und Künsten für das Gemeinwohl kleinreden.
Statt ihren musischen Bildungsauftrag als erstrangige Aufgabe zu verstehen, stehlen sich Staaten aus ihm davon. Dies ist der bedauerliche Ist-Zustand: Von einer Musikalisierung der Verhältnisse kann in diesen Zeiten immer noch keine Rede sein. Es nimmt beizeiten sogar die zerstörerische Arbeit an einer Ent-Musikalisierung Fahrt auf.
Eltern, wenn sie zu entscheiden haben, ob ihre Kinder eine Fremdsprache, das Programmieren oder ein Instrument lernen sollen, wählen viel zu selten das Instrument. Dass das zu kurz gedacht sein könnte, fällt vor allem deshalb nicht weiter auf, weil ja auch die Lehrpläne an staatlichen Schulen seit vielen Jahren so gestrickt sind, dass sie die vermeintlich harten Fächer bevorzugen und die vermeintlich weichen vernachlässigen. Weltweit ist das so.
Die sogenannten MINT-Fächer, das sind Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik, genießen allerorten höchste Priorität, so als ließen sich alle Probleme von heute und morgen mit Maschinen und Computern aus der Welt schaffen oder wie eine mathematische Gleichung lösen. Dabei wird es doch auch und gerade für den Umgang mit Künstlicher Intelligenz menschliche Qualitäten brauchen, wie sie sich vorzüglich in der Begegnung mit Musik und anderen Künsten entwickeln. Besser programmieren zu können, schützt vor existenzieller Ratlosigkeit nicht.
Es gilt, die vorherrschende, einfältige, selbstverständlich wirkende Logik zu schleifen und auf den Kopf zu stellen: Es spart nichts ein, wenn an Musik und Kultur gespart wird, im Gegenteil. Wer Kosten langfristig und nachhaltig senken will, muss kühne Programme für den kulturellen Infrastrukturauf- und -ausbau auflegen. Kultur ist kein Zeitvertreib wohlhabender Gesellschaften, sondern gehört zu den Grundlagen dafür, dass Wohlstand überhaupt entstehen kann. Kulturausgaben sind, wie der deutsche Bundespräsident Richard von Weizsäcker einst sagte, keine Subventionen, sondern Zukunftsinvestitionen.
Solche Einsichten ziehen mittlerweile selbst bei Unternehmens- und Industrieverbänden ein. Das Weltwirtschaftsforum von Davos propagiert ähnliche Thesen seit Jahren. Die OECD hat vor wenigen Jahren in einer groß angelegten Studie über die »Bildung im Digitalzeitalter« darauf hingewiesen, dass es dringend Methoden brauche, um soziale Fähigkeiten wie Kommunikation, Kooperation, Aufmerksamkeit und Kreativität zu fördern, die für die Entwicklung einer gesunden Gesellschaft »entscheidend« seien. Und weiter: »Immer mehr Belege deuten darauf hin, dass das Ausüben und Erlernen von Musik eine solche Methode sein könnte.«
Der Dirigent und Pianist Daniel Barenboim vertritt seit Jahrzehnten die dezidierte Meinung, dass Musik »die wesentliche und unersetzliche Komponente allgemeiner Erziehung« ist. Sie, und nur sie, fördert laut Barenboim »das richtige Gleichgewicht zwischen Intellekt und Emotion«. Und: Musik »ist nicht nur schön, bewegend, bezaubernd, tröstend oder begeisternd … Musik ist ein wesentlicher Teil der Körperlichkeit des menschlichen Geistes.«
Musik ist eine potenzielle Supermacht der Prävention, deren Dienste kaum in Anspruch genommen werden. Schon in friedlichen, entspannteren Phasen als den heutigen wäre ein Land ohne eine flächendeckende Versorgung mit Orchestern, Opern und Ballett, ohne Rockbands, Liedgut und zeitgenössische Musik, ohne Jazz und Festivals und Qualitätsradios, ohne Rave-Partys und Chöre und ohne den gesellschaftlichen Seismografen namens Pop ziemlich arm dran. Wenn sich die Zeiten aber verhärten, das hat die Corona-Pandemie beispielhaft gelehrt, werden die Künste wirksam als Teil des Rettenden.
Die Balkon-Gesänge der besonders gebeutelten Italiener sind unvergessen. Die globalen Internet-Chöre und virtuellen Konzerte haben Millionen Menschen vor Verzweiflung bewahrt. Ich bin auch überzeugt davon, dass sich die Verhältnisse in den USA zuletzt weniger bedenklich entwickelt hätten, wenn dort alle Menschen, auch die in tiefer Provinz, seit jeher kulturell besser grundversorgt wären. Der Puls des Musiklebens ist durchaus ein aussagekräftiger Messwert über den Zustand einer Gesellschaft.
Ich möchte in diesem Buch zeigen, welch große Bedeutung Musik in unserem Leben hat. Dass sich die musikalische Zeitenwende, auch wenn wir für sie noch keine Begriffe haben, an vielen Orten und in vielen Situationen bereits vollzieht. Ich habe mich ein Jahr lang gezielt und zuvor jahrzehntelang ziellos dort herumgetrieben, wo Musik spielt. Ich habe Fachmessen der Weltmusik und des Chorsingens besucht, Kongresse von Neurowissenschaftlern, ich konnte Interviews mit herausragenden Künstlerinnen und Forschern führen. Ich habe in Probenkellern von Spielmannszügen gelungert, in Gemeindesälen Chorstunden verfolgt, in Bali und Bremen Gamelan-Orchester gehört, in Schlössern und Stadien Weltstars erlebt.
Die Stapel an Fachliteratur, die zeitweise um meinen Schreibtisch standen, waren hoch. Ich habe viel gelernt, das ich mit anderen interessierten Laien hier teilen möchte. Die Fachwelt aller zugehörigen Disziplinen, es sind viele, möge mir Fehler vergeben.
Das Buch hat vier Abschnitte: Der erste befasst sich mit dem Hören an und für sich und der Wissenschaft von der Verarbeitung akustischer Signale, einem wahren Wunder der Natur. Wer zu verstehen beginnt, was Hören eigentlich ist und was alles geschehen muss, damit aus ein bisschen zitternder Luft am Ende Bach oder Billie Eilish werden, erschließt sich Schichten des Verstehens, die der musikalischen Genussfähigkeit dienen. Es gilt, was Robert Zatorre, ein großer Gelehrter in diesen Fragen, geschrieben hat: dass uns die Wissenschaften nicht nur Erkenntnisse liefern, sondern auch tiefe Dankbarkeit schenken, ja, Ehrfurcht vor den Studienobjekten.
Der zweite Abschnitt widmet sich unserer musikalischen Lebensgestaltung, dem Fest, das wir uns ständig selbst bereiten. Es geht um die Musik, die wir uns Tag und Nacht herbeistreamen, die Welt der Charts und Konzerte. Es geht zu Festivals, bei denen sie uns in aller Schönheit live begegnet. Es geht um Hochämter der klassischen Musik und um populäre Adventskonzerte, um das Mäandern des Mainstreams im Radio und alte Ruhmesstätten wie Montreux.
Unterschiede zwischen oben und unten, wichtig oder wertlos, U oder E mache ich keine. Die Bewertung von Musikgeschmäckern interessiert mich wenig bis gar nicht. Schon allein, weil es so viel Wichtigeres gibt.
Ich denke zum Beispiel, dass die Zeiten wieder enden sollten, in denen das Volk der Musik, zumal in Europa, aufgespalten war in ein paar Spezialisten und in die Masse aller anderen, die nur zu ihrem Konsum zugelassen waren. Wer Musik so versteht, dass nur einige wenige »Talentierte« das Recht hätten, sie für die vielen angeblich »Unbegabten« aufzuführen, und dass sich nur einschlägig Studierte und sonst wie Bewanderte über sie äußern dürften, missversteht sie.
Musik trennt nicht, sondern verbindet, sie schafft keine Hierarchien, sondern ist Einladung an alle. United by music lautet nicht zufällig der Slogan der weltgrößten jährlichen Musik-TV-Show mit Namen Eurovision Song Contest, der auf seine Weise genauso zur Musik- und Weltkulturgeschichte gehört wie die Bayreuther Festspiele.
Musik will immer wieder neu gemacht werden, von Menschen gespielt werden, dafür braucht es begeisterte Lehrerinnen und Lehrer, die sich für ihren Fortbestand engagieren, die organisieren, die sich als Pioniere verstehen und auch gegen Widerstände Kurs halten. Ihnen ist der dritte Abschnitt dieses Buches gewidmet. Er beschreibt Musikerinnen und Musiker, die sich um das kulturelle Wohl nicht nur von Kindern bemühen, den legendären Gitarrenlehrer Peter Bursch, die Musikwerkstatt der Bremer Philharmoniker, den wunderbaren Marktplatz der Weltmusik namens Womex.
Es geht um Offenohrigkeit, den Begriff gibt es wirklich. Ein britischer Psychologe hat ihn schon vor Jahrzehnten geprägt, und er meint viel, aber sicher auch, dass es allen offensteht, sich ab morgen mit der Peking-Oper zu beschäftigen, mit der Geschichte der tschechischen Musik oder mit dem erstaunlichen Werk des japanischen DJs Yousuke Yukimatsu. Niemand muss das tun, aber jede und jeder könnte jederzeit, denn wir leben in einer Musikwelt der unbegrenzten Möglichkeiten, je offenohriger, desto mehr.
Mir hat schon vor Spotify und Co. nie eingeleuchtet, warum es Leuten unmöglich erscheint, sich an einem Abend um das Streichquintett von Schubert zu bemühen und an anderen Tagen Al Bano & Romina Power beim Kochen zu hören. Das gilt in beide Richtungen: Ich verstehe auch Leute nicht, die immer nur Al Bano und Romina hören, aber meinen, Schubert habe ihnen nichts zu sagen. Wie kommen sie nur darauf?
Vielfalt und Gleichzeitigkeit gehören zu den Wesenszügen von Musik und ihrer Geschichte. Die Veränderungen und Verästelungen in der Zeit und im geografischen Raum sind atemberaubend. Wie sich musikalisches Material durch die Jahrhunderte zieht und letztlich die Menschheit verbindet, fast wie ein feines Wurzelwerk, damit beschäftigt sich der vierte und letzte Abschnitt des Buches, der geschöpft ist aus Erlebnissen bei den Donaueschinger Musiktagen und vor allem während des historischen Mahler-Festivals von Amsterdam im Mai 2025, dem erst dritten seiner Art in gut einem Jahrhundert.
Die Macht der Musik. Am Ende übersteigt sie alles, was der von Natur aus so hochbegabte Mensch auf den vielen Feldern des Lebens hervorbringt, so empfinde ich es. Musik ist, wie es der Dichter Hugo von Hofmannsthal als Librettist für Richard Strauss seiner Zeit gemäß formuliert hat, eine »heilige Kunst«, die »alle Arten von Mut … um einen strahlenden Thron« versammelt.
Mir hat sie sich, um das als Letztes noch vorauszuschicken, relativ früh im Leben zweimal vorgestellt, mit ihrer ganzen weltverändernden Wucht. Beim ersten Mal, an das ich mich bewusst erinnere, kam sie aus einem Kinderplattenspieler aus weißem Plastik in Form von MozartsSerenade Nr. 13 in G-Dur, besser bekannt als Eine kleine Nachtmusik, und das Kind, das ich war, erlebte die Schönheit wie einen Schock.
Den zweiten Urknall, selbst wenn es rein logisch gesehen nur einen geben kann, aber derlei Gesetze gelten nichts im Reich der Musik, setzten Deep Purple. Das heißt, eigentlich war es der verwegene ältere Bruder eines Schulfreunds, der in der Garage einer Doppelhaushälfte in meiner fränkischen Heimat wohnte. Dort legte er eines Mittags nach der Schule, zu unserem atemlosen Entsetzen und Entzücken, Smoke on the Water auf, bei voller Lautstärke und geschlossenem Garagentor. Die Platte war nicht mehr ganz neu damals. Aber mein Leben wurde es.
Für solche Vorgänge und Erfahrungen gibt es keine Worte. Es braucht ja eigentlich auch keine. Aber es gelingen immer wieder sprachliche Annäherungen, die dann in einem nachhallen.
David Byrne, der charismatische Sänger der Band Talking Heads, hat in seinem Buch How Music Works einen Satz formuliert, den ich beim Lesen unwillkürlich auf mich und Mozart und Smoke On The Water bezog. Byrne schreibt da, so leichthin wie schwerwiegend: »Nicht wir machen Musik – sie macht uns.«
We don’t make music – it makes us. Der Gedanke beschäftigt mich, seit er mir begegnet ist. Er fällt mir immer wieder einmal ein. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich ihn wirklich verstehe. Ich fühle eigentlich nur, dass er stimmt. Weil alles an ihm richtig klingt.
1 Musik ist ein – biologisches – Wunder
Ohren auf im akustischen Chaos
Wie 86 Milliarden Gehirnzellen das Weltgeräusch präzise wegsortieren und uns von Kopf bis Fuß bewegen
Im alten Salzspeicher von Avignon, heute ein Kulturzentrum, steht eine Art durchsichtiges Iglu auf der Bühne, groß genug, um ein paar Stühle aufzunehmen und allerlei Gerät. In der Halbkugel hängt eine japanische Papierlampe, gerippte Schläuche laufen durch die Installation, Spiralen, Drähte. Die Szene lässt an zeitgenössische bildende Kunst denken, aber das Publikum, vielleicht 200 Leute, wartet auf eine musikalische Darbietung, die gleich beginnen wird.
Aus dem Hintergrund tritt das Rolling String Quartet hervor, ein der Besetzung nach klassisches Streichquartett, dazu eine Sängerin. Das Iglu wird sich bald als eine raffinierte Lichtmaschine entpuppen, die ganz oder in Teilen blinken und blitzen kann, inwendig glühen oder nach außen leuchten. Der Abend heißt: L’odyssée musicale du cerveau, Die musikalische Odyssee des Gehirns.
Es geht um die Prozesse, wie wir Menschen Musik verarbeiten, wie wir »hören« mit den Ohren und dem Hirn, wie uns durch Töne, Rhythmen, Melodien und Klangfarben allerlei Lichter aufgehen. Das Iglu stellt mit ein paar Glühbirnen und Lichterketten unsere 86 Milliarden Neuronen im Kopf nach. Das sieht besser aus, als es klingt, und das »poetisch-wissenschaftliche« Spektakel wird zu einer lustigen Revue.
Das Quartett spielt Variationen berühmter Melodien im Stil unterschiedlicher Jahrhunderte, Pop und Rock auch und zeitgenössische klassische Musik. Manchmal stehen die Musikerinnen und Musiker an der Rampe und trommeln und klatschen im Wechselspiel mit dem Publikum We will rock you auf Brust und Arme. Die Sängerin schlüpft in die Rolle von Hirnarealen und Organen und macht auch gute Figur als Vorderlappen und Thalamus. Dazu blinken die entsprechenden Areale des Iglus. Man geht schlauer aus dem Abend heraus, als man hineingegangen ist. Und es wird auch noch mitreißend Musik gemacht.
Der Mann am Cello heißt Emmanuel Bigand. Er war in einem früheren Leben professioneller Orchestermusiker, ehe er sich für eine wissenschaftliche Karriere als Kognitionspsychologe entschied. Auf diesem Forschungsfeld geht es um die unendlich vielen mentalen Prozesse, die unsere Wahrnehmung, das Denken, das Lernen, die Verarbeitung von Erinnerungen und Erwartungen betreffen. Bigand spezialisierte sich auf die Musik und ihre mannigfaltigen Aspekte.
Heute, nach Jahren der Forschung im französischen Exzellenzverbund CNRS, zählt er zu den großen Experten auf diesem Feld und hat mit der Neurologin und Hirnforscherin Barbara Tillmann wichtige Studien vorgelegt. Gemeinsam haben die beiden ein Buch mit dem sprechenden Titel La Symphonie Neuronale verfasst, Die neuronale Symphonie. In ihm geht es Seite um Seite darum, dass und wie die Musikalität dem Menschen angeboren und eingeschrieben ist, dass und wie Musik zu den existenziellen Notwendigkeiten des Lebens gehört und warum eine gesunde menschliche Entwicklung ohne sie schlicht nicht denkbar ist.
2020 erschienen, markiert das Buch ungefähr den Zeitpunkt, zu dem ältere Thesen, die noch sehr eindeutig besagten, dass Musik nur eine Nebensache in der menschlichen Entwicklung sei, unter dem Druck neuer Forschungsarbeiten nach und nach unhaltbar wirkten. Bis dahin gab es noch etliche Anhänger der Idee, dass Musik nur kulturelle Garnitur sei, ein unwesentliches »evolutionäres Nebenprodukt«, ein bloßes Genussmittel, ein Stück »akustischer Käsekuchen«. Diese Formulierung gebrauchte ein Hauptvertreter dieser Denkschule, der Kanadier Steven Pinker, und sie mischte den akademischen Betrieb um die Jahrtausendwende ziemlich auf. Pinker argumentierte, dass die Fähigkeit zur Musik keinen klaren Überlebensvorteil für den Menschen darstelle. Ihre Verarbeitung nutze Hirnstrukturen, die sich »eigentlich« für Sprache, Bewegung und Gefühle entwickelt hätten. Schüler Pinkers sprachen später davon, die Musik sei ein »Schmarotzer« der Evolution, nicht ihr Ziel.
Dass das Gegenteil richtig sein könnte und Musik sehr wohl als evolutionär entwickelt anzusehen sei, diese These gibt es schon seit Charles Darwin. Er stellte die These auf, dass Musik und Singen zum Balzritual gehören könnten, also die Chancen auf Fortpflanzung erhöhten – womit die Musik als evolutionärer Vorteil klar erkennbar würde.
Heute ist der akademische Streit über diese Fragen praktisch verebbt. Es erscheint hin und wieder ein Artikel, der neuerlich versucht, in Pinkers Kerbe zu hauen, aber die Provokationen wirken, angesichts vieler aufregender Entdeckungen über das »hörende Gehirn« und die Wirkungen der Musik recht leer.
Heutige Forschung geht davon aus, dass Musik und Musikalität die Ausbildung sozialer Strukturen, aber auch den Spracherwerb überhaupt erst ermöglichen. Die Wirkungen des Singens und Summens in der Mutter-Kind-Beziehung sind mittlerweile vielfach beschrieben und als bedeutsam erkannt. Gemeinsames Singen, Musizieren und Hören verbindet Menschen seit Urzeiten und ermöglicht die Bildung und den Zusammenhalt von Gruppen, ein eindeutiger evolutionärer Vorteil. Messbare körperliche Reaktionen liefern zahlreiche Belege für die tiefe Verankerung des Musikalischen im Menschlichen.
Die naheliegendste Gegenfrage zu Pinker und seiner Käsekuchen-These lautete immer: Warum sollte der Mensch mit der unfassbar komplexen Gabe zur Musik ausgestattet sein, wenn sie für ihn nicht existenziell wäre? Wofür der ganze Apparat und die verwickelten Prozesse, wenn es nur um eine nette Zugabe ginge?
Der Hörvorgang, die Grundlage aller Musikwahrnehmung, ist eine Gabe von solch atemberaubender Finesse, dass selbst Nina Kraus, eine weltweit führende Neurowissenschaftlerin auf diesem Gebiet, ins Schwärmen gerät: »Es geht hier um Schönheit. Es ist ein Wunder, dass dies wirklich geschieht.«
Das Wunder des Hörens.
Die meisten Menschen machen sich darüber keine großen Gedanken, denn es handelt sich schließlich um ein Stück selbstverständliche Grundausstattung des menschlichen Körpers. Und tun sie es doch, dann sind die gängigen Vorstellungen, die es davon gibt, häufig falsch.
Es gehen nicht Geräusche und Töne von A nach B in die Ohren hinein, um dort wahrgenommen zu werden. Wenn man die Vorgänge überhaupt mit Wegen und Verkehren vergleichen möchte, müsste man es wenigstens so tun wie Nina Kraus, die meint, das Hören sei »Teil eines gewaltigen Super-Highways in einem hektischen Stadtzentrum voller Auf- und Zufahrten, gespickt mit Kreisverkehren, Kreuzungen und wirren Knotenpunkten, an denen es nach allen Seiten zu anderen Stadtvierteln abgeht.«
Es müssen beim Hörvorgang tatsächlich Millionen Prozesse gleichzeitig, in rasender Geschwindigkeit und mit perfekter Präzision ablaufen, damit sinnvolle Hörbilder entstehen können, die uns die Orientierung im Leben ermöglichen.
Ein einfaches Gedankenspiel zeigt, was dabei ständig geleistet wird: Eine Freundin, sagen wir, feiert bei sich zuhause ihren Geburtstag. Es sind viele Leute da, Musik wird gespielt, Essen serviert, es werden Flaschen entkorkt und zischend geöffnet. Bekannte und unbekannte Stimmen mischen sich in unterschiedlich großen Grüppchen ringsum (und wir »hören« sogar, ob sie sich gut unterhalten oder schlecht). Musik ist im Raum, Melodien, Gesang. Hier und da kann man das Gluckern beim Einschenken vernehmen, das Klingen von Gläsern beim Anstoßen und das dumpfe Geräusch beim Aufsetzen von Flaschen auf Tische, das Klappern von Tellern, das Klirren von Geschirr, das Reiben von Füßen auf dem Boden, das Schleifen von Möbeln. Es klingelt vielleicht ein paarmal an der Wohnungstür, und es wird ab und an ein plötzliches gellendes Lachen mehrerer Leute laut, die wir gar nicht sehen, weil sie sich in der Küche nebenan amüsieren.
Wir hören ganz nah ein kleines Geräusch, das die Armreifen am Handgelenk einer Sitznachbarin beim Gestikulieren machen, und weiter weg das Scheppern von Bierkästen. Wir hören das leise Rascheln der Kleidung von Leuten, die hinter uns vorbeigehen, wir hören von draußen das stete Rauschen von Autos, an- und abschwellend, ein Hupen irgendwo (von dem wir wissen, dass es nicht uns gilt), und da ist auch die Sirene eines Krankenwagens zwei, drei Straßen weiter.
Mit anderen Worten: Es herrscht ein totales akustisches Chaos. Aber unsere Ohren, unser Gehirn beherrschen spielend die Lage, sie nehmen auf, sortieren, schaffen Ordnung, beurteilen Wichtigkeit, alles parallel im Takt von Tausendstelsekunden.
Direkt links neben uns vernehmen wir laut und deutlich einen Freund, der von einer lustigen Begegnung erzählt, obwohl wir uns eigentlich mit einer Frau rechts von uns unterhalten, deren leise Stimme wir unter allen akustischen Reizen so ausfiltern, dass wir nur ihr wirklich folgen und auf sie reagieren können, und das, obwohl sie zwischen zwei Leuten steht, die aufgeregt über ein Fußballspiel diskutieren.
Das Wunder des Hörens.
Allein dass wir dieser einen Frau rechts von uns überhaupt folgen können, ist bei genauer Betrachtung eine fantastisch anmutende Leistung. Sie wäre schon dann beachtlich, wenn es nur uns und sie im Raum gäbe und kein Geräusch sonst. Denn während sie spricht, verarbeiten wir in jeder einzelnen Sekunde 25 bis 30 Phoneme, winzige Sprach-Laut-Bestandteile, aus denen sich das gesprochene Wort zusammensetzt. »Stellen Sie sich vor«, schreibt Nina Kraus, »Sie müssten ein visuelles Objekt verarbeiten, das seine Gestalt 25- bis 30-mal in der Sekunde verändert: Da ist ein Ball! Jetzt ist es eine Giraffe! Jetzt ist es eine Wolke!« Das leisten wir beim Hören, wenn wir nur dieser einen Freundin zuhören. Und in der Partyszene nehmen wir zugleich alle anderen Stimmen und Geräusche ununterbrochen auf und analysieren sie in unserem »Hinterkopf« und bewerten sie in ihrer Bedeutung für uns und unser Leben.
Das ist die Hör-Situation. Unglaublich, dass wir sie meistern können. Ein Wunder, dass wir nicht in ihr untergehen.
Alles beginnt mit der Luft, die sich um uns bewegt, mit Luftpartikeln, die durch Schalldruck näher zusammengedrückt werden oder, wenn der Druck nachlässt, weiter auseinanderrücken. Es ist nicht vorstellbar, aber in dem bisschen Luft, das unseren Gehörgang füllt, stecken, quasi hinter-, über- und nebeneinander engstens geschichtet, alle Geräusche und Klänge, die um uns herum in Hörweite laut werden.
Klänge und Geräusche sind nichts anderes als eine ständige Folge kleinster Luftdruckveränderungen in unbeschreiblich feinen Abstufungen, alle verdichtet in dem einen Hauch Luft, für den in unseren Gehörgängen Platz ist. Die Luft vibriert dabei in unterschiedlichen Frequenzen, die wir als Tonhöhen wahrnehmen, gemessen in Hertz.
25 Hertz, das ist auf einem Klavier die Taste ganz links, der tiefste Ton, nur noch knapp innerhalb des für Menschen Hörbaren. 88 Tasten höher, ganz rechts, hat das letzte C, man sagt »fünfgestrichen« dazu, 4100 Hertz, aber da klingt schon nicht mehr viel, das klimpert nur noch fahl. Dazwischen liegt die Trillerpfeife: 2000 Hertz, der Kammerton A, den die Oboe so schön und klagend spielt: 440 Hertz.
Würden diese Töne physikalisch rein produziert, könnten wir sie keiner Quelle zuordnen. Sie erhalten ihre spezifischen Farben dadurch, dass sie von sogenannten Obertönen umspielt werden, eingehüllt werden. Diese erst sorgen dafür, dass eine Oboe so klingt, wie sie klingt. Dass wir eine menschliche Stimme ausmachen, ein Klavier, einen scheppernden Bierkasten. Jedes Ding, jeder Körper, alles, was Geräusch und Töne hervorbringt, hat eine eigene Klangfarbe (wer sich dafür im Detail interessiert – und es gibt endlos viele Details! –, wird in Manfred Spitzers Buch Musik im Kopf fündig).
Dazu kommt die Lautstärke, die man laut Nina Kraus in Pascal messen könnte, in der Einheit des Luftdrucks, aber diese Skala ist für das kleine menschliche Ohr zu unhandlich. Man rechnet deshalb alles algorithmisch um in Dezibel (dB), damit lässt sich die Palette der Veränderungen kompakt darstellen: 10 Dezibel, das ist die Lautstärke von ruhigem Atem, 30 dB: Flüstern, 60 dB: Reden, 90 dB: Autobahn, 120 dB: Kettensäge, 140 dB: startendes Flugzeug.
Die bewegte Luft, die Schallwellen aus Schallquellen werden zum sogenannten Schalldruck und im Ohr registriert, das heißt, der Schall durchläuft den Gehörgang und trifft am Ende auf das etwa 0,8 Quadratzentimeter große Trommelfell. Es »trommelt« die Reize in die sich anschließende Paukenhöhle weiter. Dort setzt sich die Kette der Gehörknöchelchen in entsprechende Bewegung und trägt den Schall an das ovale Fenster, eine Art zweites Trommelfell, aufgespannt vor dem Innenohr. Es verstärkt die ankommenden Wellen um das Zwanzig- bis Dreißigfache und speist sie in die Gehörschnecke ein, die Cochlea. Das Hören beginnt, im Ernst, erst hier.
Bis hierher war alles mechanisch, ein Gemisch aus Vibration, Luft- und Schalldruck. Jetzt bewegen sich die Wellen durch eine zähe Lymphe ins sogenannte Corti-Organ hinein, das die Gehörschnecke durchzieht wie ein nach innen gestülpter Tausendfüßler. 30 000 Haarzellen sind hier aufgereiht fürs weitere Rezipieren.
Sie sortieren das draußen Gehörte, Hereingetrommelte nach Frequenz und Lautstärke – und hier ereignet sich eine weitere für den Laien magisch wirkende Verwandlung: Aus den mechanisch-analogen Signalen werden mittels chemischer Prozesse, die vom Swing der Haarzellen ausgelöst werden, elektrische Impulse – und erst damit »lesbar« fürs Gehirn. Das analoge Trommeln und Vibrieren vorne am Trommelfell wird weiter hinten in der Cochlea elektrischer Strom.
Es ist, wie Nina Kraus sagt, ein Wunder, dass das so geschieht.
Beide Gehörschnecken, beide Innenohren sind über je 30 000 auf bestimmte Reizgruppen spezialisierte Hörnerven mit dem Hirnstamm verbunden. Sie werden jetzt zur Übertragung genutzt. Im Gehirn stehen die sogenannten Schneckenkerne bereit, das in elektrische Impulse verwandelte »Gehörte« vorzusortieren. Richtig Ordnung schaffen danach im Hinterhirn die Neuronenbündel der »oberen Olive«.
Sie bewertet, in welcher Entfernung die Schallquellen liegen und wo im Raum, was sich durch ihr zeitliches Eintreffen ermitteln lässt. Ein Geräusch rechts von uns wird im rechten Ohr eine Hunderttausendstelsekunde früher verarbeitet als im linken. So melden es die Hörnerven, und die Olive registriert es und zieht daraus Schlüsse. Sie versetzt uns in die Lage, zu verstehen, dass auf der Geburtstagsparty rechts die Freundin redet und links der Freund lustige Geschichten erzählt. In der Olive wird ununterbrochen eine Art Zeitprotokoll geführt.
Im Mittelhirndach sitzt ein weiteres Rechenzentrum ohnegleichen, das »untere Hügelchen«, Treffpunkt aller sinnlichen Reize, ein gigantisch leistungsstarkes Mischpult auf engstem Raum, die eigentliche menschliche Soundmaschine. Entscheidend, wie Kraus sagt, »den Lauten einen Sinn zu geben« – und hier ist, wie die Fachleute sagen, das Ende der Hörbahn erreicht.
Es beginnt das eigentliche, das bedeutungsvolle Hören im Gehirn. Über den sogenannten Thalamus geht es in den Cortex, die Hirnrinde, und also in die Welt des menschlichen Bewusstseins, der Erregung, der Gefühle. Wir betreten, wenn man so will, das Reich, in dem sich die Macht der Musik erst entfalten kann.
Hier gibt es Zonen der Decodierung für Sprache, für Musik, für Rhythmen mit schönen Namen wie Broca-Areal, es gibt die Sylvische Furche, die über den Ohren im Schläfenlappen sitzt. Hier werden musikalische Muster erkannt, Tonarten, Stimmen und Stimmungen unterschieden, Harmonien, Klangfarben, Wohlklang, Dissonanzen, überraschende Ton- oder Taktsprünge. Es gibt seit Kurzem erste Studien, die aus raffinierten Messungen der Hirnaktivität ableiten können, man stelle sich vor, ob der zugehörige Mensch gerade Jazz hört oder klassische Musik.
In der Forschung gehen gerade, auch dank der Möglichkeiten zur Mustererkennung durch Künstliche Intelligenz, völlig neue Baustellen auf, von denen uns in den kommenden Jahren hochspannende Neuigkeiten erreichen werden. Noch ist es, wie Kraus sagt, »so aufregend wie ernüchternd, was wir alles nicht wissen«. Noch immer wirkt die Wissenschaft vom Hören im Gehirn, als stünde sie erst am Anfang. Aber es geht voran, langsam, stetig, seit Jahren.
Es ist heute möglich, zu sagen, dass das vom Gehirn einmal »Gehörte« von einer weiteren Armee »ableitender« Neuronen verarbeitet wird, die sich darum kümmern, aus dem Empfangenen die richtigen Schlüsse ziehen. Das limbische oder Belohnungssystem ist nun an der Reihe, die Gefühlszentrale unserer Begierden, unserer Bedürfnisse und Sehnsüchte, eng mit dem Hören verwoben. Hier geht es auch um das große Faszinosum der Musik, dass sie beim Hören immerfort Vorfreude auslöst: Vorfreude auf den nächsten Ton, die kommende Wendung oder die Befriedigung, wenn sich eine Harmonie wie erwartet wirklich einstellt.
Das Gehirn hört »nach vorne«, es versucht zu erraten, was kommt. Und wenn es richtigliegt, stellt sich Befriedigung ein, und wenn es falsch liegt, entsteht Enttäuschung. Aber diese kann wiederum neues Interesse daran wecken, was es mit der Regelverletzung auf sich hat. Musik ist für das Gehirn ein andauerndes Zirkeltraining.
Ständig laufen Prozesse gleichzeitig ab, die die Ausschüttung von Hormonen und diversen Neurotransmittern steuern. Im limbischen System wird über die Ausgabe von Dopamin entschieden, häufig das Glückshormon genannt und im Körper immer dann reichlich vorhanden, wenn es um Essen, Musik und Sex geht. Hier wird auch die Ausschüttung von Serotonin bewerkstelligt, dem Botenstoff der Anerkennung und Belohnung. Hier werden Oxytocin-Level gesteuert, das Bindungshormon, wesentlich für die Mutter-Kind- und andere Beziehungen, aber auch dann massiv im Einsatz, wenn Menschen gemeinsam singen oder im Konzert ein Hörerlebnis teilen. Es löst Gefühle von Vertrauen aus, Empathie, Zugehörigkeit, Großzügigkeit.