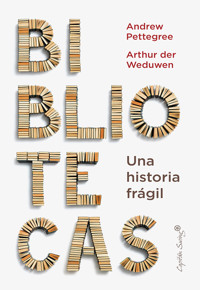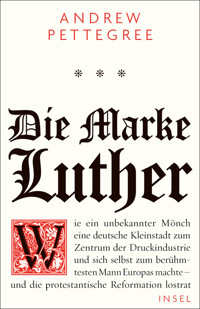
23,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Insel Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Als Martin Luther 1517 seine 95 Thesen an die Tür der Wittenberger Schlosskirche nagelte, war er praktisch unbekannt. Doch innerhalb weniger Jahre verbreiteten sich seine Ideen in ganz Europa und erschütterten den Kontinent in seinen Grundfesten. Luther wurde berühmt, ja berüchtigt. Wie hatte er das geschafft?
Der wichtigste Reformator der Kirchengeschichte war nicht nur ein herausragender Theologe, sondern auch ein genialer Stratege, der ganz genau wusste, dass es nicht allein Argumente sind, die im Kampf der Ideen den Ausschlag geben. Mit sicherem Gespür für das, was wir heute Imagepflege und Marketing nennen, machte er sich die neue Technik des Buchdrucks zunutze, baute Netzwerke auf und schuf gemeinsam mit Lucas Cranach für sich und seine Lehre eine eigene Markenidentität.
Andrew Pettegree zeichnet nach, wie es Luther gelang, sich in der Öffentlichkeit zu positionieren – als Kritiker der katholischen Kirche, als Vorkämpfer für Frauenrechte, als Demagoge, der auch gegen Juden wetterte. Er schildert den nachhaltigen Einfluss, den die Reformation auf das Buchgewerbe hatte, und umgekehrt. Vor allem aber erzählt er eine der wohl spannendsten Geschichten der Neuzeit: wie ein einfacher Mönch zum ersten Star des Medienzeitalters aufstieg.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 559
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Als Martin Luther 1517 seine 95 Thesen an die Tür der Wittenberger Schlosskirche nagelte, war er praktisch unbekannt. Doch innerhalb weniger Jahre verbreiteten sich seine Ideen in ganz Europa und erschütterten den Kontinent in seinen Grundfesten. Luther wurde berühmt, ja berüchtigt. Wie hatte er das geschafft?
Der wichtigste Reformator der Kirchengeschichte war nicht nur ein herausragender Theologe, sondern auch ein genialer Stratege, der ganz genau wusste, dass es nicht allein Argumente sind, die im Kampf der Ideen den Ausschlag geben. Mit sicherem Gespür für das, was wir heute Imagepflege und Marketing nennen, machte er sich die neue Technik des Buchdrucks zunutze, baute Netzwerke auf und schuf gemeinsam mit Lucas Cranach für sich und seine Lehre eine eigene Markenidentität.
Andrew Pettegree zeichnet nach, wie es Luther gelang, sich in der Öffentlichkeit zu positionieren – als Kritiker der katholischen Kirche, als Vorkämpfer für Frauenrechte, als Demagoge, der auch gegen Juden wetterte. Er schildert den nachhaltigen Einfluss, den die Reformation auf das Buchgewerbe hatte, und umgekehrt. Vor allem aber erzählt er eine der wohl spannendsten Geschichten der Neuzeit: wie ein einfacher Mönch zum ersten Star des Medienzeitalters aufstieg.
Andrew Pettegree ist Professor für Moderne Geschichte an der University of St Andrews. Er gilt als einer der führenden Experten für das Europa im Zeitalter der Reformation, ist Gründungsdirektor des St Andrews Reformation Studies Institute sowie gegenwärtig Vizepräsident der Royal Historical Society. Bei Yale University Press erschien 2014 The Invention of News. How the World Came to Know About Itself.
Andrew Pettegree
Die Marke Luther
Wie ein unbekannter Mönch eine deutsche Kleinstadt zum Zentrum der Druckindustrie und sich selbst zum berühmtesten Mann Europas machte – und die protestantische Reformation lostrat
Aus dem Englischen von Ulrike Bischoff
Insel Verlag
eBook Insel Verlag Berlin 2016
Der vorliegende Text folgt der deutschen Erstausgabe, 2016.
© dieser Ausgabe Insel Verlag Berlin 2016
© Andrew Pettegree 2015
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel Brand Luther. 1517, Printing, and the Making of the Reformation bei Penguin Press New York, an Imprint of Penguin Publishing Group, a divison of Penguin Random House LLC.
This edition published by arrangement with Penguin Press, an imprint of Penguin Publishing Group, a division of Penguin Random House LLC.
Die Übersetzung erscheint mit freundlicher Genehmigung von Penguin Press.
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das des öffentlichen Vortrags sowie
der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen, auch einzelner Teile.
Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar.
Umschlaggestaltung: hißmann, heilmann, hamburg / Gundula Hißmann
eISBN 978-3-458-74904-2
www.suhrkamp.de
Inhalt
Vorwort
TEIL I: Ein bemerkenswerter Mann
1. Eine Kleinstadt in Deutschland
2. Die Geburt eines Revolutionärs
3. Der Ablass
TEIL II: Im Auge des Sturms
4. Im Auge des Sturms
5. In Acht und Bann
6. Die Marke Luther
TEIL III: Freunde und Feinde
7. Luthers Freunde
8. Die Reformation in den Städten
9. Trennungen
TEIL IV: Der Aufbau der Kirche
10. Hirte der Nation
11. Das Ende
12. Das Vermächtnis
Danksagung
Abkürzungen
Anmerkungen
Bildnachweis
Register
Vorwort
Im Jahr 2017 begehen wir den fünfhundertsten Jahrestag eines bahnbrechenden Ereignisses der westlichen Zivilisation: des Beginns der protestantischen Reformation. Aus geringfügigem Anlass – einem theologischen Streit in Ostdeutschland – entwickelte sich eine stürmische Erneuerungs- und Reformbewegung, die alles infrage stellte, dem Bestehenden die Stirn bot und letztlich äußerst spaltend wirkte. Innerhalb einer Generation veränderte der Reformbegriff seine Bedeutung grundlegend. Anhänger der Bewegung, die sich mittlerweile Protestanten nannten, trennten sich von der westlichen katholischen Tradition – eine permanente Loslösung, die unversöhnlich war, wie sich herausstellen sollte. In den folgenden zwei Jahrhunderten zerfiel Europa in sich bekämpfende Kirchen, gespaltene Familien und verfeindete Staaten. Die Feindschaft zwischen Protestanten und Katholiken beherrschte die europäische Politik und entfachte Kriege, die mit mörderischem Hass geführt wurden. Die Christenheit zerfleischte sich im Kampf gegen den inneren Feind. In ganz Europa zog man die Staatsmacht heran, um Ketzer oder Verräter hinzurichten – also die Abtrünnigen von der örtlich geltenden Religion, sei sie nun protestantisch oder katholisch.
Diese erbitterte, grausame Spaltung erwies sich als dauerhaft. So demonstrierte der König von Frankreich 1685 seine Frömmigkeit, indem er seine verbliebenen protestantischen Untertanen des Landes verwies: Bis zu 900 000 Protestanten mussten ihre Heimat für immer verlassen. Drei Jahre später vertrieb England seinen König, weil er katholisch war; von da an schloss ein Gesetz alle von der Thronfolge aus, die einen Katholiken heirateten – eine Regelung, die erst 2013 aufgehoben wurde. Diese Risse und zersetzenden Konfessionsbindungen wanderten vom alten Europa auch über den Atlantik: Erst 1960 wählten die Vereinigten Staaten ihren ersten katholischen Präsidenten, und das auch nur mit der denkbar knappsten Mehrheit.
Das Ereignis, das in der Geschichtsschreibung den Beginn dieser Umwälzungen markiert, ist in diesem Kontext erstaunlich banal. Mittlerweile datieren wir die Reformation auf den 31. Oktober 1517, an dem ein kaum bekannter deutscher Professor eine akademische Disputation anstieß – ein so alltäglicher Vorgang an den Universitäten des 16. Jahrhunderts, dass niemand es damals der Mühe wert fand, festzuhalten, ob die Disputationsthesen gedruckt und am üblichen Schwarzen Brett der Universität, nämlich der örtlichen Kirchentür, angeschlagen wurden. Dieser Professor war Martin Luther, und seine 95 Thesen gegen den Ablass lösten eine unerwartet hitzige Debatte aus. Innerhalb von fünf Jahren geriet die deutsche Kirche in Aufruhr, wurde Luther als Ketzer geächtet und stieg zum berühmtesten Mann Deutschlands auf.
Wie ein akademischer Streit in Nordostdeutschland zum Keim einer großen Bewegung werden konnte, ist erklärungsbedürftig. Es liegt nicht in meiner Absicht, diese Erklärung in einer weiteren Lutherbiografie zu suchen. Luther war, wie sich zeigen wird, ein bemerkenswerter Mann voller Mut und Talent, der seinen Schicksalsmoment außerordentlich gekonnt und einfallsreich zu nutzen wusste. Sein Leben und Wirken war von seinen Lebzeiten bis heute Gegenstand unzähliger Studien und Neubewertungen, und der Jahrestag der Reformation wird Anlass zu weiteren Bestandsaufnahmen bieten. Dieses Buch verfolgt einen völlig anderen Zweck: Es befasst sich mit der Frage, wie ein theologischer Streit im gänzlich andersartigen Kommunikationsumfeld, das vor fünfhundert Jahren herrschte, zu einem großen öffentlichen Ereignis werden konnte, das Kleriker und Laien über weite Teile des europäischen Kontinents erfasste.
Nichts von alledem verlief, wie es hätte laufen sollen. Die Kirchenhierarchie war 1517 fest von ihrer Fähigkeit überzeugt, dem Wirbel um Luther ein Ende setzen zu können. Die üblichen Kanäle, ein vertraulicher Brief an einflussreiche Persönlichkeiten, untermauert von einem Gerichtsverfahren in Rom, hätten genügen müssen, einen aufrührerischen Priester zum Schweigen zu bringen. Es gab keinen Grund zu der Annahme, dass die Kritik am Ablasshandel, die damals in intellektuellen Kreisen bereits recht verbreitet war, sich zu einer öffentlichen Bedrohung auswachsen würde. Vor allem aber bestand kein Grund zu der Annahme, dass Kursachsen, ein mittelgroßes Fürstentum fernab von den großen europäischen Machtzentren, zur Brutstätte einer Bewegung von europäischer Tragweite werden könnte.
Um zu verstehen, wie es dazu kam, müssen wir eine äußerst merkwürdige Verkettung von Ereignissen und Umständen untersuchen, die es Luther ermöglichte, die breite Öffentlichkeit zu faszinieren und vor allem diesen Konflikt zu überleben. Luther hatte wie die meisten großen Persönlichkeiten der Geschichte viel Glück: Er hatte Glück, unter dem Schutz einflussreicher Förderer zu stehen, die erkannten, wie es ihren Zwecken dienen konnte, ihn zu schützen. Er hatte Glück mit seinen Freunden. Zudem wählte er den richtigen Zeitpunkt aus. Als Luther sich erstmals gegen das Ablasswesen aussprach, fing Europa gerade – wenn auch mit einer gewissen Zurückhaltung – an, sich ein neues, mächtiges Kommunikationsmittel zu eigen zu machen: die Druckerpresse. Sechzig Jahre zuvor hatte Johannes Gutenberg unter allgemeinem Beifall den Erfolg seiner Experimente verkündet, mit beweglichen Lettern zu drucken, aber die langfristigen Konsequenzen dieser technischen Entwicklung waren noch höchst ungewiss. Diejenigen, die das neue Medium begeistert aufgriffen, mussten erkennen, dass es ausgesprochen schwierig war, mit gedruckten Büchern Geld zu verdienen: Die meisten der ersten Drucker machten Verluste und viele gingen bankrott. Ernüchtert suchte die zweite Generation Zuflucht zu konservativen Geschäftsfeldern. Daher war durchaus nicht klar, wie oder warum der Buchdruck einer großen umwälzenden Bewegung dienen könnte. Tatsächlich stellten Drucker fest, dass es die zuverlässigsten Gewinne versprach, die Bedürfnisse der traditionellen Religion zu bedienen. Es bedurfte einiger Überzeugungsarbeit, sie zur Aufgabe dieses bewährten Geschäftszweigs zu bewegen.
Es stand also keineswegs fest, welche Rolle der Buchdruck in dem rumorenden Kirchenstreit in der norddeutschen Kirche spielen sollte. In Wittenberg, Luthers Wirkungsstätte in Sachsen, gab es bis 1502 gar keine Druckerpresse: Seit Gutenbergs Erfindung war ein halbes Jahrhundert der Experimente und des Wachstums auf diesem Gebiet an der Stadt völlig vorbeigegangen. Luther selbst hatte sein Erwachsenenalter und eine Stellung von bescheidener Verantwortlichkeit und Ansehen in seinem Orden erreicht, ohne auch nur ein Buch zu veröffentlichen. Doch innerhalb von fünf Jahren, nachdem er seine 95 Thesen angeschlagen hatte, war er Europas meistveröffentlichter Autor – aller Zeiten. Wie er dies erreichte, war der bemerkenswerteste unter den zahlreichen unwahrscheinlichen Aspekten der Reformation. Diese Geschichte ist das Thema des vorliegenden Buches.
Es ist eine Entwicklung, in der Luther sich nahezu über Nacht als Schriftsteller von außerordentlicher Kraft und Leichtigkeit erwies, als natürlicher Stilist in einem Genre, das solche Qualitäten bis dahin nicht sonderlich zu schätzen wusste. In diesem Prozess schuf Luther im Grunde eine neuartige Form theologischer Schriften: knapp, direkt und leicht verständlich. Entscheidend war, dass er bereits in einem frühen Stadium des Aufsehens um seine Kritik am Ablasshandel den kühnen, radikalen Entschluss fasste, sich nicht nur an das Fachpublikum ausgewiesener Theologen zu wenden, sondern die breite deutsche Öffentlichkeit in ihrer eigenen Sprache, Deutsch, anzusprechen. Diese Entscheidung, von der Gelehrtensprache Latein abzugehen, war heftig umstritten, erlaubte es jedoch, einem Laienpublikum komplexe theologische Ideen darzulegen. Zudem brachte sie seine Gegner so weit ins Hintertreffen, dass sie sich davon nie vollständig erholten. In jedem Fall weitete sie den potenziellen Markt für Luthers Bücher erheblich aus. Deutschlands Drucker reagierten mit gieriger Begeisterung.
Luthers Schriften fanden in Deutschland reißenden Absatz, bewirkten zugleich aber auch einen Wandel in der Dynamik der Buchbranche. Zur Zeit der Reformation hatte die europäische Druck- und Verlagslandschaft sich bereits relativ verfestigt und bot in ihrer Infrastruktur eigentlich keinen Platz für das kleine Wittenberg. Die wichtigsten Druckereien hatten sich alle in Europas größten Wirtschaftszentren etabliert. Wittenberg war dagegen klein und abgelegen, fernab von den großen Märkten, die notwendig waren, um eine umfangreiche Buchproduktion zu tragen. Schon sehr früh erkannte Luther, dass sich diese Situation ändern musste: Wittenberg musste eine Buchbranche entwickeln, die imstande wäre, die enorme Nachfrage nach seinen Werken zu befriedigen, und die der Schlagkraft seiner Forderung nach einer grundlegenden Reform des Christentums gerecht würde.
Zu diesem Zweck griff Luther bereits in einem sehr frühen Stadium seiner Bekanntheit unmittelbar und energisch in den Druckereibetrieb ein. Bis 1517 gab es in Wittenberg lediglich eine einzige, nicht sonderlich leistungsstarke Druckerpresse. Bei Luthers Tod reichte Wittenbergs Buchproduktion an die der bedeutendsten Städte Deutschlands heran. Im gesamten 16. Jahrhundert war Wittenberg Deutschlands größtes Buchdruckzentrum. Das war Luthers ganz persönliches Verdienst. Er war kein zerstreuter Professor, sondern ein Mann mit ausgeprägten praktischen Fähigkeiten. Er verstand und genoss die handwerklichen Schritte, aus Worten und Ideen ein gedrucktes Kunstwerk zu machen. Da Luthers Vater im Kupferbergbau gearbeitet hatte, dürfte Martin schon von Kind an mit den wirtschaftlichen Chancen und Risiken vertraut gewesen sein, die der Abbau von Edelmetallen in einer rauen, unerbittlichen Landschaft mit sich brachte. Sobald er Schriftsteller wurde, setzte er diese Erfahrungen nutzbringend um.
Luther verbrachte im Laufe seines Lebens viel Zeit in den Druckereien, beobachtete und gab Anweisungen. Er hatte klare Vorstellungen, wie seine Bücher aussehen sollten, und stellte hohe Ansprüche. Vor allem aber hatte Luther ein Gespür für die Ästhetik des Buches. Er begriff, dass Qualität und Gestaltung des Druckwerks, das seine Botschaft vermittelte, selbst ein visuelles Symbol für deren Seriosität und Wahrheit war. In einer entscheidenden Initiative holte Luther 1519 einen erfahrenen Drucker nach Wittenberg, der mit der Nachfrage nach seinem Werk Schritt halten konnte, und übernahm von da an eine führende Rolle in der Buchproduktion der Stadt. Vor allem aber achtete er sorgfältig darauf, seine kostbaren Originalschriften auf die wachsende Zahl von Druckereien zu verteilen, um zu gewährleisten, dass alle lebensfähig waren.
Dieser entscheidende Aspekt in Luthers Reformationsgeschichte wird nicht oft erwähnt. Dabei ging es nicht nur um die starke Nachfrage nach Luthers Werken, obgleich sie durchaus beeindruckend war. Luther war hinreichend populär, um Buchdrucker in ganz Deutschland, nicht nur in Wittenberg, zu ernähren. Ein weiterer wesentlicher Aspekt war, dass er in Zusammenarbeit mit seinen Druckern das Erscheinungsbild des Buches veränderte. Darin fand er wesentliche Unterstützung von Lucas Cranach, der Hofmaler in Wittenberg und ebenfalls eine treibende Kraft im Buchdruck war. Tatsächlich kann man sogar vertreten, dass Cranachs wichtigster Beitrag zur Reformation nicht in den Lutherporträts bestand, die das Bildnis des Reformators und seinen Ruhm in Deutschland verbreiteten und Kultstatus erlangten, sondern in seinem Anteil an der Entwicklung einer neuen Markenidentität für Wittenbergs Reformationsschriften. Diese Gestaltung verlieh Luthers Werken eine neue, markante Aufmachung, die sie auf einem vollen Bücherstand sofort erkennbar machten. In der Folge entwickelte sich eine Form von Buch, das an sich schon ein wirkmächtiger Repräsentant der Bewegung war, kühn, klar und erkennbar anders als alles Vorhergehende: Die Marke Luther. Ihr Erfolg stand im Zentrum der stürmischen Ereignisse, die sein Heimatland in den turbulenten Jahren nach 1517 erschütterten. Sie bildet den Kern für Luthers Erfolg und die umwälzende Wirkung der Reformation.
TEIL I
Ein bemerkenswerter Mann
KAPITEL 1
Eine Kleinstadt in Deutschland
Wie viele imposante Persönlichkeiten der Geschichte war auch Luther von Natur aus gesellig. Er mochte Menschen und hatte sie gern um sich. Das war sicher eine Gnade, denn in seiner zweiten Lebenshälfte war Luther nur selten allein. Von dem Moment an, als er 1517 ins Bewusstsein seiner deutschen Landsleute trat, war Luther umstritten, polarisierend, charismatisch und inspirierend – und ist es in gewissem Maße bis heute geblieben. Kaum jemand, der persönlich mit ihm in Kontakt kam, vergaß diese Erfahrung. Schon früh in seiner Karriere erregte dieser eindringliche junge Mönch das Interesse einiger einflussreicher Persönlichkeiten, die in ihm ein besonderes Talent erkannten. Im Laufe seines Lebens weckte er bei engen Vertrauten eine leidenschaftliche Hingabe. Tausende zogen in Scharen nach Wittenberg, um seine Predigten oder vielleicht sogar eine seiner Vorlesungen zu hören. Wer zu seinem Freundeskreis zählte, genoss das Privileg, mit ihm am Tisch sitzen zu dürfen, wo Luther entspannte und Reden hielt.
Das war Luthers ureigenes Terrain. Nach getaner Arbeit setzte er sich mit seinen Freunden zusammen und redete. Beflügelt vom exzellenten Bier seiner Frau, wandte sich das Gespräch allgemeinen Themen zu, gestaltete sich weitschweifig und gelegentlich zwanglos. Häufig machte sich einer seiner eifrigeren Tischgenossen Notizen von den Äußerungen seines Meisters. Luther, der dreißig Jahre lang an einer Universität lehrte und es gewohnt war, von mitschreibenden Studenten umgeben zu sein, kümmerte sich nicht sonderlich darum.
Nicht alles, was bei Tisch gesagt wurde, liest sich heute sonderlich gut. In zwangloser Runde unter Freunden wollte Luther mit seinen Äußerungen manchmal schockieren und hatte Spaß an Empörendem. Seine Scherze sind für uns nicht immer amüsant. Aber die Tischreden stecken auch voller tiefgründiger, wenngleich unstrukturierter theologischer Ausführungen und scharfsinniger Beobachtungen zur zeitgenössischen Gesellschaft.1
Merkwürdig ist, dass Luther in dieser Fülle von Äußerungen so wenig über seine eigene Bewegung, die Reformation, sagte. Von 1517, als er erstmals öffentliche Aufmerksamkeit erregte, bis zu seinem Tod dreißig Jahre später hatten Luther und seine Anhänger ihre Welt radikal verändert. Die westliche Christenheit hatte sich – wie sich herausstellen sollte, dauerhaft – gespalten. Familien, Städte und Staaten waren gezwungen, sich für eine Seite zu entscheiden: Entweder sie blieben bei der alten Kirche oder sie folgten Luther in das Schisma und in neue Glaubens- und Kultusformen. Dies alles nahm Luther mit erstaunlicher Gelassenheit hin. Sein gesamtes Handeln war von Gott diktiert: Der Weg, den er eingeschlagen hatte, war von einer höheren Macht vorgegeben. In dieser Hinsicht war das bemerkenswerte Leben, das er geführt hatte, nicht sein eigenes Werk, sondern die Folge gefügigen Gehorsams gegenüber Gottes Gebot.
So bleibt es uns in unserem säkulareren Zeitalter überlassen, über Luthers große Leistung, aber auch über das schier Unwahrscheinliche dieser ganzen Entwicklung nachzudenken. Luthers Karriere war Monument eines überragenden Talents, aber auch eine Pyramide aus vielfältigen Unwahrscheinlichkeiten. In Luthers ersten dreißig Lebensjahren deutete nichts darauf hin, dass er einen ganzen Kontinent umwälzen würde. Es war ungewöhnlich, dass ein Mann, der sich eine stetige und – für jemanden von seiner Herkunft – erstaunlich erfolgreiche Karriere in der Kirche aufgebaut hatte, plötzlich sowohl die Institution als auch ihre geistige Führung ablehnen sollte. Noch ungewöhnlicher war, dass er dies überleben und seine Geschichte erzählen sollte.
Als er auf dem Höhepunkt der »Luther-Affäre« 1521 quer durch Deutschland fuhr, um sich beim Wormser Reichstag dem Urteil des Heiligen Römischen Reiches zu stellen, hatte man ihm freies Geleit zugesichert, sodass er unbehelligt an- und abreisen konnte. In der Entourage des Kaisers gab es jedoch manche, die Karl V. drängten, diese Zusage zurückzunehmen und Luther festnehmen und hinrichten zu lassen.2 Dieses Schicksal war einem anderen Ketzer, Jan Hus, hundert Jahre zuvor widerfahren, und viele von Luthers Freunden erwarteten es auch für ihn. Luther selbst rechnete nicht damit, Worms lebend zu verlassen. Dass er diesen kritischen Moment überhaupt erlebte, hatte er der hartnäckigen Unterstützung seines Landesfürsten, Friedrichs des Weisen, zu verdanken, eines gläubigen Katholiken, der nie von seinem alten Glauben abging. Zufällig besaß Friedrich eine der wertvollsten europäischen Reliquiensammlungen, also jener Überreste Heiliger, die im Zentrum der von Luther vehement verurteilten Ablasstheologie standen. Seltsamerweise war er seinem aufrührerischen Professor nie begegnet – vielleicht sah er ihn beim Wormser Reichstag zum ersten Mal. Viele Zeitgenossen fanden es unbegreiflich, dass Friedrich sich hinter Luther stellte. Ohne diesen Schutz wäre Luthers Karriere als Reformator sicher schon im Keim erstickt worden.
Seine Bekanntheit in diesen Jahren verdankte Luther einem weiteren höchst unwahrscheinlichen Aspekt der Reformation: dass nämlich ein Mönch, der die übliche Vorbildung anderer Kleriker besaß und bis zum Alter von Mitte dreißig keinerlei Schriften veröffentlicht hatte, sich als Schriftsteller und Polemiker von erstaunlicher Schlagkraft neu erfand. Noch erstaunlicher ist, dass Luther in einer Zeit, die langatmige, ausführliche Darlegungen, Komplexität und Wiederholungen schätzte, instinktiv den Wert der Kürze erkannte. Tatsächlich erfand er eine neue Form theologischer Schriften: kurz, klar, direkt und nicht nur an seine Fachkollegen, sondern an das breite Christenvolk gerichtet. Diese Offenbarung in Stil, Zweck und Form bildete den Kern der Reformation und steht im Zentrum dieses Buches.
Alles das erreichte Luther von einem höchst unwahrscheinlichen Ort aus, einem kleinen, unbedeutenden Marktflecken am östlichen Rand Europas, der bis dahin in den Annalen der europäischen Geschichte kaum in Erscheinung getreten war: Wittenberg. In mancherlei Hinsicht war das der unwahrscheinlichste Aspekt der Reformation, der im Europa der Renaissancezeit ohnegleichen war. Im 16. Jahrhundert bestand der Kontinent aus aufstrebenden Nationalstaaten mit regem Geistesleben. Mit ihren Kirchen, Universitäten und den neuen gedruckten Büchern gehörten die Städte zur größten Zierde dieser Kultur. Von dieser kulturellen und wirtschaftlichen Renaissance war jedoch kaum etwas bis in die sandige, spärlich besiedelte Tiefebene Nordostdeutschlands vorgedrungen. Als Martin Luther 1508 nach Wittenberg kam, war er nicht sonderlich beeindruckt – diese Einschätzung teilten die wenigen, die ihre Erinnerungen an diese kleine Grenzstadt schriftlich festhielten.
Und doch kam es so: Nachdem Luther sich 1511 dauerhaft in Wittenberg niedergelassen hatte, war sein Schicksal untrennbar mit dem seiner neuen Heimat verknüpft. Wittenberg wurde zur Lutherstadt – ein Titel, den sie sich im 20. Jahrhundert zulegte. Die Stadt war das Zentrum der Reformation und vollzog Luthers umwälzende Veränderung mit und nach.
Auf dem Weißen Berg
Als Luther erstmals durch die Stadttore von Wittenberg ging, dürfte er einen bescheidenen Marktflecken mit zweitausend Seelen vorgefunden haben.3 Die deutschen Großstädte waren damals bereits fünfzigmal so groß, und selbst in der näheren Umgebung nahm sich Wittenberg winzig aus neben dem regionalen Handelszentrum Leipzig und der lebendigen Universitätsstadt Erfurt, in der Luther seine prägenden Jahre verbracht hatte. Erstmals trat Wittenberg als Siedlung im 12. Jahrhundert nach harten Kämpfen gegen die örtliche slawische Bevölkerung in Erscheinung. Den aus Flandern stammenden Siedlern, die diese Region neu bevölkern sollten, erschienen die sanften Hügel in Elbnähe eindrucksvoll genug, um ihre neue Heimat Wittenberg, Weißer Berg, zu nennen nach dem weißen Sand der Dünen am Ufer des Flusses, der an dieser Stelle hinreichend flach für eine Furt war. In den folgenden zweihundert Jahren erwuchs aus dieser Siedlung eine befestigte Stadt, die stark genug war, in den Hussitenkriegen einer Belagerung standzuhalten. Sie konnte jedoch das Flair einer Grenzstadt nie ganz abschütteln, die eine Bastion gegen die fremden Horden bildete. Die größten Städte dieser Region, Leipzig und Erfurt, lagen bezeichnenderweise weiter südlich und westlich in Richtung des kultivierten südlichen Zentrums des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation.
Abb. 1: Wittenberg.
Die Ansicht vom Südufer der Elbe auf die Stadt zeigt links den Schlosskomplex, in der Mitte die Pfarrkirche und ganz rechts das Augustinerkloster.
Von Erfurt aus hatte man Luther in ein Augustinerkloster in Wittenberg geschickt, und die ersten erschreckenden Eindrücke hatte er nie vergessen. Einige Jahre später merkte er an, dass ihm die Stadt am Ende der zivilisierten Welt erschienen sei, »in termino civilitatis«.Wäre sie nur ein Stück weiter östlich gelegen, hätte sie sich »in mediam barbariam«, inmitten von Barbaren, befunden.4
Ebenso wenig schmeichelhaft äußerten sich andere Besucher. Ein Reisender, der etwa zur gleichen Zeit wie Luther nach Wittenberg kam, beschrieb es als armen, unattraktiven Ort mit alten, hässlichen Fachwerkhäuschen, der mehr von einem Dorf als von einer Stadt habe.5 Nachdem Luthers Ansichten traurige Berühmtheit erlangt hatten, griffen seine Gegner solche Vorbehalte, wenig überraschend, begierig auf. So fand Johannes Cochläus, ein früher und verbissener Kritiker,
»das elend, arm, katticht [kotig] stätlyn Wittenberg, gegen prag kaum ein statt dryer heller wertt, ja nicht wert, das sie söl in teütschen landt ein statt genannt werden, […] ungesunt, unlieblich erd, on wyngarten, on baumgarten, on fruchtbar baum […] kottichte heüser, unrein gassen, alle weg, steg und strassen vol kotß, ein barbarisch volck, die keyn ander denn bierische hendel dryen und dryerhellerische kauffmanschafft«.6
Georg, Herzog des albertinischen Sachsen, ein Feind und Rivale von Luthers Förderer Friedrich dem Weisen, erklärte kurz und bündig: »das ein Einzelner mönch aus einem loch solche reformation solt fürnemen, sey nicht zu leiden«.7 Einer der Gründe, weshalb seine Gegner Luther anfangs so unterschätzten, war in der Tat, dass sie sich einfach nicht vorstellen konnten, wie aus einem solchen Ort etwas Bedeutendes hervorgehen könnte.
Neuer Wohlstand und neue Erfindungen
Wittenbergs relative Rückständigkeit war umso eklatanter, als die deutschen Städte mit einer gewissen Berechtigung damals zu den Hochburgen europäischer Kultur zählten. Im 15. Jahrhundert hatte sich das deutsche Reichsgebiet zu einem der Kraftzentren der europäischen Wirtschaft entwickelt. Während die aufstrebenden Nationalstaaten Spanien, Frankreich und England ihr Gold für Erbfolgestreitigkeiten verausgabten, war es in den deutschen Landen vergleichsweise friedlich. Das Reich hatte seinen Kaiser, einen Habsburger, der sicher bestrebt war, seine Macht auszuweiten; aber sein Landbesitz war zu weit gestreut, und vor allem beruhte seine Stellung nicht auf Erbfolge, sondern hing von der Wahl durch ein Kollegium ab, dem sieben Kurfürsten großer deutscher Länder angehörten. Sie bildeten die Elite der dreihundert Fürsten im deutschen Flickenteppich von Klein- und Kleinststaaten, deren Grenzen sich ständig änderten. Sachsen, dem Wittenberg angehörte, hätte zu den größten Ländern gehören können, wenn das Erbrecht nicht zu einer häufigen Teilung des Territoriums geführt hätte. Einige der größten Gebiete unterstanden Bischöfen, die wahre Kirchenfürsten waren wie der Erzbischof von Mainz, Albrecht von Brandenburg, der in Luthers Geschichte eine große Rolle spielen sollte.
Im 15. Jahrhundert hatten sich bereits zahlreiche größere Städte erfolgreich der Autorität der jeweiligen Reichsfürsten entzogen und unterstanden als Freie Städte oder Reichsstädte unmittelbar dem Kaiser. Die größte von ihnen, Nürnberg, besaß ein beträchtliches eigenes Territorium und pflegte in Süddeutschland eine freundschaftliche Rivalität zu Augsburg, dem Zentrum der deutschen Finanzindustrie. Zudem war Augsburg Süddeutschlands Hauptnachrichtenzentrum, eine wichtige Zwischenstation auf den Poststraßen, die Deutschland, Italien und die Niederlande miteinander verbanden.8 Im Norden waren Hamburg und Lübeck führend in der altehrwürdigen Hanse, dem Bund deutscher Handelsstädte. Im Westen lagen Köln, Straßburg und Basel strategisch günstig am Rhein, der wichtigen Verkehrsader, die Flanderns reiche Handelsstädte mit Italien verband. Die Wege über die gefährlichen Alpenpässe waren Deutschlands Lebenselixier, denn Italien war das Tor nach Asien mit seinen kostbaren Gewürzen und Seidenstoffen. Von den Vorzügen dieses internationalen Handels profitierten vorwiegend die großen Reichsstädte im Süden und Westen: Zu Beginn des 16. Jahrhunderts dürfte nur wenig von diesem Handel mit Luxusgütern bis in die kühlen nördlichen Regionen Sachsen und Thüringen vorgedrungen sein, wo Fisch und Getreide die heimischen Märkte dominierten.
In der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts entwickelte sich auf den anspruchsvollen Märkten Flanderns, Italiens und Süddeutschlands ein neuer Geschäftszweig: der Handel mit gedruckten Büchern. Als ein hartnäckiger Mainzer Unternehmer namens Johannes Gutenberg in den 1440er Jahren mit neuen Möglichkeiten experimentierte, Bücher in Massenproduktion herzustellen, war keineswegs klar, ob die Welt eine solche Erfindung überhaupt brauchte. In Europa gab es bereits einen gut entwickelten Buchhandel mit liebevoll von Hand kopierten Manuskripten. Leser und Sammler suchten sich die Handschriften der besten und berühmtesten Schreibwerkstätten aus oder brachten ihre Texte zu einem örtlichen Schreiber: Der Markt war äußerst flexibel. Der Handel mit Manuskripten florierte noch viele Jahre, nachdem Gutenberg auf der Frankfurter Messe 1454 die ersten Seiten seiner gedruckten Bibel präsentiert hatte.9 Sie erregte große Aufmerksamkeit und war schnell ausverkauft. Aber sie ruinierte ihn. Es war das letzte große Projekt, an dem er beteiligt war.
Gutenbergs von technischer Faszination und finanziellem Scheitern geprägte Geschichte war beunruhigend typisch für die ersten siebzig Jahre des Buchdrucks.10 Als sich die Nachricht von seiner großartigen Errungenschaft herumsprach, wollte jeder Fürst, Bischof und Stadtrat eine Druckerpresse in seinem Herrschaftsgebiet haben. Schnell breitete sich der Buchdruck in Deutschland, Italien und Frankreich und anschließend zögerlicher auch in Europas Peripherie aus: in Spanien, England und Skandinavien. Aber die meisten Druckereien hatten einen ungünstigen Standort in Kleinstädten, fernab von den großen Bevölkerungszentren, und mussten schließen, nachdem sie nur eine Handvoll Titel herausgebracht hatten. Es dauerte eine Weile, bis der entscheidende Mangel dieses Geschäftsmodells deutlich wurde. Dreihundert, fünfhundert oder sogar tausend Exemplare eines gedruckten Buches herzustellen war vergleichsweise einfach. Aber der Verkauf von Handschriften, der im Grunde auf Einzelhandel basierte und jeweils ein Exemplar und einen Käufer zusammenbrachte, lieferte keinerlei Hinweise darauf, wie sich Bücher in solchen Mengen auf einem Markt verkaufen ließen, der sich auf ganz Europa erstreckte.
Erst nach dreißigjährigen Investitionen und Fehlschlägen entwickelte die Branche mühsam eine Lösung mithilfe von Leuten, die solche Erfahrungen besaßen: die wohlhabenden Kaufleute, die Europas internationalen Handel mit Luxusgütern dominierten. Diese Männer wussten, was für den Erfolg dieses neuen Geschäftszweigs nötig war: Man musste Kapital für die erforderlichen Investitionen auftreiben, Bücher en gros an große Märkte transportieren, wo sie häufig im Tausch gegen andere Bücherlieferungen gehandelt werden konnten. Sie wussten, wie man Lager für viele Zentner Papier besorgte, bis eine Auflage veräußert werden konnte, und wie man die komplizierten Kredit- und Währungsgeschäfte abwickelte, die in jeder kapitalintensiven Branche notwendig waren.
So kam es zu einer Konzentration der Buchbranche. Zeitweise wurden im 15. Jahrhundert zwar an mehr als zweihundert europäischen Orten Bücher gedruckt, aber zwei Drittel der erschienenen Titel stammten aus nur zwölf Städten. Alle waren große Wirtschaftszentren mit strategisch günstigem Standort in Europas Haupthandelsplätzen: sechs in Deutschland, vier in Italien und zwei in Frankreich.11 Diese eherne Geografie der Buchproduktion sollte sich als erstaunlich dauerhaft erweisen. Von den zwölf großen europäischen Druckorten des 15. Jahrhunderts hatte keiner weniger als 30 000 Einwohner. Das galt auch für die Nachzügler der Buchdruckelite im 16. Jahrhundert, London und Antwerpen.
In dieser Welt hätte es eigentlich keinen Platz geben dürfen für das kleine Wittenberg. Anfangs war es auch tatsächlich so. Die Experimentierphase des Buchdrucks im 15. Jahrhundert, also die Inkunabeln-Zeit, war völlig an Wittenberg vorübergegangen. Die Bücher, die Einwohner der Kleinstadt brauchten – und das waren nicht viele –, konnten sie in den Nachbarorten Erfurt und Leipzig kaufen, wo es schon früh ein reges Druckgewerbe gab. Erst 1502 bekam Wittenberg die erste Druckerpresse für die neu gegründete Hochschule. Die meisten Universitätsstädte verfügten über eine eigene Druckerei, die jedoch nicht gerade florierte. In Wittenberg konnte sie sich wahrscheinlich nur über Wasser halten, weil Kurfürst Friedrich der Weise fest entschlossen war, seine Hauptstadt mit dem passenden Beiwerk einer kulturellen Hochburg auszustatten.
Innerhalb der folgenden fünfzig Jahre entwickelte sich Wittenberg jedoch, allen Regeln dieses neuen Wirtschaftszweigs zum Trotz, zu einem Zentrum des Buchdrucks. Das war nahezu ausschließlich Martin Luther zu verdanken: seiner Berühmtheit, seiner leidenschaftlichen Anhängerschaft und seinem ungewöhnlichen schriftstellerischen Talent.
Dieses Buch erzählt, wie eine neue revolutionäre Bewegung in einer abgelegenen Kleinstadt entsprang und Deutschland im Sturm eroberte. Es ist jedoch nicht nur eine Geschichte von Büchern. Luther und seine Freunde nutzten jedes Kommunikationsmittel, das Europa im Mittelalter und in der Renaissance kannte: Briefe, Lieder, Mundpropaganda, Gemälde und Drucke.12 Viele Anhänger kamen zu der neuen Bewegung, nachdem sie Luther erstmals hatten reden hören, andere wurden von führenden Persönlichkeiten in den über hundert deutschen Städten, die sich der Reformation angeschlossen hatten, an die evangelische Botschaft herangeführt. Beflügelt wurde die Reformation vor allem, weil ihre Verfechter begriffen, dass die Kanzel eines der wirkmächtigsten Organe war, das der Gesellschaft im 16. Jahrhundert zur Verfügung stand, um die Öffentlichkeit zu informieren und zu überzeugen. Gleichwohl wäre es ohne den Buchdruck nicht zur Reformation gekommen. Denn die Druckwerke machten Martin Luther, der in seinen ersten dreißig Jahren nichts veröffentlicht hatte, umgehend berühmt. Seine Genialität ließ ihn eine Chance ergreifen, die so gut wie gar nicht existiert hatte, bevor er einen neuen Weg erfand, durch Bücher zu missionieren. Im Laufe dieses Prozesses veränderte er die westliche Religion und die europäische Gesellschaft für immer.
Auch Wittenberg veränderte er. Die Stadt, in der es vor 1500 keinen Buchdruck gegeben hatte, entwickelte sich zu einer treibenden Kraft dieses neuen Wirtschaftszweigs, der ausschließlich vom Ruhm ihres bekannten Professors lebte. Und Wittenberg war keineswegs ein Einzelfall. In vielen mittleren und kleinen deutschen Städten brachte die Reformation einer Branche, die nach der ersten Blüte allzu überschwänglicher Experimente dahinsiechte, neuen Aufschwung.13
Das alles verdankte Deutschland Luther: und in dieser Hinsicht war Wittenberg ein Mikrokosmos innerhalb eines umfassenderen Wandels. Aber es begann in Wittenberg, und zwar recht langsam, denn anfangs fiel es dem verschlafenen Nest schwer, zu begreifen, was sich in seiner Kirche und seiner Universität Ungeheures abspielte. Luther, der instinktiv die Macht des Buchdrucks erfasste – einer der bemerkenswertesten Aspekte seiner außergewöhnlichen Persönlichkeit –, musste erst persönlich dafür zu sorgen, dass Wittenberg ein Druckgewerbe aufbaute, das der enormen Nachfrage nach seinen Werken gewachsen war.
Doch dazu kommen wir erst später. Nehmen wir uns zunächst die Zeit, uns mit der Stadt vertraut zu machen, die Luther gestaltete und die ihn hervorbrachte. Am besten lernt man sie in Luthers Gesellschaft kennen, denn er war ein umgänglicher Mensch, wenngleich vielleicht eher in späteren Jahren als Familienvater denn als ernster junger Professor, dem wir erstmals 1513 auf einem Gang durch Wittenberg begegnen.
Ein Spaziergang mit Luther
Luther hatte sich 1513 bereits seit zwei Jahren endgültig in Wittenberg niedergelassen. Unser Spaziergang mit ihm führt uns auf demselben Weg durch die Stadt, den Luther vier Jahre später nehmen sollte, um seine 95 Thesen an der Schlosskirche anzuschlagen – jenes Ereignis, das als Auslöser der Reformation gilt.
So besagt es zumindest die Überlieferung. Vor fünfzig Jahren behauptete ein boshafter katholischer Theologe, der Thesenanschlag sei ein Mythos, eine Fabel, die erst aufgekommen sei, nachdem Luther Berühmtheit erlangt habe.14 Es gab tatsächlich keine Zeitzeugen, zumindest keine, die den Vorgang wichtig genug fanden, um darüber zu berichten.15 Dieser unwillkommene Einwand löste, wenig überraschend, heftige Kontroversen aus. In einer Umfrage wählte das deutsche Publikum kürzlich diesen Thesenanschlag zum drittwichtigsten Ereignis der deutschen Geschichte, daher wäre der Gedanke, dass es ihn möglicherweise gar nicht gegeben hat, wirklich befremdlich. Persönlich tendiere ich zu der Ansicht, dass der Thesenanschlag stattgefunden hat, und werde zur Klärung dieser Frage Belege anführen, die einige Jahre, nachdem Iserloh seine Handgranate in die ruhigen Gewässer der Lutherforschung warf, aufgetaucht sind – dazu später mehr.16 Ablasskritik lag Luther 1513 noch fern, und er hatte eindeutig nicht die Absicht, die Kirche infrage zu stellen, in der er gerade eine vielversprechende Karriere machte.
Luther stand damals kurz vor seinem dreißigsten Geburtstag. Das erste zeitgenössische Gemälde zeigt ihn als schlanken, ernsten jungen Mann im Habit des Augustinerordens, dem er acht Jahre zuvor beigetreten war. Er lebte in einer bescheidenen Zelle im zweiten Stock des Augustinerklosters am Ostrand der Stadt. Von den gut dreißig Mönchen des Klosters studierten oder lehrten viele an der örtlichen Universität.17 Dort herrschte eine konzentrierte, hochgeistige Atmosphäre, die Luther zweifellos gefiel, denn auch er war ein ausgesprochen intellektueller Mensch. Er hatte 1512 promoviert und eine Professur erhalten, was ihm das wichtige Privileg eines beheizten Zimmers eingebracht hatte.
An diesem Morgen war Luther auf dem Weg in die Universität, die in der Schlosskirche am Westrand von Wittenberg untergebracht war – ein Fußweg von tausend Metern über die beiden Hauptstraßen, die parallel zum Nordufer der Elbe verlaufen und damals wie heute die Topografie der Stadt prägen. Wenn er zu seinen Pflichten eilte, dürfte ihn kaum etwas aufgehalten haben. Zu dieser Zeit war Luther den Wittenberger Bürgern kaum bekannt, denn erst ab 1514 begann er, regelmäßig in der einzigen Pfarrkirche der Stadt zu predigen. Sie stand etwas abseits der Hauptstraße, wo Wittenberg sich nach Norden ausbreitete. Dort wohnten die örtlichen Handwerker und Gewerbetreibenden, bescheidene Leute, die jedoch den Stadtrat dominierten. Denn im Gegensatz zu den großen Reichsstädten Augsburg, Nürnberg und Straßburg besaß Wittenberg keine Patrizierschicht international tätiger Kaufleute. Es war eine Kleinstadt, die eine begrenzte Nachfrage aus dem ländlichen Umland bediente. Das pulsierende Herz des Ortes war der Markt, den Luther nun rasch überquerte: wie überall ein Gewirr aus Markständen, lauten Marktschreiern, lebenden Tieren und ungeduldigen Kunden.
Gegenüber vom Marktplatz an einer Ecke der Straße, die zum Schloss führte, war eine Baustelle. Auf diesem riesigen Eckgrundstück, das bis an das Stadttor zur Elbe reichte, baute sich der Künstler Lucas Cranach, einer der bedeutendsten Bürger der Stadt, ein Wohnhaus. Cranach war einer von mehreren namhaften Künstlern, die man nach Wittenberg geholt hatte, um die glanzvollsten Bauprojekte der Stadt auszuschmücken: das Schloss und die Schlosskirche. Aber im Gegensatz zu Albrecht Dürer, Hans Burgmair und anderen war Cranach als Hofmaler des Kurfürsten in Wittenberg geblieben. Das war jedoch nur eines der zahlreichen Projekte dieses unternehmungslustigen, ehrgeizigen Mannes, der 1513 auf dem besten Weg war, Wittenbergs größter Arbeitgeber zu werden. Zu dieser Zeit dürften er und der junge Professor, der gerade an seinem Neubau vorbeiging, sich kaum gekannt haben. In den folgenden Jahren sollte ihre auf tiefer gegenseitiger Achtung und Freundschaft beruhende Partnerschaft jedoch die Reformation prägen.
Luther war nun noch fünf Gehminuten von seinem Ziel entfernt, der Schlosskirche, in der ein Großteil des Hochschulunterrichts stattfand. Vielleicht war er aber auch auf dem Weg in die Universitätsbibliothek, die seit kurzem im Schloss untergebracht war. Der erst 1509 fertiggestellte Neubau zeugte von der Entschlossenheit des Wittenberger Landesherrn Friedrich, sich eine Residenz zu errichten, die seiner Stellung als Kurfürst des Reiches gerecht wurde.
Abb. 2: Friedrich der Weise.
Er war Luthers Hauptbeschützer, obwohl die beiden nie miteinander gesprochen haben. Friedrichs unbeirrbare Loyalität zu seinem stürmischen Professor blieb selbst für Luther immer ein Rätsel.
Friedrichs leidenschaftliche Bautätigkeit lässt sich auf eine dynastische Krise im ausgehenden 15. Jahrhundert zurückführen. Der Besitz der Wettiner Herzöge von Sachsen war 1485 zwischen den Brüdern Ernst (Friedrichs Vater) und Albert geteilt worden. Nach sächsischer Sitte hatte der Ältere, Ernst, entschieden, wie das Gebiet aufgeteilt werden sollte, und der Jüngere, Albert, hatte sich seinen Anteil ausgesucht. Wenig überraschend hatte Albert die reichsten Regionen um Meißen gewählt, die auch Sachsens größte Stadt, Leipzig, umfassten. Ernst hatte einen langgestreckten Gebietsstreifen erhalten, der kein natürliches Zentrum besaß und als einzige größere Stadt Wittenberg aufwies. Allerdings bekam Ernst auch das wertvollste Gut, die Kurwürde, und gehörte damit zu den sieben erblichen Kurfürsten, die das Privileg besaßen, den König des Heiligen Römischen Reiches zu wählen. Als sein Sohn Friedrich 1486 die ernestinischen Besitzungen erbte, beschloss er, etwas daraus zu machen. Friedrich war sorgsam bedacht, an jedem größeren Reichstag des Heiligen Römischen Reiches teilzunehmen, und beschloss, Wittenberg zu einer würdigen Residenzstadt auszubauen.
So ließ er 1486 das alte Schloss abreißen und an seiner Stelle eine neue Residenz mit Kirche errichten. Erst zwanzig Jahre später war dieses ungeheuer kostspielige Projekt abgeschlossen, denn Friedrich wollte damit ein Zeichen setzen: Er strebte eine fürstliche Residenz im besten Renaissance-Stil an mit einer Kirche, in der seine umfangreiche und schnell wachsende Reliquiensammlung Platz finden sollte.
Die Kirche, in der Luther nun eintraf, war wohl recht überladen, denn neben einer Überfülle von Altären beherbergte sie auch die Universität und zahlreiche religiöse Ämter. Schon vor Friedrichs Neubau hatte die Stiftskirche Allerheiligen ein kostbares Privileg besessen, einen seltenen vollkommenen Ablass für alle, die am Allerheiligentag dort fromme Werke taten.18 Solche Ablässe versprachen den Erlass zeitlicher Sündenstrafen, die ansonsten den Eingang der Seele ins Paradies verzögert hätten, und erregten später Luthers Zorn, waren aber in den vorhergehenden Jahrhunderten äußerst populär bei den örtlichen Kirchen, denen sie eine Einnahmequelle boten, und bei den Gläubigen, die sie erwarben. Als die neue Schlosskirche 1503 von Kardinal Peraudi, dem umherreisenden päpstlichen Legaten, geweiht wurde, verlieh er der Kirche und ihren Besuchern großzügig neue Ablässe. Entgegenkommend drängte der Papst deutsche Kathedralen und Kirchen, Friedrich einige ihrer Reliquien für seine zunehmend beeindruckende Sammlung abzutreten. Solche Fragmente von den Knochen Heiliger und anderer Kultgegenstände waren ein weiterer wesentlicher Dreh- und Angelpunkt mittelalterlicher Frömmigkeit, und durch ihre Betrachtung konnten gläubige Pilger ebenfalls einen Ablass erlangen. Es gehört zu den seltsamen Aspekten der Reformation, dass Friedrich der Weise Luther hartnäckig vor den Folgen seiner Kritik an der mittelalterlichen Frömmigkeit bewahrte, zugleich aber seine Reliquiensammlung ständig vergrößerte. Bei der letzten Inventur 1520 umfasste sie 18 970 Einzelobjekte und gehörte zu den größten in Deutschland. Die kostbarsten Stücke wie eine Phiole mit Muttermilch der Jungfrau Maria und ein Zweig vom brennenden Dornbusch wurden in prachtvollen Behältnissen aus Gold und Silber aufbewahrt.19 Wenn die Sammlung für Pilger ausgestellt wurde, nahm sie dicht gedrängt acht Joche der Seitenschiffe in Anspruch. Vorlesungen dürfte es wohl am Allerheiligentag kaum gegeben haben, wenn Pilger in Scharen in die Schlosskirche strömten, um sich den Ablass von 1,9 Millionen Tagen zu sichern, den eifrige Wallfahrer erlangen konnten, wenn sie sämtliche Reliquien betrachteten. Ab 1509 beschrieb ein Katalog mit 124 Holzschnitten von Lucas Cranach diese Schätze.20
Abb. 3: Wittemberger Heiligtumsbuch mit Illustrationen von Lucas Cranach.
Nach Erscheinen dieses Katalogs 1509 wuchs die damals bereits umfangreiche Reliquiensammlung Friedrichs des Weisen noch beträchtlich, selbst als Luthers Proteste gegen Ablässe und Heiligenkult eine Bewegung auslösten.
Selbst wenn die Reliquien nicht ausgestellt waren, herrschte in der Schlosskirche reger Betrieb. Aus den Rechnungsbüchern geht hervor, dass allein 1517 an den verschiedenen Altären 9000 Messen gelesen und 40 000 Kerzen für Verstorbene angezündet wurden.21 Das war ein gutes Geschäft, und hätte Luther auf dem Heimweg einen Abstecher in die Pfarrkirche der Stadt gemacht, so hätte er dort ganz ähnliche Verhältnisse vorgefunden. Denn so bescheiden ihre Häuser auch sein mochten und so verächtlich durchreisende Geistesgrößen auch die Nase über sie rümpfen mochten, waren Wittenbergs Bürger doch nicht bereit, den Kurfürsten in allem beliebig schalten und walten zu lassen. Im Laufe vieler Jahre hatte der Stadtrat hartnäckig seine Rechte über das Umland bekräftigt. Mit Verhandlungen und Schmeicheleien hatte Wittenberg das Auf und Ab herzöglicher Macht genutzt, um wichtige Privilegien wie das Münzrecht und die Gerichtsbarkeit zu erwerben. Die Handwerkszünfte hatten Geld in ihre eigenen Institutionen investiert, nicht zuletzt in die religiösen Laienbruderschaften, die Messen für die Seelen Verstorbener lesen ließen. So war auch Wittenbergs Pfarrkirche voller Seitenaltäre und Kapellen und beschäftigte eine kleine Schar von Priestern, die ständig für die Seelen Verstorbener beteten.
Das war also Luthers Welt 1513: eine Stadt mit 384 Häusern, fernab von den Hauptzentren des kulturellen und vornehmen urbanen Lebens in Deutschland, Flandern und Italien. Ihre 1502 gegründete Universität gehörte kaum zu den strahlendsten Lichtern an Europas Geisteshimmel wie die altehrwürdigen mittelalterlichen Hochschulen von Paris, Bologna, Löwen oder Köln. Es war die kleinste Stadt, in der Luther je gelebt hatte, und er konnte den Eindruck nie ganz abschütteln, dass sie im Grunde provinziell war. Aber sowohl Wittenberg als auch die Universität profitierten vom patriotischen Stolz des Kurfürsten und hatten ein ausgeprägtes Selbstbewusstsein. Der Ort war nicht von Spannungen zwischen Patriziern und Handwerkern zerrissen, die in vielen Städten Deutschlands die Reformation erschweren sollten. Manchmal mochte Luther sich zwar nach einem höheren großstädtischen Niveau sehnen, aber tatsächlich bot Wittenberg eine überaus günstige Umgebung für seine Jahre der intellektuellen Suche. Als sein Fall berühmt-berüchtigt wurde, hielten die Bürger und ihre Herren mit unbeirrbarer Loyalität zu ihm.
Die Bildungsbranche
Ohne die Unterstützung, die Luther in Wittenberg erhielt, hätte er keine Reformation betreiben – und nicht einmal überleben – können: Unterstützung von seinem Kurfürsten Friedrich dem Weisen, der ihn entschieden schützte, von seinen Kollegen an der Universität und von den Bürgern, die ab 1514 als Erste die außergewöhnliche Wirkmacht seiner Predigten zu würdigen wussten. Diese Loyalität sollte im Laufe von Luthers Leben reich belohnt werden. Als er zum berühmtesten Mann Deutschlands aufstieg, wurde Wittenberg zum Anziehungspunkt für Menschen aus dem ganzen Land und darüber hinaus, die in ihm ihren geistigen Führer und Beschützer sahen. Tausende kauften seine veröffentlichten Schriften. Als Luther 1546 starb, hatte Wittenberg sich grundlegend verändert.
Das Ausmaß dieses Wandels wird deutlich, wenn wir Luther ein weiteres Mal bei einem Gang durch die Stadt begleiten, die er mittlerweile – vielleicht widerstrebend – als seine Heimat ansah. Im Jahr 1543 wohnte Luther nach wie vor im Augustinerkloster. Dort lebten aber inzwischen keine Mönche mehr: Nach dem päpstlichen Bann über Luther hatte man sie abgezogen, Opfer einer neuen Theologie, welche die Existenz eines Fegefeuers leugnete und damit dem klösterlichen Leben des Gebets die spirituellen Grundlagen raubte. Gierig rissen die deutschen Stadtväter und Landesfürsten den klösterlichen Besitz an sich, der zuvor die Landschaften und Stadtbilder Europas beherrscht hatte. In Wittenberg übergab ein gnädiger Kurfürst das ganze Klostergebäude seinem berühmtesten Bewohner. Bis heute beherbergt das Lutherhaus das prachtvolle Museum, das seinem Leben und seiner Reformationsbewegung gewidmet ist.
Einige Jahre wohnte Luther dort allein, aber 1543 war das Haus wieder voller Leben. Da Luther nicht mehr durch sein Ordensgelübde gebunden war, hatte er 1525 geheiratet. Diese Eheschließung zwischen dem ehemaligen Mönch und der ehemaligen Nonne Katharina hatte die Christenheit schockiert und die schlimmsten Befürchtungen seiner wachsenden Kritikerschar bestätigt. War die Einheit der westlichen Kirche der Lust eines einzigen Mannes geopfert worden? Aber diese skandalträchtige Verbindung brachte Luther großes persönliches Glück. Und als Kinder kamen, fand Luther in seiner Rolle als Familienvater Zufriedenheit und neue spirituelle Erkenntnisse. Katharina erwies sich zudem als geschickte Wirtschafterin und führte einen Haushalt, in dem zahlreiche Studenten und Gäste logierten. Die Privilegierteren saßen mit Luther an einem Tisch und sogen seine Äußerungen begierig auf.
Wenn Luther 1543 durch die Stadt ging, kam er wahrscheinlich nicht so schnell voran wie der schlanke, zielstrebige Mönch 1513, von dem nur noch eine blasse Erinnerung übrig war: Luthers Figur zeugte von jahrelanger sitzender Tätigkeit und herzhaftem Essen (Katharina bewirtschaftete sehr erfolgreich einen Gemüsegarten und eine eigene Brauerei). Zudem war Wittenberg mittlerweile voller Studenten und Professoren. So konnte Luther wahrscheinlich kaum ein paar Schritte tun, ohne dass ihn jemand grüßte. Nur wenige Meter weiter an der Collegienstraße wohnte sein Freund Philipp Melanchthon. Luther zählte es zu seinen größten Leistungen, ihn nach Wittenberg geholt zu haben. Jahrelang hatte er befürchtet, dass eine andere Universität ihn abwerben könnte, und als der Sturm über den Ablasshandel ausgebrochen war, hatte er sich bittere Vorwürfe gemacht, dass seine Unbesonnenheit den konfliktscheuen Melanchthon zum Wechsel nach Leipzig, zum verhassten regionalen Rivalen, verleiten könnte. Aber Melanchthon hatte sich als treuer Freund und brillanter Lehrer erwiesen. Diese Partnerschaft gegensätzlicher Charaktere war das Fundament, auf dem die Reformationskirchen aufbauen sollten.
Die Collegienstraße führte Luther auf den Marktplatz, wo der Wandel Wittenbergs am deutlichsten ersichtlich war. Am Südostende des Platzes kam er am stattlichen Gasthaus »Zum Adler« vorbei; seit 1524 stiegen dort zahlreiche Kaufleute und vornehme Gäste ab, für die Wittenberg mittlerweile ein wichtiges Reiseziel war.22 Die Werkstätten von Lucas Cranach, ein riesiger Gebäudekomplex mit 84 Räumen an der Südwestecke des Marktes, waren inzwischen fertiggestellt. Am Markt 4 stand ein weiteres Cranach-Haus, ein prachtvoller viergeschossiger Renaissancebau.
Auf dem Markt herrschte geschäftiges Treiben. An der gegenüberliegenden Seite des Platzes prangte das neue Rathaus. Den recht bescheidenen Vorgängerbau, den Luther aus seinen ersten Jahren in Wittenberg kannte, hatte man 1521 abgerissen und durch einen größeren Neubau ersetzt, in den die Stadt die ersten Früchte ihres neu erworbenen Wohlstands investiert hatte. In gewisser Hinsicht hatten die Stadtväter damit voreilig gehandelt, noch bevor sich das ganze Ausmaß des wirtschaftlichen Aufschwungs abgezeichnet hatte. Und so musste das neue Rathaus nach nicht einmal fünfzig Jahren 1573 dem selbstbewussteren Monumentalbau weichen, der Wittenbergs Hauptplatz bis heute beherrscht. Auf der imposanten Freifläche drängten sich 1543 die Markstände und eine Reihe fester Buden, die man zwischen Rathaus und Stadtkirche errichtet hatte.
Denn 1543 war Wittenberg voller Menschen, ja, sogar völlig überlaufen. Der Zustrom von Händlern, Kaufleuten und vor allem Studenten war so groß, dass die Stadt ihn kaum verkraften konnte. In manchen Jahren bestand die Bevölkerung zu einem Drittel, wenn nicht gar zur Hälfte aus Studenten.23 Die Folge war ein beträchtlicher Preisanstieg bei Lebensmitteln, Kleidung und Unterkünften. Immobilienbesitzer bauten ihre Häuser um oder stockten sie auf, um die Wohnraumnachfrage zu befriedigen. Die Freiflächen innerhalb der Stadtmauern waren inzwischen weitgehend bebaut, und Fachwerkhäuser waren Neubauten aus Stein gewichen. Wittenberg stellte seinen neuen Wohlstand wie die meisten Städte gern zur Schau.
Höchstwahrscheinlich flüchtete Luther sich nur allzu gern aus dem Trubel auf dem Markt in die nahe Stadtkirche, die nun statt der Schlosskirche seine geistige Heimat war. Hier hatte er 1514 begonnen, mit Predigten von mitreißender Leidenschaft und Kraft Wittenbergs Bürger in seinen Bann zu schlagen. Die Predigtpflichten teilte er sich 1543 jedoch mit seinem engen Freund Johannes Bugenhagen.
Für Wittenbergs ältere Bürger war die Kirche im Vergleich zu ihrem Erscheinungsbild dreißig Jahre zuvor wahrscheinlich nicht wiederzuerkennen. Besonders im Inneren waren die Auswirkungen von Luthers Reformation nicht zu übersehen. Die zahlreichen Seitenaltäre, an denen unzählige Priester die Messe zelebrierten, und das ständige Murmeln von Gebeten waren verschwunden. Stattdessen konzentrierte sich die gesamte spirituelle Energie auf den Hauptgottesdienst. In der veränderten Kircheneinrichtung spiegelte sich die neue Form des Gemeindegottesdienstes wider, in dessen Zentrum Gebete, Bibellesungen, Kirchenlieder und Predigten standen. Da Wittenberg nur eine Pfarrkirche besaß – was für eine Stadt dieser Größe ungewöhnlich war –, kam beim Sonntagsgottesdienst die gesamte Gemeinde zusammen. Hier hörte sie Luther in seinen dreißig Jahren als Pfarrer bis zu viertausend Mal predigen. Ein Privileg, für das manche Bewunderer meilenweit anreisten, gehörte für Wittenbergs Bürger zur Alltagserfahrung. Nicht zuletzt daraus erklärt sich Luthers bemerkenswerter Einfluss in seiner eigenen Gemeinde.
Luthers Rolle als Gemeindeprediger stellte die Bedeutung der Schlosskirche in gewissem Maße in den Schatten, besonders wenn der Kurfürst nicht in der Stadt war. Friedrich der Weise, der bis zum Schluss hartnäckig an seinem traditionellen katholischen Glauben und zugleich an seinem berühmten Professor festgehalten hatte, war 1525 gestorben. Aber unter Luthers Einfluss hatte er seine wunderbare Reliquiensammlung in aller Stille beiseitegeschafft. Ab 1522 wurde sie nicht mehr ausgestellt, und Pilger mussten ihr Heilsversprechen anderswo suchen. Friedrichs Nachfolger, sein Bruder Johann (Kurfürst von 1525 bis 1532) und sein Neffe Johann Friedrich (Kurfürst von 1532 bis 1547), unterstützten Luther, wenn möglich, noch entschlossener; darin hatte er tatsächlich Glück. Wenn Luther um 1543 auf Reisen ging, tat er es gewöhnlich im Dienste der Kurfürstenfamilie oder um in ihren anderen Residenzen für sie zu predigen.
Von der Stadtkirche ging Luther wahrscheinlich nicht zum Schloss, sondern eher nach rechts, fort vom Fluss in den Norden der Stadt. Dort hatten sich die meisten Drucker Wittenbergs niedergelassen. Luther interessierte sich sehr für die Veröffentlichung seiner Bücher, und nirgendwo zeigten sich die Umwälzungen der Stadt drastischer als in der Vielzahl der Drucker, Buchbinder und Buchhändler in den Werkstätten und Läden dieses geschäftigen Viertels.
Bei unserem ersten Stadtrundgang mit Luther 1513 hätte er bis zu Wittenbergs Drucker nicht weit gehen müssen, denn die Universitätsdruckerei lag in unmittelbarer Nachbarschaft zum Augustinerkloster. Damals verfügte sie über die einzige Druckerpresse des Ortes und veröffentlichte 1513 nur zehn Werke, alle auf Latein und alle für die Studenten und Professoren der Hochschule: Vorlesungen, Lehrbücher und Ähnliches.24 Auch wenn der Drucker Johannes Rhau-Grunenberg für seine Langsamkeit berüchtigt war, dürften die erhalten gebliebenen Bücher seine Druckerpresse kaum länger als einen kleinen Teil des Jahres in Betrieb gehalten haben.25 Dagegen unterhielt Wittenberg 1543 sechs Druckereien, die gut zu tun hatten und insgesamt 83 Bücher herausbrachten, die Hälfte auf Deutsch, die andere auf Latein. Die meisten waren für den Export bestimmt. Rechnet man die zahlreichen zusätzlichen Arbeitskräfte hinzu – Großhändler, Buchbinder, Fuhrleute und Kaufleute, die für die komplexen Finanztransaktionen im Fernhandel zuständig waren –, so bildeten Buchdruck und Verlagswesen sicher einen der größten Wirtschaftszweige dieser florierenden Stadt. Seine erfolgreichsten Vertreter wie der Verleger Moritz Goltz gehörten zu den reichsten Bürgern Wittenbergs.26
Die nackten Zahlen spiegeln diese Umwälzung zwar nur unvollständig wider, sind aber durchaus beeindruckend. Zwischen 1502 und 1516 veröffentlichten fünf aufeinanderfolgende Drucker in Wittenberg insgesamt 123 Bücher, durchschnittlich also acht pro Jahr.27 Dabei handelte es sich um lateinische Werke von meist geringem Umfang. Offensichtlich konnte keiner der Drucker damit sonderlich gut seinen Lebensunterhalt bestreiten. Diese Branche bewegte sich also am Rande der Lebensfähigkeit und konnte sich wahrscheinlich nur durch direkte Zuwendungen vom Kurfürsten und der Universität halten.28 Dagegen erschienen in Wittenberg von 1517 bis 1546 mindestens 2721 Werke, also durchschnittlich 90 pro Jahr.29 Das entsprach insgesamt etwa drei Millionen Buchexemplaren, darunter zahlreiche bahnbrechende Werke der damaligen Zeit, nicht zuletzt diverse Auflagen von Luthers deutscher Bibelübersetzung.
Dieser enorme Aufschwung einer im Grunde neuen Branche war durchweg Martin Luther zu verdanken. Jedes dritte in diesen drei Jahrzehnten veröffentlichte Buch war ein Werk von ihm, und weitere zwanzig Prozent stammten von seinen Wittenberger Kollegen und Anhängern.30 Selbst 1543, als die leidenschaftlichen Auseinandersetzungen der ersten Jahre nur noch eine blasse Erinnerung waren, stammte die Hälfte der veröffentlichten Bücher von Luther oder von Philipp Melanchthon. Und der Luther-Effekt erwies sich als dauerhaft. Selbst nach seinem Tod wuchs die Branche weiter, brachte 1563 ganze 163 Neuerscheinungen heraus und erreichte im letzten Jahrzehnt des Jahrhunderts jährlich 200 Neuerscheinungen. Mittlerweile war Wittenberg Deutschlands größtes Druck- und Verlagszentrum, stellte etablierte Buchdruckzentren wie Straßburg und Köln in den Schatten und übertraf sogar die Schwergewichte Augsburg und Nürnberg.31
Dank des Lieblingssohnes der Stadt hatte Wittenberg die ehernen Wirtschaftsregeln der Buchbranche unterlaufen, nämlich die scheinbare Notwendigkeit, dass große Buchdruckzentren nur in Europas wichtigsten Handelsstädten angesiedelt sein konnten. Über diesen Wandel wunderten sich viele Zeitgenossen, unter anderem auch Luther selbst, der seine außergewöhnliche Popularität als Autor nie ganz begreifen konnte. Natürlich rechnete er das Verdienst einem wohlwollenden Gott und dessen unmittelbarem Eingreifen an: Der Buchdruck war seiner Ansicht nach ein Geschenk des Himmels, um Gottes Wort zu verbreiten und Irrglauben zu beseitigen. Tatsächlich war Wittenbergs Aufstieg zu einem Buchdruckgiganten alles andere als vorherbestimmt. Noch über mehrere Jahre, nachdem Luthers kühne Herausforderung erste Schockwellen durch Deutschland gesandt hatte, erschienen seine Werke überwiegend in anderen Orten. Wittenbergs Buchdrucker – besonders der zunächst einzige Drucker der Stadt, Rhau-Grunenberg – waren offenkundig überfordert von der erstaunlichen Nachfrage nach den Werken ihres örtlichen Propheten. Es dauerte einige Jahre und erforderte das unmittelbare Eingreifen Luthers, bis sich ein Gewerbezweig aufbauen ließ, der die Veröffentlichung seiner Werke in seiner Heimatstadt gewährleisten konnte. Im Laufe dieses Prozesses entwickelten die Neuankömmlinge gemeinsam mit Luther die charakteristische Buchgestaltung, die das Lutherbild in der Welt für immer prägen und die Leserschaft der Buchbranche radikal verändern sollte.
Diese Umwälzungen, die im Wesentlichen das Thema des vorliegenden Buches sind, betrafen eigentlich drei Bereiche: Luthers Wandel vom ernsten Mönch zum Bestsellerautor; die Veränderung des Druckgewerbes, das sich durch das Aufkommen eines Massenmarktes von seinen Wurzeln in einer gelehrten, lateinischen Bücherwelt löste; und den Wandel Wittenbergs, das Luther nachhaltig prägte. Dem schlagartigen Anschub der örtlichen Wirtschaft folgte eine Welle kleinerer Veränderungen, als die wachsende Nachfrage nach einer neuartigen Literatur auch andere deutsche Städte erfasste.
Martin Luther war ein Theologe von großem Scharfblick, ein charismatischer Anführer und Prediger, ein leidenschaftlicher und talentierter Schriftsteller. Zugleich war er zweifellos auch die Haupttriebkraft der Wittenberger Wirtschaft. Nichts anderes hätte diese abgelegene Kleinstadt zur Hauptstadt des Buchdrucks in Gutenbergs Heimat machen können – wie es ihr ab 1517 für etwa achtzig Jahre bestimmt war. Diese beiden Geschichten – die spirituelle und theologische einerseits und die wirtschaftliche und kommerzielle andererseits – gilt es zu verknüpfen, um die außerordentliche Schlagkraft der Reformation zu begreifen. In dieser Hinsicht ist Wittenberg, die kleine Grenzstadt am Rande der Zivilisation, gemeinsam mit Luther dafür verantwortlich, eine der großen umwälzenden Bewegungen des letzten Jahrtausends entfacht zu haben.
KAPITEL 2
Die Geburt eines Revolutionärs
Martin Luthers erste Jahre in Wittenberg waren eine Zeit der Entdeckungen und Erkundungen. Seine spätere Berühmtheit war in keiner Weise abzusehen. Falls wir dafür einen Beleg brauchen, finden wir ihn in einem bemerkenswerten Dokument eines anonymen humanistischen Autors von 1515: eine Liste mit Kurzbiografien von 101 Professoren an den Universitäten Leipzig, Wittenberg und Frankfurt an der Oder.1 Keine dieser Einrichtungen gehörte zu den europäischen Spitzenhochschulen. In Leipzig gab es zwar schon seit dem Mittelalter eine Universität, aber in Wittenberg und Frankfurt an der Oder erst seit zwanzig Jahren. Diese eigentlich nie veröffentlichte Liste war vermutlich im Rahmen von Bemühungen entstanden, Studenten für die drei Universitäten in Nordostdeutschland anzuwerben. Doch selbst unter diesen relativ unbedeutenden Geistesgrößen rangierte der Wittenberger Professor für Bibelauslegung Martin Luther nicht unter den ersten hundert.
Der Grund ist unschwer auszumachen: Luther war zwar 1515 bereits im Lehrkörper der Wittenberger Universität fest etabliert, hatte aber noch nichts veröffentlicht. Seine ersten zögernden Schritte in dieser Richtung unternahm er erst 1516, ein Jahr vor der Ablass-Kontroverse. Dennoch wurde Luther innerhalb von vier Jahren zum berühmtesten Mann Deutschlands, verehrt oder angefeindet wegen der gewagten, aufsässigen Äußerungen, mit denen er seine Kirche in Aufruhr und das Heilige Römische Reich in eine Verfassungskrise stürzte.
Die Geschwindigkeit und schiere Unwahrscheinlichkeit dieser Umwälzungen stellten Historiker durchgängig vor Herausforderungen, seit Luthers Anhänger anfingen, Interpretationen seines außergewöhnlichen Lebens anzubieten. Insbesondere Luthers frühe Jahre, seine intellektuelle Prägung und die Entstehung seiner revolutionären Theologie sind schwer zu erforschen. Luthers halbherziges Versprechen, eine autobiografische Einführung zur geplanten Gesamtausgabe seiner Werke zu schreiben, fiel anderen Verpflichtungen und seiner nachlassenden Gesundheit zum Opfer.2 Die Freunde, die mit ihm am Tisch saßen, konzentrierten sich stärker darauf, seinen ständigen Redefluss aufzuzeichnen, als bohrende Fragen nach seiner Erziehung zu stellen. Eine der ersten zeitgenössischen Biografien verfasste ein verbissener Gegner, Johannes Cochläus, der natürlich wenig Verständnis für Luthers Abkehr von seinem Ordensgelübde und seiner früheren Konfession aufbrachte.3 Zumindest war es das Werk eines Gelehrten, auch wenn es nicht unbedingt für den Autor spricht, dass er eine Fabel aufgriff, die Luthers Geburt auf die Vereinigung seiner Mutter mit dem Teufel in einem Badehaus zurückführte.
Die bekannten Fakten zu Luthers Kindheit und Jugend liefern in Wirklichkeit kaum Hinweise auf seine spätere aufrührerische Wirkung auf die deutsche Gesellschaft. Die ersten dreißig Jahre seines Lebens verliefen erstaunlich konventionell: Der Spross einer liebevollen, recht wohlhabenden Familie strebte eine gesicherte, aber relativ bescheidene Karriere an. Nachdem Luther sich zu einer Kirchenlaufbahn entschlossen hatte, engagierte er sich entschieden in Institutionen, die ihm gute Gelegenheit boten, seine Talente als Lehrer – allerdings, wie bereits gesagt, noch nicht als Autor – unter Beweis zu stellen. Aus den erstaunlich fragmentarischen Einzelheiten über Luthers Kindheit und Jugend lässt sich der außergewöhnliche Ausbruch leidenschaftlicher kreativer Energie in den Jahren nach 1515 kaum erklären. Möglicherweise sind darin jedoch schon die Bausteine zu erkennen, auf denen Luthers Weltsicht beruhte und die ihn in der Zeit trugen, als er am angreifbarsten war: die tiefe Verwurzelung in der Gelehrsamkeit seiner Zeit; das Netzwerk von Freunden und Förderern, die in ihm ein außergewöhnliches Talent erkannten und bereit waren, im Wirbel der Kontroversen und Konfrontationen zu ihm zu stehen; und vor allem seine Universität.
Luther war keineswegs auf Anhieb angetan von Wittenberg. Von seinem ersten Lehrauftrag an der neuen Hochschule kehrte er nach einem Jahr ohne sonderliches Bedauern nach Erfurt zurück. Als er 1511 auf Drängen seines Freundes und Förderers Johann von Staupitz endgültig nach Wittenberg versetzt wurde, hätte er es leicht als unfreiwillige Verbannung aus der kultivierteren Gesellschaft von Erfurt empfinden können. Aber in den folgenden Jahren engagierte Luther sich von ganzem Herzen für die Universität und ihr Ethos. Hier entfaltete sich sein unerwartetes Genie als kreativer Denker. Hier trug er im Dienste der Universität seine ersten Kontroversen aus und begann, Anhänger zu finden. In seinem Einsatz für die Universität Wittenberg entwickelte Luther sich zu einer Führungspersönlichkeit und stellte erstmals die zeitgenössischen theologischen Lehren infrage.
Der junge Luther
Martin Luther wurde nahezu mit Sicherheit im November 1483 in der Kleinstadt Eisleben geboren.4 Obwohl Luther durch einen seltsamen Zufall dort auch sterben sollte, spielte Eisleben in seinem persönlichen Werdegang nur eine untergeordnete Rolle, da seine Familie schon kurz nach seiner Geburt wegzog. Luther kam aus relativ wohlhabendem Haus: Sein Vater Hans stammte aus einer freien Bauernfamilie aus Möhra (heute Moorgrund) bei Eisenach in Thüringen. Die Familie seiner Frau, Margarethe Lindemann, war erst kürzlich aus dem hundert Kilometer entfernten bayerischen Bad Neustadt nach Eisenach gezogen. Die Lindemanns standen mit Hans auf so gutem Fuß, dass sie ihm Kapital für seine geschäftlichen Vorhaben liehen.
Abb. 4: Luthers Welt.
Um die Zeit von Martins Geburt bereitete Hans sich gerade auf ein ehrgeiziges, aber potenziell riskantes Unternehmen vor.5 Er zog 1484 mit seiner jungen Familie nach Mansfeld im Harzvorland, wo er sich im Bergbau versuchen wollte. Damals besaß die Grafschaft Mansfeld einige der reichsten Kupfervorkommen Europas. In einem dicken Flöz zog sich das Kupfererz durch die Berge und lag manchmal dicht unter der Oberfläche, manchmal Hunderte Meter unter Tage. Die Förderung und Verhüttung dieses kostbaren Metalls erforderte Können und beträchtliche Investitionen. Damals engagierten sich einige der bedeutendsten deutschen Bankiers- und Kaufmannsfamilien in den sächsischen und thüringischen Bergwerken. Da Hans Luter (wie der Familienname sich vorerst schrieb) über solches Kapital nicht verfügte, musste er für seine Unternehmensgründung hohe Kredite aufnehmen.
Der Kupferbergbau war ein lukratives, aber heikles Gewerbe. Ein Kupferflöz konnte unerreichbar tief fallen, eine Grube einstürzen oder geflutet werden. Es war ein hartes, gefährliches Leben, das selbst von jenen, die über Tage blieben wie Hans, starke Nerven verlangte. Da er die Bergrechte nicht besaß, sondern pachtete, konnte er seine Bergwerke und Hütten nur mit immer neuen Krediten betreiben.6 Zeit seines Lebens blieb die Familie hoch verschuldet, und erst 1529, ein Jahr vor seinem Tod, konnte Hans schließlich die letzten Darlehen tilgen. Trotz florierender Geschäfte – Hans wurde in den Stadtrat von Mansfeld gewählt und die Familie lebte gut – war ihr Wohlstand anfällig. Daher dürfte der junge Luther sowohl die großen Gewinne kennengelernt haben, die in der Wirtschaft zu erzielen waren, als auch deren Unsicherheit.
Abb. 5: Luthers Eltern.
Die Porträts, die Lucas Cranach von Luthers alten Eltern malte, lassen die Spuren eines langen, harten Lebens im Bergbau erkennen. Trotz seiner strengen Erziehung wuchs Martin in einem liebevollen Elternhaus auf, das er auch immer als solches in Erinnerung behielt.
Welche Bedeutung dieser ungewöhnliche Hintergrund in einer Zeit hatte, als nur ein sehr kleiner Teil der europäischen Bevölkerung in Grundstoffindustrien wie dem Bergbau tätig war, wird in Studien zu Luthers geistigem Werdegang nicht immer gewürdigt. Im späteren Leben erinnerte Martin sich, dass seine Eltern streng waren und ihren Kindern den Wert des Geldes vermittelten. Aber Versuche, die entscheidenden Wendepunkte in Luthers Leben als Reaktion auf einen kalten, distanzierten Vater oder eine solche Mutter zu interpretieren, besagen mehr über die Zeit, in der sie geschrieben wurden (von Ende der 1950er bis in die 1970er Jahre), als über Luther.7 Martin war sich darüber im Klaren, dass er aus einer warmherzigen Familie kam; er achtete seine Eltern und war selbst ein hingebungsvoller, liebevoller Vater. Aber in einer Zeit, in der die Industrieproduktion noch in den Kinderschuhen steckte, hatten wohl nur wenige Akademiker aus erster Hand die besonderen Lebensverhältnisse in einem Haushalt erlebt, der von der Gewinnung von Edelmetallen abhing. Diese Erfahrung sollte Luther sehr zustattenkommen, als er sich in der Mitte seines Lebens für eine andere aufkommende Branche interessierte, die starke Nerven und hohe Investitionen erforderte. Wenn Luther eine Druckerei betrat, kam er nicht als naiver Akademiker, für den der kreative Prozess mit der Fertigstellung seines Manuskripts endete, sondern als praktisch veranlagter Mann, der genau über die harten wirtschaftlichen Regeln von Gewinn und Verlust sowie über die Zwänge und Gefahren eines auf Kredit betriebenen Geschäfts Bescheid wusste. Das sollte sich aus Sicht der Reformation als nützliche Lektion erweisen.