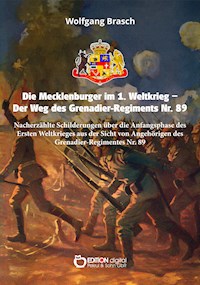
10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: EDITION digital
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Der 1915 veröffentlichte Aufsatz „Beim Grenadier-Regiment Nr. 89“ des Schweriner Volksschullehrers und Unteroffiziers der Reserve Wilhelm Evermann dient diesem Buch als Grundlage für die Beschreibung des Weges des Grenadier-Regiments Nr. 89 am Anfang des Ersten Weltkrieges. Der Weg der Mecklenburger von der Mobilmachung am 1. August 1914 bis zum Scheitern der Blitzkriegs-Option Anfang September 1914 an der Marne wird detailliert mit umfangreichem Kartenmaterial und den namentlichen Verlustlisten beschrieben. Der Autor schildert dabei sehr genau, welche Verantwortlichkeiten bei Beginn des Ersten Weltkrieges übertragen und übernommen wurden, bis hin zu den ganz persönlichen Entscheidungen. Dies bewusst auch zum Unterschied zu Darstellungen von anonymen Massen mit anonymen Gegnern. Am Wendepunkt eines scheinbar unaufhaltsamen Vormarsches trifft das Schweriner Grenadier-Regiment Nr. 89 auf das französische 73. Infanterie-Regiment aus Béthune. Aus der Gegend von Calais kommend, einer Stadt so groß wie das damalige Schwerin, liefern sich die beiden Truppenteile am 6. September 1914 ein blutiges, stundenlanges Gefecht bei Esternay. Eine erstaunliche militärhistorische Geschichte mit regionalem Bezug und darüber hinaus, die weitestgehend in Vergessenheit geraten ist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 166
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Einleitung
Der Krieg beginnt
Die Bildung der Angriffsgruppierung
Grenzüberschreitung
Der Sturm auf Lüttich beginnt
Der Angriff der 34. Brigade
Verlauf beim Füsilier-Regiment Nr. 90
Angriff des Grenadier-Regimentes
Reste der 34. Infanterie-Brigade ziehen sich zurück
Die Entscheidung
In belgischer Gefangenschaft
Sicherung des Erfolgs
Das Besatzungsregime wird eingerichtet
Die 34. Infanterie-Brigade ordnet sich
Die Einschließung Lüttichs
Die strategische Entfaltung der deutschen Armeen
Marsch an die französische Grenze
An Brüssel vorbei ohne Gefecht
23. August: Gefecht bei Villers St. Ghislain
Teilnahme an der Schlacht bei St. Quentin
Die 17. Division bei der 2. Armee
Marsch auf Paris
Die Schlacht an der Marne
Das Gefecht bei Corrobert
Der weitere Vormarsch stockt
Der Blitzkrieg ist gescheitert
Schwere Gefechte bei Esternay
Der Sanitätsdienst im Gefecht bei Esternay
Das französische 73. Infanterie-Regiment
Das 73. Infanterie-Regiment bei Kriegsbeginn
Die erste Aufgabe des 73. Infanterie-Regiments
Dinant
Der Rückzug
Esternay
Schlusspunkt
Marschtabelle des Grenadier-Regimentes Nr. 89
Offiziere beim Grenadier-Regiment Nr. 89 zu Beginn des Jahres 1914
Erläuterungen und Erklärungen
Deutsches Reich -Politische Gliederung
Das Deutsche Reich umfasst neben dem Reichsland Erläuterungen und Erklärungen
Deutsches Reich -Politische Gliederung
Übersicht deutsche Armeekorps und Divisionen (vor der Mobilmachung 1914)
Übersicht Angriffsgruppierung auf Lüttich 4. August 1914
Übersicht Belgische Armee (August 1914)
Übersicht französische Armeekorps und Divisionen (Hauptkräfte Plan XVII 1914)
Übersicht Britische Expeditionskräfte (BEF – British Expeditionary Forces)
Zuordnung deutscher Armee-Korps der Westfront zu den Armeen
Dienstgrade beim kaiserlichen Heer (Deutsches Reich)
Ultimatum des Deutschen Reiches an das Königreich Belgien, vom 2. August 1914
Personenverzeichnis (Auswahl)
Abbildungsverzeichnis
Quellenverzeichnis
Wolfgang Brasch
Impressum
Wolfgang Brasch
Die Mecklenburger im 1. Weltkrieg – Der Weg des Grenadier-Regiments Nr. 89
Nacherzählte Schilderungen über die Anfangsphase des Ersten Weltkrieges aus der Sicht von Angehörigen des Grenadier-Regimentes Nr. 89
ISBN 978-3-96521-130-8 (E–Book)
ISBN 978-3-96521-129-2 (Buch)
Gestaltung des Titelbildes: Ernst Franta
© 2019 EDITION digital
Pekrul & Sohn GbR
Godern
Alte Dorfstraße 2 b
19065 Pinnow
Tel.: 03860 505788
E–Mail: verlag@edition–digital.de
Internet: http://www.edition-digital.de
Einleitung
Abbildung 1: Das Großherzoglich-Mecklenburgische Wappen – Teil der Truppenfahne
Die Werderkaserne steht bereits viele Jahrzehnte an der Straße nach Güstrow in Schwerins Werdervorstadt, die vom historischen Zentrum der Stadt nach Nordosten herausführt.
Als ich 1983 in diese Kaserne als junger Leutnant versetzt wurde, um dort meine erste Offiziersdienststellung anzutreten, stand die Kaserne bereits über 80 Jahre. Mich hatte immer schon interessiert, was es auf sich hat mit diesem Gemäuer. Zum 90. Jahrestag des Endes des Ersten Weltkrieges eröffneten sich mir einige Zugänge, um Informationen und einiges Wissen über die Werder-Kaserne und dem damals dort zuerst stationierten Großherzoglich-Mecklenburgischen Grenadier-Regiment Nr. 89 zu bekommen. Inzwischen sind die Hundertjahres-Erinnerungsfeiern nach Ende des Ersten Weltkriegs vorbei.
Der Begriff Grenadiere leitet sich tatsächlich von Granate ab. Infanteristen in früherer Zeit, die mit Vorläufern der heutigen Handgranate ausgerüstet wurden, waren die Grenadiere.
Die vorliegende Schrift beruht im Kern auf der Heftreihe „Mecklenburgs Söhne im Weltkrieg“ und lehnt sich sehr stark an diese an. Die Schilderungen, die dort abgedruckt und überliefert sind, sollen die Frage beantworten helfen, wer damals zu Beginn des Ersten Weltkriegs von dort, aus der Werderstraße in Schwerin, seinen noch unbekannten Weg angetreten hat. Welchen Weg sind die mecklenburgischen Soldaten zu Beginn des Ersten Weltkriegs gegangen?
Mit meinen vorgelegten Informationen zu den Schweriner Grenadieren in der Anfangsperiode des Ersten Weltkriegs, und auch zum damaligen Militärwesen, möchte ich die Neugier des Lesers anregen. Meine Absicht ist natürlich auch, historisches Wissen zu bewahren. Nicht zuletzt soll es ein Plädoyer sein für politische Vernunft und zur Bewahrung des Friedens, für die gegenwärtigen politischen Grundfragen zum Krieg. Die richtigen Schlüsse für ein friedliches Miteinander der Völker in Europa zu finden, ist ebenso Absicht dieser Schrift.
Es geht um die Anfangsperiode des Ersten Weltkrieges, meist geschildert aus der Sicht des Unteroffiziers der Reserve Evermann (siehe Personenverzeichnis), mit Beginn der Verkündung der Mobilmachung am 1. August 1914 bis zum Scheitern der „Blitzkriegs“-Option, Anfang September 1914 an der Marne. Sein Aufsatz „Beim Grenadier-Regiment Nr. 89“ wurde 1915 veröffentlicht in der Heften-Reihe „Mecklenburgs Söhne im Weltkrieg“ (Quelle 37., Seite 189 – 203).
Manche Begriffe sind in ihrer Zeit so verwendet worden und sie wurden so stehen gelassen, zum Beispiel wenn es sich auf „Ihre Königliche Hoheit dem Großherzog“ bezieht. Vieles ist in der Ausdrucksweise der heutigen Zeit angepasst, damit es für den Leser verständlich bleibt.
Wolfgang Brasch
Militärische Einrichtungen und Behörden in Schwerin 1914
Stab der 17. Infanterie-Division
- Intendantur der 17. Division
- Großherzoglich-Mecklenburgisches Kontingentgericht
- Stab 34. Infanterie-Brigade (Großherzoglich-Mecklenburgische)
- I. und III. Bataillon, Stab Großherzoglich-Mecklenburgisches Grenadier-Regiment 89
- Stab 17. Kavallerie-Brigade (Großherzoglich-Mecklenburgische)
- Stab 17. Feldartillerie-Brigade
- Großherzoglich-Mecklenburgisches Feldartillerie-Regiment Nr. 60
° Pferdevormusterungskommission
° Großherzoglich-Mecklenburgische Invalidenabteilung
Bezirkskommando Schwerin
- Artilleriedepot (Grünes Tal)
- Proviant-Amt
- Militär-Bauamt
Garnisonsverwaltung
Garnisons-Lazarett
Feldflugplatz Schwerin-Görries
Abbildung 2: Lage der Militärobjekte in Schwerin
Der Krieg beginnt
Am Nachmittag des 1. August 1914 hatte sich eine große Menschenmenge am Südufer des Pfaffenteichs versammelt. Der ganze Tag war ein wunderschöner Sommertag. Mein Name ist Wilhelm Evermann. Ich werde in wenigen Tagen, am 6 August, 26 Jahre alt. Seit 4 Jahren bin ich Volksschullehrer in Schwerin und bin seit 29. Mai d. J. mit Anna Lüdert verheiratet. Es ist Samstag und ich machte gerade allein meinen Nachmittagsspaziergang um den Pfaffenteich in Schwerin, zwischen der Schelfstadt und der Paulsstadt gelegen. Ich hatte schon ziemliche Gewissheit über das, was kommen wird. Nun steuerte ich meine Schritte direkt auf eine Menschenansammlung zu. Die Menschen warteten ungeduldig der Dinge, die da kommen sollten und mussten. Beim Gebäude der Hauptpost (Heute Gebäude der (ehemaligen) Hauptpost in der Schweriner Mecklenburgstraße), gleich um die Ecke in der Kaiser-Wilhelm-Straße (Die heutige Mecklenburgstraße), wo die versammelte Menge scheinbar noch größer war und hier bei der Zeitung (Verlagsgebäude der Mecklenburgischen Zeitung, Schwerin, Arsenalstraße 12), in der Arsenalstraße musste es ja zuerst bekannt werden.
Als ich mich zum größten Gebäude am Pfaffenteich, dem Arsenal, umwandte, bemerkte ich kaum Aktivitäten am Haupteingang der 17. Division (Das Arsenal (Anschrift heute: Alexandrinenstraße 1) mit: Stab 17. Infanterie-Division, Stab 34. Infanterie-Brigade (Großherzoglich-Mecklenburgische), Stab 17. Kavallerie-Brigade (Großherzoglich-Mecklenburgische), Stab 17. Feldartillerie-Brigade), deren Stab sich dort befand. Die Wachen standen am Haupteingang wie immer, scheinbar regungslos.
Da, gegen 18:00 Uhr, kam Bewegung in die Massen: „Mobilmachung befohlen!“ Mit einem Schlage war die Spannung gelöst. Still, mit ernsten Gesichtern, ging die Menge auseinander. Nachdenklich ging auch ich nach Hause. Was hatte ich jetzt alles zu bedenken. Ich bin Lehrer in der Volksschule in der Amtstraße, wer wird nun die Klasse übernehmen? Was wollte ich unbedingt mitnehmen? Ich erreichte meine Wohnung in der Schweriner Werderstraße 25a. Erst später am Abend wurde es wieder lauter in den Straßen, und ich ging kurz vor die Haustür. In Umzügen unter dem Gesang patriotischer Lieder kam die Kriegsbegeisterung der Leute zum Ausdruck, die die Werderstraße zur Alten Jägerkaserne (Alte Jäger-Kaserne, die damalige Bezeichnung für die Werder-Kaserne) stadtauswärts hinaufzogen.
Abbildung 3: Ansicht der Werder-Kaserne um 1905
Am 2. August, dem 1. Mobilmachungstag, hatte auch ich, jetzt Unteroffizier der Reserve Wilhelm Evermann aus Schwerin, mich zu melden. Schon früh morgens begab ich mich zur Kaserne. Weit war es nicht für mich, nur ca. 500 Schritte trennten mich. Vor dem Tor sammelten sich bereits die Reservisten und Freiwillige, um sich beim Grenadier-Regiment (Offizielle Bezeichnung des Infanterie-Regimentes: Großherzoglich Mecklenburgisches Grenadier-Regiment Nr. 89) zu stellen. Ich konnte bei meiner alten Kompanie, der zweiten, eintreten. Ich hatte geglaubt, in der Kaserne (Anschrift: Walter-Rathenau-Str. 2, 1914: Scharnhorst-Straße) das rege, hastende Leben, den „großen Betrieb“ anzutreffen, wie es mir von den Probemobilmachungen meiner aktiven Dienstzeit her in Erinnerung war. Aber es war ganz anders. Die aktiven Mannschaften waren schon kriegsbereit (Die persönliche Munition war als Kampfsatz ausgegeben (60 Schuss), die persönlichen Dinge waren verpackt, auch ein eigenhändig geschriebenes Testament, um nach Hause gesendet zu werden, der Tornister und ein kleiner Koffer je Mann für die persönlichen Dinge auf dem Marsch zur Front geschnürt.).
Abbildung 4: Stellenbesetzung des Grenadier-Regimentes 89
Die Einkleidung der Reservisten vollzog sich in größter Ruhe und war in kurzer Zeit bewerkstelligt. Abends nach 20:00 Uhr fand ein feierlicher Akt in der Alten Jägerkaserne statt. Seine Königliche Hoheit (So die offizielle Anrede des Großherzogs, und nicht nur für den von Mecklenburg-Schwerin (siehe Deutsches Reich - Politische Gliederung))
der Großherzog verabschiedete sich
von seinen Grenadieren. Die Fahnen waren schon am Vormittag in aller Stille vom Schloss zu den Truppen gebracht. Ein nach Tausenden zählendes Publikum stand in der Nähe der Kaserne und begrüßte die anfahrenden Fürstlichkeiten mit lauten Hurrarufen. Es trafen zu der Feier ein der Großherzog (Friedrich Franz IV., Großherzog von Mecklenburg), die Frau Großherzogin (Alexandra Prinzessin von Hannover und Cumberland), die Frau Großherzogin Marie (Marie Karoline Auguste Prinzessin von Schwarzburg-Rudolstadt), die Frau Großherzogin von Oldenburg (Elisabeth Alexandrine Mathilde Auguste, Großherzogin von Oldenburg), der Herzog (Johann Albrecht, Herzog zu Mecklenburg) und die Frau Herzogin (Elisabeth Prinzessin von Stolberg-Roßla) Johann Albrecht sowie Herzog Adolf Friedrich (Adolf Friedrich, Herzog zu Mecklenburg, Erläuterungen zu den Personen, siehe Abschnitt Personenverzeichnis).
Die Allerhöchsten und Höchsten Herrschaften wurden von dem Divisionskommandeur Generalleutnant von Bauer (Kommandeur der 17. Infanterie-Division) sowie dem Brigadekommandeur Generalmajor von Kraewel (Kommandeur der 34. Infanterie-Brigade) begrüßt. Seine Königliche Hoheit der Großherzog nahm von dem, an dem Tage mit der Führung des Grenadier-Regiments Nr. 89 beauftragten Oberstleutnant Freiherrn von Wangenheim (Kommandeur des Grenadier-Regimentes Nr. 89 ab 2. August 1914. Der bisherige Kommandeur des Regiments, Oberst von Busse, übernahm an dem Tag das Kommando über die 34. Reserve-Infanterie-Brigade) den Rapport (Der Inhalt des Rapports betrifft die Vollzähligkeit der angetretenen Truppen, Anzahl der Offiziere, Unteroffiziere und Soldaten sowie die Gesamtstärke der angetretenen Truppe (I. und III. Bataillon und Maschinengewehr-Kompanie, das II. Bataillon ist in Neustrelitz in Garnison), dann der Status der Truppe, in diesem Fall die hergestellte Marschbereitschaft, die Bereitschaft zur Entgegennahme weiterer Befehle (also weiterer Aufgaben, eher als Höflichkeitsgeste) sowie Dienstgrad und Name des Meldenden) entgegen und schritt dann die Front der Truppen ab. Die Grenadiere standen in einem nach der alten Jägerkaserne (Alte Jägerkaserne, zuvor war das Großherzoglich-Mecklenburgische Jäger-Bataillon Nr. 14 dort kaserniert) zu offenen Viereck, inmitten die Fahnensektion. Jede Kompanie (Vom I. Bataillon die 1. bis 4. Kompanie, vom III. Bataillon die 9. bis 12. Kompanie sowie die Maschinengewehr-Kompanie) begrüßte der Großherzog mit einem lauten „Guten Abend, Grenadiere!“ und brausend erscholl es zurück: „Guten Abend, Königliche Hoheit!“
Abbildung 5: Verabschiedung des Grenadier-Regiments 89
Die Fürstlichkeiten traten dann näher zu den ruhmgekrönten Feldzeichen, und das Hoboistenkorps (Mit Ausnahme der Maschinengewehr-Kompanie hatte jede Kompanie einen Trompeter (Hoboist) für akustische Befehlsübermittlung) intonierte das Niederländische Dankgebet. Nachdem der Herr Kirchenrat Floerke die Truppe eingesegnet hatte, hielt der Großherzog ungefähr folgende Ansprache:
„Grenadiere, ich bin gekommen, um Euch Lebewohl zu sagen. Es ist ein tiefernster Augenblick, in dem Ihr Euch anschickt, dem Ruf des obersten Kriegsherrn (Kaiser Wilhelm II.) zu folgen. Ihr sollt hinausziehen in den Krieg, in den Kampf, der uns aufgezwungen (Der Text wird so aus der Quelle wiedergegeben - genau genommen wird das so auf allen Krieg führenden Seiten propagiert) ist. Die Sicherheit des Reiches ist angetastet.
Nun gilt es, dass die Armee zeigt, was sie in langer Friedensarbeit erlernt hat. Ihr Mecklenburger dürft teilnehmen und für die Sicherheit des Reiches einstehen. Da zieht denn freudig und tapfer hinaus! Die Arbeit wird zwar keine leichte sein, aber denkt an die Heldentaten der Väter, was sie vermocht! Tut es ihnen nach! Folgt Euren Offizieren vertrauensvoll und mutig! Vertraut Eurem Gott und Herrn! Ich sage Euch hiermit Lebewohl!
Den Eid aber, den Ihr dem Allerhöchsten Kriegsherrn gelobt habt, erneuern wir: Präsentiert das Gewehr! Seine Majestät der Kaiser, unser oberster Kriegsherr Hurra! Hurra! Hurra!“
Nachdem der feierliche Akt beendet war, war auch schon die Zeit des Abmarsches gekommen. Nach 20:20 Uhr setzte sich das I. Bataillon, als erste Einheit des Regimentes, unter Vorantritt der Regimentsmusik in Richtung Personenbahnhof (dem späteren Hauptbahnhof) in Bewegung. Unvergesslich wird dieser Marsch bleiben für jeden, der ihn mitgemacht hat. Dicht gedrängt standen die Schweriner, um ihre Lieben noch einmal im Vorbeigehen sehen zu können. Überall ernste würdige Begeisterung, dem Ernst der Lage entsprechend, und frohe Zuversicht. Auf dem Bahnhof stand eine lange Reihe von Güterwagen für uns bereit. Sie boten zwar keinen angenehmen Aufenthalt, da wir sehr gedrängt sitzen mussten, aber das wollten wir schon mit in den Kauf nehmen.
Gegen 22:00 Uhr verließ unser Zug die Halle, und nun ging es hinaus in die Nacht. Das III. Bataillon und die Maschinengewehr-Kompanie mit dem Regimentsstab verließen Schwerin auch noch während der Nacht. Wohin wir fahren sollten, das wusste keiner, wir ahnten es jedoch. Doch schon bald wurde es uns zur Gewissheit, dass es nach Westen gehen musste. So fuhren wir durch die deutschen Gaue und überall die gleiche Begeisterung. Auf den Feldern arbeiteten Frauen und Kinder und ältere Männer, um die Ernte einzubringen. Der Landsturm hielt die Wache an der Bahnstrecke. Dann bei Düsseldorf fuhren wir über den Rhein.
Abbildung 6: Durchfahrt eines Truppentransports
Von da ab wurden alle offenen Wagen zur Sicherung gegen feindliche Flieger besetzt. Auch ich vertauschte meine enge Behausung mit einem luftigen Sitz. Von den Landarbeitern aufmerksam gemacht, gewahrte wir einmal am Horizont ein Flugzeug, das aber bald wieder unseren Blicken entschwunden war. Am 3. August abends gegen 19:00 Uhr verließen wir in Herzogenrath den Zug. Von den Einwohnern erfuhren wir, dass schon am Nachmittag viele Züge mit Artillerie und Kavallerie in Richtung Aachen durchgefahren seien.
Zu diesen Tagen der Kriegserklärung und der Mobilmachung für die Schweriner Grenadiere, schrieb Oberstleutnant von Wangenheim in seinen Kriegserinnerungen folgendes:
„02. August: Die bei ,Probemobilmachungen‘ vorbereitete beschleunigte Mobilmachung des Regiments verläuft ohne Reibungen. 07:00 abends stehen in Schwerin die Bataillone I. und III. nebst Maschinengewehrkompanie zur Fahneneinsegnung durch den Kirchenrat Floerke auf dem Kasernenhof abmarschfertig. – Der hohe Chef, Seine Königliche Hoheit der Großherzog von Mecklenburg-Schwerin, gab dem Regiment im Namen des mecklenburgischen Landes Abschiedsgrüße mit auf den Weg, worauf der Regimentskommandeur, Oberstleutnant Freiherr von Wangenheim, mit erneutem Treuegelöbnis zum Landesherrn erwiderte.
Ähnlich ging der Abschied II. Bataillons in Neustrelitz am Fuße des Kriegerdenkmals von 1870/71 in Gegenwart des Großherzogs von Mecklenburg-Strelitz (Großherzog Adolf Friedrich der VI., Großherzog von Mecklenburg-Strelitz) vor sich. –
In der Nacht 02./03. August Eisenbahnfahrt für I. Bataillon 22:00 Uhr, für Regimentsstab und Maschinengewehrkompanie 23:42 Uhr, für III. Bataillon 02:34 Uhr aus Schwerin II. Bataillon 22:03 Uhr aus Neustrelitz. – Kompanien sind 130 Köpfe stark, da die Masse der Ersatzmannschaften noch fehlt. –
Abbildung 7: Eisenbahnroute des Grenadier-Regiments 89
03. August: Fahrt, bei der zunächst niemand das Endziel ahnte, über Harburg – Bremen – Münster – Krefeld in die Gegend von Aachen (Ausladepunkt war der Bahnhof von Herzogenrath, nördlich Aachen). –
Hier Alarmquartier bzw. Ortsbiwak. Regimentsstab, I. und III. Bataillon in Stadt und Vorstädten von Aachen, II. Bataillon in Bardenberg, Maschinengewehrkompanie in Neu-Süstern. – Unterkunft und Verpflegung ließen bei strömendem Regen zu wünschen übrig. – …“ (siehe Quelle 46., Seite 9)
Unser Zeitzeuge Unteroffizier Evermann setzt dann seine Schilderung fort: Nachdem unsere Fahrzeuge ausgeladen waren, setzten wir uns gegen 20:00 Uhr bei leisem einsetzendem Regen in Marsch, um in einem Dorfe der Umgebung Quartier zu beziehen. Etwas nach 22:00 Uhr (03.08.1914, 22:00 Uhr) waren wir untergebracht. Schnell noch einige Karten geschrieben und etwas gegessen, dann ging’s zur Ruhe ins Stroh.
Früh am andern Morgen, dem 4. August, setzten wir uns wieder in Marsch. Gegen 08:00 Uhr waren wir in Aachen. Hier wurde die erste Rast gemacht. Immer mehr Truppen zogen sich hier zusammen. Je mehr Truppentransporte ankamen, desto mehr hellten sich die Gesichter der guten Aachener auf, die von ihrem Morgenkaffee aufstanden und uns etwas von ihrem Frühstück herausbrachten, was sie sich selber zugedacht hatten. Neu gestärkt setzten wir dann unsern Marsch fort, eine nach unsern Friedensbegriffen ansehnliche Marschkolonne, Regiment 89 und 90, 7. Jäger und Pioniere, auch Artillerie (Großherzoglich Mecklenburgisches Grenadierregiment 89, Garnison Schwerin (Stab, I. Bataillon und III. Bataillon), Garnison Neustrelitz (II. Bataillon); Großherzoglich Mecklenburgisches Füsilierregiment 90 Kaiser Wilhelm, Garnison Rostock (Stab, I. Bataillon und III. Bataillon), Garnison Wismar (II. Bataillon); Westfälisches Jägerbataillon 7, Garnison Bückeburg. Pioniereinheiten und Artillerie ohne weitere Details zu Anzahl und Herkunft). Vor uns hatte sich eine Kavalleriedivision (Die 4. Kavallerie-Division war ein operativer Verband des Höheren Kavallerie-Kommandos 2 (kurz HKK 2) und setzte sich zusammen aus der 3. Kavallerie-Brigade (Stab Stettin), der 17. Kavallerie-Brigade (Stab Schwerin), der 18. Kavallerie-Brigade (Stab Altona), die Garde-Maschinengewehrabteilung Nr. 2 (Garnison Groß Lichterfelde - zwischen Kreuzberg und Potsdam), eine Pionierabteilung (ohne Spezifizierung, mit wahrscheinlich 1 – 3 Pionierkompanien vom Pionierregiment Nr. 8, Garnison Koblenz).), ich glaube die 4. in Bewegung gesetzt, die aber bald unseren Blicken entschwunden war.
Abbildung 8: Deutsche Infanterie auf dem Marsch
Wir marschierten der belgischen Grenze zu. Unterwegs begegneten uns oft Landsturmleute in malerischen Uniformen, die die Grenze bisher bewacht hatten. Vor der belgischen Grenze wurde ein längerer Halt gemacht. Man wusste scheinbar noch nicht, wie sich die Belgier zu unserm Einmarsch stellen würden. Die verschiedensten Gerüchte waren bei uns im Umlauf. So wurde erzählt, die Franzosen wollten in Belgien einmarschieren, und der König der Belgier habe den deutschen Kaiser um Hilfe gebeten. Andere wollten wieder wissen, dass die Franzosen schon im Anmarsch auf Lüttich seien; wir sollten im Eilmarsch an die Maas, um vor ihrem Eintreffen die Brücken zu besetzen.
Die Bildung der Angriffsgruppierung
Während das Grenadier-Regiment Nr. 89 seine Garnisonen in Schwerin und Neustrelitz noch nicht verlassen hatte, stellte das Deutsche Reich dem Königreich Belgien am 2. August 1914, 20:00 Uhr über den Gesandten in Brüssel, Claus von Below-Saleske, am 1. Mobilmachungstag, ein Ultimatum (siehe Quelle 26., Seite 98ff., siehe auch diese Schrift im Abschnitt Erklärungen – Ultimatum des Deutschen Reiches an das Königreich Belgien, vom 2. August 1914), um den freien Durchmarsch nach Frankreich ohne belgischen Widerstand zu erreichen. Gemäß den Planungen der deutschen Heeresleitung sollten so die Festungen an der französisch-deutschen Grenze umgangen werden und sind so als der „Schlieffen-Plan“ (Der „Schlieffen-Plan“ zielte auf die schnelle Umfassung der französischen Armeen von Norden vor dem Erreichen der vollen Mobilmachungsstärke unter Bruch der belgischen Neutralität. Benannt nach General von Schlieffen – siehe auch Personenverzeichnis) bekannt geworden und in Erinnerung geblieben.
Ist der „freie“ Durchgang durch Belgien nicht möglich, kann erst nach der Eroberung und damit nach dem Ausschalten der Festung Lüttich die strategische Entfaltung der 1., 2. und 3. Armee westlich und südlich der Festungsstadt Lüttich ausgeführt werden. Während weiter südlich sich die 4. Armee nach der Durchquerung durch das Großherzogtum Luxemburg entfaltete, begannen an der französisch-deutschen Grenze die ersten Gefechte, woran sich die Entfaltungsräume der 5., 6. und 7. Armee bis zur schweizerischen Grenze anschlossen. Auch die Streitkräfte der Schweiz machten sich in der außenpolitischen Situation kampfbereit, um ein Übertreten von fremden Truppen und das Hineintragen von Kampfhandlungen in das Schweizer Staatsgebiet zu unterbinden. (vergleiche Quelle 40, Seite 50)
Ausgangspunkt der Überlegungen über Umfang und Zusammensetzung der Angriffsgruppierung auf Lüttich und seinem Festungsgürtel war die Einschätzung über das zu erwartende Kräfteverhältnis. Die Überlegungen auf deutscher Seite betrafen zunächst die Besatzung der Stadt Lüttich (in Lüttich befanden sich mit der 12. und 14. zwei Infanterie-Brigaden, vier Bataillone Artillerie, d.h. zwölf aktive Batterien und drei Reservebatterien sowie ein Bataillon von Pionierkräften (mit drei Kompanien: Pontons, Sappeure und Telegraphisten)), mit der dort befindlichen Zitadelle und der Karthause (Fort de la Chartreuse) (einer weiteren, aber verlassenen Befestigung auf der östlichen Seite der Maas, direkt dem Zentrum der Stadt aus östlicher Richtung vorgelagert) sowie 12 Forts (Fort de Loncin. Die Bewaffnung des Forts war: Zwei Haubitzen im Kaliber 210 mm unter jeweils einer Panzerkuppel, zwei Kanonen im Kaliber 150 mm zu zweit unter einer Panzerkuppel, vier Kanonen im Kaliber 120 mm jeweils zu zweit unter einer Panzerkuppel, vier Kanonen im Kaliber 57 mm unter jeweils einer Panzerkuppel, weitere Schnellfeuerkanonen im Kaliber 57 mm und Scharten für Maschinengewehre. Quelle Nr. 36, Seite 8f.), mit je 200 bis 350 Mann Besatzung und entsprechender weitreichender Artillerie (nebenbei bemerkt, hauptsächlich aus den Magdeburger Gruson-Werken, die inzwischen zum Krupp-Konzern gehörten).
Abbildung9: 1914 – Gruson-Geschütz 210 mm
Zu den Angaben des Großen Generalstabes, über die Stärke des zu erwartenden Gegners, machte 1918 Marschall von Bieberstein (siehe Personenverzeichnis) in seiner Schrift „Lüttich – Namur“ (siehe Quelle 36) nachfolgende Notizen: „Man musste mit einer Friedensbesatzung von 6.000 Mann in Lüttich rechnen; hiernach war die Stärke der beschleunigt heran zu befördernden Truppen zu bemessen …“ (siehe Quelle 36, Seite 11) Für die Angriffsgruppierung waren vorgesehen (siehe dazu auch die ÜbersichtAngriffsgruppierung auf Lüttich4. August 1914, im Anhang):
2., 4. und 9. Kavallerie-Division (Höheres Kavallerie-Kommando 2, oder kurz HKK 2),
43. gemischte Infanterie-Brigade (Stab in Kassel),
38. gemischte Infanterie-Brigade (Stab in Hannover),
11. gemischte Infanterie-Brigade (Stab in Brandenburg/Havel),
14. gemischte Infanterie-Brigade (Stab in Halberstadt),
27. gemischte Infanterie-Brigade (Stab in Köln),
34. gemischte Infanterie-Brigade (Stab in Schwerin).
Bei den Kavallerie-Verbänden sind das insgesamt ca. 8.000 Mann und bei den verstärkten, deshalb gemischte Infanteriebrigaden ca. 25.000 Mann, die für die Einnahme Lüttichs bereitgestellt wurden. (siehe Quelle 40, Seite 109) Das Kommando wurde dem Kommandierenden General des X. Armeekorps (Generalkommando Hannover), General Emmich übertragen. Sein Chef des Generalstabes war Oberst Freiherr von der Wenige Graf von Lambsdorff.
Sämtliche Verbände dieser Angriffsformation, mit den ihnen zugeordneten Einheiten waren vor allen anderen Truppen in Marsch gesetzt worden, um das strategische Überraschungsmoment





























