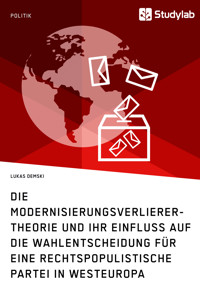
Die Modernisierungsverlierer-Theorie und ihr Einfluss auf die Wahlentscheidung für eine rechtspopulistische Partei in Westeuropa E-Book
Lukas Demski
36,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Studylab
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Das Jahr 2016 wurde in vielen Jahresrückblicken als „Das Jahr der Populisten“ bezeichnet. Die Wahl Donald Trumps zum amerikanischen Präsidenten und die durch ein Referendum herbeigeführte Entscheidung der Briten, die Europäische Union zu verlassen, sind nur einige Beispiele dafür, wie sehr der Begriff des Rechtspopulismus im Jahr 2016 im Fokus der Öffentlichkeit stand. Erfolge wie der von Donald Trump zeigen, dass es möglich ist, große Teile der Bevölkerung mithilfe des rechtspopulistischen Politikstils zu erreichen. Dabei ist die Gegenüberstellung von „Volk“ und „korrupter Elite“ eine der Kernmerkmale des Rechtspopulismus. Diese Publikation beschäftigt sich daher mit der Modernisierungsverlierer-Theorie von Tim Spier. Diese Theorie möchte den Erfolg rechtspopulistischer Parteien in Westeuropa erklären. Da Spier seine Theorie auf Daten aus den Jahren 2003 und 2005 stützt, wendet der Autor dieses Buches die Theorie für einen aktuelleren Zeitpunkt erneut an. Dazu untersucht der Autor den Einfluss der aus Spiers Theorie abgeleiteten Indikatoren auf die Wahlabsicht einer rechtspopulistischen Partei anhand aktueller Daten aus dem Jahr 2014. Sein Ziel ist es die Frage zu klären, ob sich die Modernisierungsverlierer-Theorie für das Jahr 2014 dazu eignet, die Erfolge rechtspopulistischer Parteien in Westeuropa zu erklären.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 103
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Impressum:
Copyright (c) 2018 GRIN Verlag / Open Publishing GmbH, alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten nur mit Genehmigung des Verlags.
Bei GRIN macht sich Ihr Wissen bezahlt! Wir veröffentlichen kostenlos Ihre Haus-, Bachelor- und Masterarbeiten.
Jetzt beiwww.grin.com
Inhaltsverzeichnis
Zusammenfassung
Abbildungsverzeichnis
Tabellenverzeichnis
1 Einleitung
2 Theoretischer Rahmen und Hypothesenableitung
2.1 Definition des Rechtspopulismus
2.1.1 Populismus-Konzept
2.1.2 Rechtspopulismus
2.1.3 Rechtsradikalismus und Rechtsextremismus
2.2Modernisierungsverlierer-Theorie
2.2.1 Modernisierungsverlierer-Theorie im Kontext der Globalisierung
2.2.2 Modernisierungsverlierertheorie nach Spier
2.2.3 Ableitung der Hypothesen
3 Methodik
3.1 Untersuchungsdesign
3.1.1 Fallauswahl
3.2 Vorstellung der Analyseverfahren
3.2.1 Regressionsanalyse
3.2.2 Faktorenanalyse
4 Analyse
4.1 Deskriptive Statistik
4.1.1 Operationalisierung
4.2 Regressionsanalysen
4.2.1 Einfluss der Modernisierungsverliererindikatoren auf das Wahlverhalten
4.2.2 Einfluss der rechtsaffinen Einstellungen auf das Wahlverhalten
4.2.3 Brückenhypothese
5 Fazit
6 Literaturverzeichnis
7 Anhang
Zusammenfassung
Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Modernisierungsverlierer-Theorie Tim Spiers, die einen Versuch darstellt, den Erfolg rechtspopulistischer Parteien in Westeuropa zu erklären. Da Spier seine Theorie auf Grundlage von Individualdaten des European Social Survey aus den Jahren 2003 und 2005 empirisch überprüft, scheint es im Kontext der steigenden Erfolge rechtspopulistischer Parteien in den letzten Jahren interessant, die Theorie für einen aktuelleren Zeitpunkt erneut anzuwenden. Dazu wurde der Einfluss der aus Spiers Theorie abgeleiteten Indikatoren auf die Wahlabsicht einer rechtspopulistischen Partei anhand aktueller Daten des European Social Survey
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Schematische Darstellung der Modernisierungsverlierer-Theorie
Abbildung 2: Darstellung des Untersuchungsmodells
Tabellenverzeichnis
Tabelle 1: Nettostichprobengröße und Anteil der realisierten Interviews im ESS 2014
Tabelle 2: Aufteilung des Geschlechts nach Untersuchungsland in Prozent
Tabelle 3: Bildung nach Ländern in Prozent
Tabelle 4: HauptberufsgruppenISCO-08
Tabelle 5: Anteil der Industrieberufe in den Untersuchungsländern
Tabelle 6: Subjektive Einkommensarmut der Untersuchungsländer in Prozent
Tabelle 7: Arbeitslosigkeit der Untersuchungsländer in Prozent
Tabelle 8: Komponentenladungen und Reliabilität der Skala sozialer Exklusion
Tabelle 9: Mittelwerte sozialer Exklusion nach Ländern und subjektiven Einkommen
Tabelle 10: Komponentenladungen und Reliabilität der Skala politische Unzufriedenheit
Tabelle 11: Mittelwerte politischer Unzufriedenheit nach Ländern und subjektivem Einkommen
Tabelle 12: Komponentenladung und Reliabilität der Xenophobie-Skala
Tabelle 13: Xenpohobie-Mittelwerte nach Ländern und Bildung
Tabelle 14: Komponentenladungen und Reliabilität der Autoritarismus-Skala
Tabelle 15: Autoritarismus-Mittelwerte nach Ländern und Bildung
Tabelle 16: Komponentenladungen und Reliabilität der Misanthropie-Skala
Tabelle 17: Misanthropie-Mittelwerte nach Ländern und subjektivem Einkommen
Tabelle 18: Anteil der rechtspopulistischen Wähler nach Untersuchungsland
Tabelle 19: Anteil der rechtspopulistischen Wähler innerhalb der Berufsklassen nach Land
Tabelle 20: Einfluss der Klassenlage auf das Wahlverhalten
Tabelle 21: Wahl rechtspopulistischer Parteien nach subjektivem Einkommen
Tabelle 22: Einfluss des subjektiven Einkommens auf das Wahlverhalten
Tabelle 23: Wahl rechtspopulistischer Parteien nach Erwerbsstatus
Tabelle 24: Einfluss der Arbeitslosigkeit auf das Wahlverhalten
Tabelle 25: Mittelwerte sozialer Exklusion nach Wahlverhalten und Land
Tabelle 26: Einfluss der sozialen Exklusion auf das Wahlverhalten
Tabelle 27: Umfassendes Modell der Modernisierungsverlierer-Indikatoren
Tabelle 28: Politische Unzufriedenheit nach Wahlverhalten und Ländern
Tabelle 29: Einfluss der politischen Unzufriedenheit auf das Wahlverhalten
Tabelle 30: Autoritarismus nach Wahlverhalten und Ländern
Tabelle 31: Einfluss des Autoritarismus auf das Wahlverhalten
Tabelle 32: Xenophobie nach Wahlverhalten und Ländern
Tabelle 33: Einfluss der Xenophobie auf das Wahlverhalten
Tabelle 34: Misanthropie nach Wahlverhalten und Ländern
Tabelle 35: Einfluss der Misanthropie auf das Wahlverhalten
Tabelle 36: Einfluss der rechtsaffinen Einstellungen auf das Wahlverhalten
1 Einleitung
Das Jahr 2016 wird in vielen Jahresrückblicken als „Das Jahr der Populisten“ bezeichnet. Die Wahl Donald Trumps zum amerikanischen Präsidenten und die durch ein Referendum herbeigeführte Entscheidung der Briten, die Europäische Union zu verlassen, sind nur einige Beispiele dafür, wie sehr der Begriff des Rechtspopulismus im Jahr 2016 im Fokus der Öffentlichkeit stand. Rechtspopulistische Parteien sind allerdings nicht erst mit diesen Ereignissen in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt. Seit mehr als 20 Jahren können rechtspopulistische Parteien in weiten Teilen Europas zunehmende Erfolge verzeichnen. Neu ist jedoch, dass sich die rechtspopulistische Konstellation in den vergangen zwei bis drei Jahren erheblich zugespitzt hat. Ein Symptom hierfür ist der Aufstieg der AfD in Deutschland: Während in vielen anderen westeuropäischen Staaten – wie beispielsweise in Frankreich mit dem Front National – rechtspopulistische Parteien schon seit vielen Jahren große Erfolge aufweisen können, war dies in Deutschland in der Vergangenheit mit Ausnahme der Republikaner nicht der Fall. Der Aufstieg der AFD geht einher mit dem Aufschwung anderer rechtspopulistischer Formationen wie der PEGIDA-Bewegung.
Erfolge wie die Donald Trumps zeigen, dass es mittlerweile möglich ist, große Teile der Bevölkerung mit mithilfe des rechtspopulistischen Politikstils zu erreichen. Dabei ist die Gegenüberstellung von „Volk“ und „korrupter Elite“ eine der Kernwesensmerkmale des Rechtspopulismus. So teilte US-Präsident Trump am 10.08.2016 über den Kurznachrichtendienst Twitter mit: „One of the key problems today is that politics is such a disgrace. Good people don’t go into government“. Aus dieser Gegenüberstellung kristallisiert sich eine fundamentale Konfrontation zwischen den „etablierten“ Parteien von ehemaligen Sozialisten über Sozialdemokraten, Grüne, Liberale bis hin zu christlich- konservativen Parteien auf der einen Seite und den rechtspopulistischen Parteien auf der anderen Seite heraus. Stehen die einen für eine am Kompromiss und dem innerhalb eines globalisierten sowie supranationalen Rahmens Machbaren orientierte Politik, so artikuliert der Rechtspopulismus die Stimmen der Bevölkerungsteile, die sich durch eben jene Politik an den gesellschaftlichen Rand gedrängt fühlen (Jörke/Nachtwey 2016: 1).
Oftmals fällt im Zusammenhang dieser durch die Folgen der Globalisierung abgehängten Bevölkerungsgruppen der Begriff des Modernisierungsverlierers. Momentan zeichnet sich die gegenwärtige Situation dadurch aus, dass es den traditionellen linken Parteien nicht mehr gelingt, Modernisierungsverlierer – sowohl kultureller als auch ökonomischer Art – an sich zu binden. Als Folge dessen wenden sich immer größere Teile der Bevölkerung von den zentralen Institutionen und Werten der liberalen Demokratie ab und bieten damit ein perfektes Ziel für die rechtspopulistische Propaganda, die oftmals von Lügen und Desinformationen geprägt ist, was Beispielsweise der erst kürzlich durch Donald Trump eingeführte Begriff der „alternativen Fakten“ zeigt. Wilhelm Heytmeyer macht in diesem Kontext in den Erfolgen der rechtspopulistischen Parteien eine der wesentlichen „Schattenseiten der Globalisierung“ aus (Heytmeyer 2001: 15). Hans Georg Betz spricht im Kontext des ausgerichteten Fokus der rechtspopulistischen Parteien auf Modernisierungsverlierer auch von der „Proletarisierung“ der Wählerschaft rechtspopulistischer Parteien (Betz 2001: 413).
Ein Ansatz der versucht, diese Thematik in ein theoretisches Modell umzusetzen, ist die Modernisierungsverlierer-Theorie Tim Spiers. In seiner im Jahr 2010 veröffentlichten Monographie „Modernisierungsverlierer. Die Wählerschaft rechtspopulistischer Parteien in Westeuropa“ geht Spier dabei der vielfach geäußerten These nach, dass es sich bei den Wählern der rechtspopulistischen Parteien um Modernisierungsverlierer handelt, überführt die These in ein Modell der Wahl rechtspopulistischer Parteien und überprüft sie empirisch anhand von quantitativen Umfragedaten des European Social Survey (ESS) für Westeuropa auf der Individualebene. Dabei wird der Einfluss verschiedener Modernisierungsverlierer-Indikatoren auf rechtsaffine Einstellungen und das Wahlverhalten zugunsten rechtspopulistischer Parteien untersucht (Spier 2010). Da Spiers Umfragedaten aus den Jahren 2003 und 2005 stammen, scheint es vor dem Hintergrund der zuvor beschriebenen Erfolge rechtspopulistischer Parteien in den letzten Jahren interessant, die Modernisierungsverlierertheorie für aktuellere Umfragedaten aus dem Jahr 2014 empirisch zu überprüfen. Dabei soll die Frage im Mittelpunkt stehen, inwieweit sich die Wahlentscheidung einer Person zugunsten einer rechtspopulistischen Partei mithilfe der Modernisierungsverlierer-Theorie Spiers und der daraus abgeleiteten Indikatoren erklären lässt. Bevor es zur Überprüfung der Theorie kommt, muss dazu zunächst eine Definition des Rechtspopulismus erarbeitet werden, auf deren Grundlage die Auswahl der entsprechenden Parteien in den einzelnen Untersuchungsländern getroffen werden kann. Nachdem dieser Schritt abgeschlossen wurde, soll in einem weiteren Schritt die Modernisierungsverlierer-Theorie Spiers und die dieser abgeleiteten Indikatoren und Hypothesen vorgestellt werden. Anschließend folgt der methodische Teil dieser Arbeit, in dem zunächst die Fallauswahl begründet werden soll, die auf Grundlage der erarbeiteten Definition getroffen wurde. Anschließend sollen mithilfe von Regressionsanalysen die auf Basis der verschiedenen Indikatoren erstellten Hypothesen überprüft werden. Im letzten Schritt dieser Arbeit sollen im Fazit alle Ergebnisse zusammengefasst und zusätzlich in Bezug auf die Theorie interpretiert werden.
2 Theoretischer Rahmen und Hypothesenableitung
2.1 Definition des Rechtspopulismus
Um rechtspopulistische Parteien im Rahmen einer empirischen Analyse untersuchen zu, bedarf es zunächst einmal einer Definition des Rechtspopulismus, auf der Grundlage derer Kriterien abgeleitet werden können, die eine rechtspopulistische Partei als diese definieren. Dabei geht es vor allem um die Frage, was die neuen, erfolgreichen rechten Parteien als rechtspopulistisch charakterisiert und was die Merkmale des Rechtspopulismus sind (vgl. Schönfelder 2008: 20).
In der internationalen politikwissenschaftlichen Literatur ist der Begriff des Rechtspopulismus vor allem im Hinblick auf die im selben Kontext ebenfalls oftmals verwenden Begriffe Rechtsextremismus und Rechtsradikalismus sehr umstritten. Der niederländische Politikwissenschaftler Cas Mudde sieht die Ursachen für diesen „war on words“ zum einen in unterschiedlichen theoretischen Grundvorstellungen und Differenzen zwischen verschiedenen Schulen der Forschung und zum anderen darin, dass häufig auch ohne besondere theoretische Rechtfertigungen neue Begrifflichkeiten geprägt werden würden. Letztendlich führe dies zu Problemen bei der Verständigung auf diesem Forschungsfeld (Mudde 2007: 11). Auf die Probleme dieser Begriffsbestimmung soll im Folgenden allerdings nicht weiter eingegangen werden, sondern nach einer passenden Definition gesucht werden, die im Rahmen der Analyse genutzt werden kann. Da diese Arbeit auf der Untersuchung Martin Spiers aufbaut, liegt es zunächst nahe auch seine Definition des Rechtspopulismus zu nutzen. Aufgrund der Tatsache, dass Spiers Definition größtenteils auf den Arbeiten Muddes aufbaut und dieser auch für das Jahr 2014 eine Einordnung der westeuropäischen rechtspopulistischen Parteien zur Verfügung stellt, soll in dieser Arbeit mit der Definition des Rechtspopulismus Muddes gearbeitet werden. Nach Mudde teilen rechtspopulistische Parteien eine Kernideologie, die drei verschiedene Eigenschaften miteinander verbindet: Populismus, Nativismus und Autoritarismus (Mudde 2017: 4). Ausgehend von dieser Definition, soll in einem ersten Schritt zunächst auf das politische Stilmittel des Populismus eingegangen und dessen wichtigste Eigenschaften erläutert werden. Im Anschluss soll der erklärt werden, was den Rechtspopulismus ausmacht und dabei vor allem auf die ideologischen Elemente des Nativismus und des Autoritarismus eingegangen werden, die im Falle des Rechtspopulismus zum Konzept des Populismus hinzukommen.
2.1.1 Populismus-Konzept
Bevor man sich der Frage widmet, ob die Verbindung mit radikal rechten Inhalten im Falle rechtspopulistischer Parteien das Kriterium einer eigenen Ideologie erfüllt, macht es zunächst Sinn sich mit dem generellen Phänomen des Populismus zu beschäftigen.
In der Populismus-Forschung wird das Konzept des Populismus primär als Politikstil aufgefasst, der dazu genutzt wird, um einen politischen Führer, eine Partei oder Bewegung, mit dem „Volk in Verbindung zu setzen“ (Betz: 2003 15). Populismus wird demnach als rein formales Merkmal verstanden, das in Verbindung zu höchst unterschiedlichen Ideologien stehen kann, so schreibt beispielsweise der Sozialwissenschaftler Nikolaus Wertz: „Den Populismus gibt es nicht, sondern nur dessen vielgestaltige Erscheinungsformen (Werz 2003: 14). Oftmals wird das Phänomen mit einem Chamäleon verglichen, das sich permanent neuen Bezugssystemen anpasst und sich zu ihnen in eine Anti-Beziehung setzt (vgl. Priester 2012b: 3). Für die Populismusforscherin Karin Priester ist Populismus ein „bloßes Bündel von Vorstellungen ohne einen beharrenden Träger (Substanz) seiner Akzidenzien, die gleichwohl eine beharrliche Gleichförmigkeit aufweisen“. Er lasse sich daher nicht essentialistisch definieren und auf eine kohärente Doktrin festlegen. Die programmatische Variationsbreite des Populismus hat nach Priester dazu geführt, ihn lediglich als eine Strategie des Machterwerbs zu definieren (vgl. Priester 2012a: 185). Da unter Strategien aber auch Verfahrensweisen zur Erreichung beliebiger Ziele verstanden werden könnten, sieht Priester im Populismus keine bloße Strategie, sondern ein Set von bestimmten Merkmalsbestimmungen, die aber nicht substanziell determiniert werden, sondern sich erst in unterschiedlichen Kontexten aktualisieren (Priester 2012a: 187). Reduziert man den Begriff auf ein ideologisches Minimum, kann zunächst eine Anti- Establishment-Haltung ausgemacht werden. So dient die Abgrenzung von politisch Verantwortlichen eines Landes und der inszenierte Widerstand gegen sie zugleich als Identifizierungspunkt mit der Klientel, um die geworben wird. Abstand halten vom politischen Establishment wird als Mittel der Wahl genutzt, um Annäherung an das Volk zu erzielen (Reuter 2009: 36). Auch Mudde nimmt diese vertikale Achse vom „armen Volk“ und „korrupter Elite“ in seinen Überlegungen zum Populismus auf und definiert ihn als
„an ideology that considers society to be ultimately separated into two homogeneous and antagonistic groups, ‘the pure people’ versus ‘the corrupt elite’, and which argues that politics should be an expression of the volonté générale (general will) of the people.“ (Mudde 2004: 543)





























