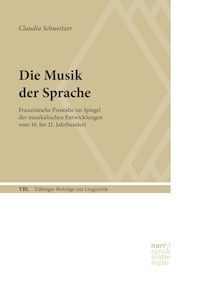
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Narr Francke Attempto Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Tübinger Beiträge zur Linguistik (TBL)
- Sprache: Deutsch
Die Verwandtschaft von Sprache und Musik ist tiefgreifend. Beide werden ausdrucksstark durch dieselben Parameter, die wir als prosodisch oder musikalisch bezeichnen. Diese "Musik der Sprache" wird immer dann deutlich, wenn Sprache klingt, sei es in gesprochener oder in gesungener Form. Dieser Band zeigt erstmals, wie in Frankreich seit dem 16. Jahrhundert prosodisches Wissen konstruiert wurde und welche Rolle dabei die Musik spielt. Die aufgezeigten theoretischen Grundlagen werden durch konkrete Beispiele verschiedener Jahrhunderte und Disziplinen (Linguistik, Poesie, Musik) verdeutlicht.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 393
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Claudia Schweitzer
Die Musik der Sprache
Französische Prosodie im Spiegel der musikalischen Entwicklungen vom 16. bis 21. Jahrhundert
© 2021 • Narr Francke Attempto Verlag GmbH + Co. KGDischingerweg 5 • D-72070 Tübingen
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetztes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Internet: www.narr.deeMail: [email protected]
ISBN 978-3-8233-8493-9 (Print)
ISBN 978-3-8233-0343-5 (ePub)
Inhalt
„Die Musik ist eine Sprache, keine konventionelle oder lokale, wie das Griechische, das Lateinische, das Französische oder andere Sprachen, sondern eine, die natürlich und allgemein verständlich ist.“
„La musique est une langue, non de convention, non locale, comme le grec, le latin, le français et autres, mais une langue naturelle et de tous pays.“
Jérôme-Joseph MOMIGNY (1806: 29)
Einführung
Die menschliche Stimme und ihre – wie es scheint – unendlichen Ausdrucksmöglichkeiten faszinieren. Eine Stimme ist in der Lage, eine Welt in uns zu berühren, die abstrakt und metaphorisch zugleich ist. „Der Klang der Stimme verrät den Zustand der Seele“, sagt der 1950 geborene österreichische Ingenieur und Maler Helmut Glassl. Für den deutschen Philosophen und Pädagogen Andreas Tenzer (*1954) sind Stimmen „hörbare Schwingungen“ und der französische Philosoph und Enzyklopädist Denis Diderot (1713–1784) bezeichnet bereits im 18. Jahrhundert die Stimme als „ein Musikinstrument, dessen sich alle Menschen ohne die Hilfe von Lehrern, Prinzipien oder Regeln bedienen können“.1
Die Stimme und ihre Klänge hängen von der Sprechsituation, von der gewollten Ausdruckskraft und vom seelischen Zustand des Sprechers oder der Sprecherin ab. Heute haben Neuro- und Psycholinguistik die Möglichkeit, mit gezielten technischen Mitteln an diesen Zusammenhängen zu arbeiten. Im Vergleich zu sprachwissenschaftlichen Überlegungen, die bereits aus der Antike überliefert sind, sind diese Möglichkeiten jedoch extrem jung. Lange Zeit waren Stimme und Sprache vorwiegend über den Gehörsinn zugänglich. Le jugement de l’oreille bildete somit einen wichtigen Faktor für die Wahrnehmung und für die Analyse sprachlicher Phänomene. Anders als Überlegungen anhand schriftlicher Texte (zum Beispiel zu Syntax oder Lexik) stellen die Stimme und die von ihr übertragenen Laute oder Worte den Forscher vor das Problem, dass sein Forschungsobjekt, das heißt die Sprachlaute, vergänglich und ohne Aufnahmemöglichkeit einmalig und nicht reproduzierbar ist.
Oftmals haben die französischen Forscher vergangener Jahrhunderte auf die Gesangsstimme zurückgegriffen, die im Vergleich zur Sprechstimme eine (geringfügig) größere Stabilität der Laute zu versprechen schien. Denis Dodart, seines Zeichens Arzt, konstatiert zu Beginn des 17. Jahrhunderts eine hohe Affinität von Sprech- und Gesangsstimme, da beide auf demselben physischen Mechanismus beruhen.2 Jean-Jacques RousseauRousseau, Jean-Jacques weist ebenfalls auf die große Ähnlichkeit zwischen Sprache und Gesang hin. Er spürt zwar einen kleinen Unterschied, der aber schwierig zu beschreiben ist.3 Die Eigenschaft, etwas länger anzudauern, macht die gesungenen Töne in den Augen der Theoretiker jedoch zu einem geeigneten Studienobjekt (vgl. Schweitzer, 2018).
Auch heute noch wird die Verwandtschaft von Sprache und Gesang als tiefgreifend angesehen. Sprache ist melodisch, rhythmisch und akzentuiert, genau wie jede musikalische Produktion. Musik und Sprache werden ausdrucksstark durch dieselben Parameter: diejenigen, die wir als prosodisch bezeichnen. Sprache ist nicht nur in der Poesie, sondern in jeglicher Form von Äußerung musikalisch. Diese „Musik der Sprache“ wird deutlich, wenn Sprache klingt, und dies nicht nur in gesungener Form, sondern auch als gesprochenes Wort.
Heute untersuchen Prosodisten diese „Musik der Sprache“ und sie unterscheiden dabei drei Parameter: Tonhöhe (Grundfrequenz) oder Tonhöhenentwicklung (Melodie), Tonlänge (Rhythmus oder Tondauer und Pausen) und Intensität (Volumen und Akzentuation). Diese Parameter haben ihren Ursprung in der Beschreibung der Singstimme, und eine gemeinsame Metasprache von Musikern und Prosodisten (Terme wie zum Beispiel „Rhythmus“, „Melodie“ oder „Akzent“ werden in beiden Disziplinen verwendet) weist noch heute auf die gemeinsamen Wurzeln dieser beiden Ausdrucksmöglichkeiten hin (vgl. Dodane et al., 2021).
Es ist typisch für die vergangenen Jahrhunderte, dass die Erforschung der Stimme und der Sprachlaute nicht allein eine sprachwissenschaftliche Angelegenheit war. Das Phänomen interessierte mehrere Disziplinen, die das Thema auf unterschiedliche Weise, mit eher praktischen, eher theoretischen, eher experimentellen oder eher reflexiven Methoden bearbeiten. Aus diesem Grund scheint es für die Erforschung der Wirksamkeit und der Wirkungsweise menschlicher gesprochener Sprache unabdingbar, zwei Ansätze zu berücksichtigen: einen wissenschaftlichen und einen philosophischen.
Um die heute übliche Definition der Prosodie als „Gesamtheit sprachlicher Eigenschaften wie Akzent, Intonation, Quantität, Sprechpausen“ (Bußmann, 1990: 618) zu finden, waren viele Überlegungen in verschiedene Richtungen und sogar Umwege nötig. Im Laufe der Jahrhunderte sind alle genannten Parameter mehr oder weniger intensiv untersucht worden. Zunächst spielten prosodische Überlegungen in den poetischen Ausdrucksformen gewidmeten Disziplinen eine Rolle (Dodane et al., 2021). Besonders die Quantität (Vokal- oder Silbenlänge) bildete oftmals ein wichtiges Studienobjekt. Erst mit dem Erscheinen der Grammaire générale et raisonnée von Antoine ArnauldArnauld, Antoine und Claude LancelotLancelot, Claude (1660) findet das Thema auch Eingang in den Kanon der regelmäßig in den Grammatiken behandelten Themen. Besonders die Überlegungen Denis VairasseVairasse d’Allais, Denis d’Allais‘ (1681) bedeuten hier einen großen Fortschritt: Der Autor berücksichtigt nicht nur die beiden mittels des Hörsinns relativ leicht zugänglichen Parameter Rhythmus und Quantität, sondern spricht in dem den Akzenten gewidmeten Kapitel auch von ton und emphase.
Im 18. Jahrhundert bilden sich zwei Haupttendenzen heraus. Die eine konzentriert sich auf die Prosodie der französischen Sprache und versucht, deren Besonderheiten im Vergleich zu anderen Sprachen herauszuarbeiten. Ein Beispiel dafür ist der Traité de la prosodie françoise des Abbé D’OlivetD’Olivet, Pierre Joseph (1736). Die zweite versucht, Parallelen zwischen den verschiedenen Sprachen und ihrem prosodischen Verhalten aufzudecken. Sie gliedert sich damit in die Richtungen der grammaire générale4 und der grammaire comparée ein. Auch im Bereich der Rhetorik bleiben Fragen der Quantität wichtig. So spricht noch Jean-Dominique VuillaumeVuillaume, Jean-Dominique (1871) von der Wichtigkeit der Beachtung der richtigen Quantität für eine gute „prononciation grammaticale et prosodique“.5
Doch erst bei den frühen Phonetikern wird die Prosodie im Verlauf des 19. Jahrhunderts zu einem zentralen Forschungsthema. Mit der auf Etienne-Jules Marey (1830–1904) zurückgehenden Graphischen Methode wird um die Jahrhundertwende die Analyse der verschiedenen Parameter auf experimenteller Basis möglich. Jean-Pierre RousselotRousselot, Jean-Pierre arbeitet so über Intonation, Akzentuation und Rhythmus der französischen Sprache. Hector MarichelleMarichelle, Hector gelingt eine mathematische Kurvenanalyse der Formanten und die experimentelle Unterscheidung von accent tonique und accent oratoire. Paul PassyPassy, Paul Edouard stellt in einem komparatistischen Ansatz die Intonationen verschiedener Sprachen, darunter des Französischen, einander gegenüber, und Léonce RoudetRoudet, Léonce beschäftigt sich mit den Zusammenhängen von Intonation, Emotion und Logik sowie deren Auswirkungen auf die Sprachakzentuation.
All diese neuen Entwicklungen revolutionieren die Kenntnisse der Forscher und sind richtungsweisend für die heutigen Sprachtheorien. Gleichzeitig lassen diese Entwicklungen aber auch eine große Kontinuität mit den Arbeiten der Grammatiker vorheriger Jahrhunderte erkennen. Das alte und überlieferte Wissen findet seinen logischen Platz in den neu entwickelten Theorien. Seine Spuren finden sich nicht nur bei den ersten, auf prosodische Fragen spezialisierten Forschern des 20. Jahrhunderts wie Théodore Rosset, dem Gründer des Institut de phonétique in Grenoble (1904), sondern auch noch in ganz aktuellen Arbeiten. Zu nennen wären beispielsweise die Veröffentlichungen von Aniruddh D. Patel und Joseph R. Daniele (2003) zum Einfluss der jeweiligen Muttersprache auf die Formung musikalischer Themen englischer und französischer Komponisten, oder auch diejenigen von Emmanuel BigandBigand, Emmanuel und Barbara TillmannTillmann, Barbara (2020) zur Verarbeitung von Musik und Sprache im menschlichen Gehirn.
In jeder der angesprochenen Perioden können Einflüsse von Musiktheorie und –praxis sowie von ästhetischen Fragestellungen auf die Entwicklung der Richtung der Überlegungen in der Prosodieforschung festgestellt werden. Dieser Aspekt dient im vorliegenden Buch als roter Faden, um die Tradierung und Weiterentwicklung des Wissens um die französische Prosodie (in Frankreich) sowie die damit verbundenen Integrations- und Transformationsprozesse im Laufe der Jahrhunderte nachzuvollziehen. Angesichts der großen Menge des verfügbaren Materials kann dabei keine Vollständigkeit angestrebt werden. Es geht vielmehr darum, die interdisziplinären Konzepte, die jahrhundertelang die französische Ideengeschichte zur Prosodie charakterisiert haben und deren Spuren sich auch heute noch in den Arbeiten zur Prosodie der französischen Schule finden, verständlich zu machen.
Theoretischer Rahmen und methodisches Vorgehen
Seit Beginn des 19. Jahrhunderts nehmen geschichtliche Untersuchungen einen – mehr oder minder breiten – Raum in den Sprachwissenschaften ein. Wissen um die Vergangenheit hilft, Sprachentwicklungen zu beschreiben und zu verstehen. Aber ist nicht jedes Wissen im Grunde genommen historisch? Wissen selbst kann nicht definiert werden, nur der Moment, in dem ein Autor es tradiert (AurouxAuroux, Sylvain, 2006). Damit besitzt jeder Wissensakt nach Sylvain AurouxAuroux, Sylvain (1992) sowohl einen Retrospektions–, als auch einen Projektionshintergrund. Jedes neu gefundene und entwickelte Wissen organisiert den bisherigen Wissenskanon, es setzt Akzente, lässt Teilaspekte in der Vergessenheit verschwinden, idealisiert und/oder setzt Impulse. Um die Entwicklung linguistischer Theorien und Ideen zu begreifen, die uns nicht nur das Verständnis unserer Sprachgeschichte, sondern auch unserer heutigen Denkmodelle ermöglichen, ist es daher wichtig, über lange Zeiträume zu arbeiten.
Im Laufe der letzten Jahrzehnte haben ideengeschichtliche Forschungen in den Sprachwissenschaften immer mehr Fuß gefasst. Sie reflektieren die Notwendigkeit der Linguisten, Objekte, Orientierungen, Grenzen und Geschichtlichkeit ihrer Disziplin zu hinterfragen. Epistemologische Forschungen geben die Möglichkeit, die Relevanz tradierter und in Vergessenheit geratener geschichtlicher Entwicklungen und historischer Konzepte für gegenwärtige Sprachtheorien zu ermessen. Die Variationsbreite der Bezeichnungen und Denkrichtungen kann nicht nur onomasiologisch und semasiologisch, sondern vor allem in ihrer Bedeutungsbreite und Tragweite über die Jahrhunderte hinweg bis heute untersucht werden. Hier sei nur kurz auf Dietrich Busse verwiesen, der in seinen Arbeiten über das Verhältnis von Sprach-, Kultur- und Kognitionswissenschaften nachdrücklich darauf hinweist, dass – in seinem Falle – „eine Diskursanalyse auch in einer linguistisch reflektierten Weise, als eine Methode und ein Forschungsziel einer kulturwissenschaftliche (bewusstseinsanalytisch) orientierten – nicht nur von Historikern, sondern auch von Linguisten betriebenen – Historischen Semantik durchgeführt werden kann“ (Busse, 2008).
In Deutschland gliedern sich Untersuchungen zur französischen Sprache und Sprachgeschichte konsequent und folgerichtig in die Romania-Forschung ein. Der Rahmen der romanischen Sprachen ist sicherlich geeignet, um sprachfamilientypische Prozesse zu verstehen und zu bewerten. Dies Verfahren setzt allerdings einen gemeinsamen systematischen Rahmen für alle behandelten Sprachen voraus, der länderspezifische Eigenheiten nicht immer auffangen kann. Dieses Buch möchte dazu beitragen, heute in Frankreich betriebene epistemologische Forschungen zur französischen Prosodie für die deutsche Romania-Forschung zugänglich und nutzbar zu machen. An die Stelle der Sprachfamilie tritt dabei eine interdisziplinäre Einbettung der historischen epistemologischen Fragestellung, die nicht nur die Erweiterung des Blickwinkels einer einzelnen Disziplin ermöglicht, sondern auch eine neue Ausrichtung und Gewichtung der Fakten nach dem Modell der global history (vgl. Maurel, 2013). Die Geschichtsschreibungen verschiedener Disziplinen werden zusammengeführt und für ein breiteres Verständnis nutzbar gemacht (Bertrand, 2013). Dieses Vorgehen ist im Wesen der Prosodie selbst angesiedelt: Sie ist in mehreren Disziplinen verankert und folgerichtig im Laufe der Geschichte von Forschern, Theoretikern und Praktikern verschiedener Richtungen (Linguisten, Dramatiker, Rhetoriker, Musiker, Komponisten…) behandelt worden. Eine Wiedereinbettung der Prosodietheorien in einen interdisziplinären Rahmen bedeutet einen neuen Impuls für die heutigen, auf segmentale Fragen konzentrierten Sprachtheorien und kann ein tieferes Verständnis für die Beschreibung der emotionellen Vorgänge, die durch prosodische Mittel ausgelöst werden, geben.
Die enge Verbindung, die die Prosodie zwischen Sprache und Musik/Gesang herstellt, wurde zu keinem Zeitpunkt im Verlauf der Geschichte grundsätzlich in Frage gestellt, hat aber im Laufe der Jahrhunderte ihre bedingungslose Auslegung verloren. Wenn Jean-Léonor Le Gallois GrimarestGrimarest, Jean-Léonor Le Gallois (1707) den Gesang noch als eine Art besonders deutlich modulierten (und daher besonders ausdrucksstarken) Sprechens beschreibt, so manifestiert sich die Sicht auf die Verbindung der beiden Ausdrucksformen der menschlichen Stimme in der Folge deutlich romantischer und imaginärer, wie es das folgende Zitat von Romain Rolland aus dem Jahre 1908 zeigt: „Si la musique nous est si chère, c’est qu’elle est la parole la plus profonde de l’âme, le cri harmonieux de sa joie et de sa douleur“ – „Dass die Musik uns so teuer ist, liegt daran, dass sie eine Sprache ist, die aus den Tiefen unserer Seele kommt, ein harmonischer Schrei ihrer Freude und ihres Schmerzes“. Was unverändert bleibt, ist das Bewusstsein, dass Gesang und Sprache nichts Anderes sind als zwei verschiedene Ausdrucksmöglichkeiten menschlicher stimmlicher Äußerung. Mit der veränderten Konzeptualisierung geht im Laufe der Jahrhunderte eine geänderte – jeweils modernisierte – Ausdrucksweise einher. Jede Epoche besitzt ihre eigenen Konzepte, Denkmodelle, Ausdrucksarten und Bilder, die für Leser und Leserinnen der entsprechenden Kultursphäre und -epoche sprechend sind, aber nicht unbedingt für uns heute. Die Inhalte dieser Texte müssen daher oftmals „übersetzt“ werden, um sie verständlich zu machen und mit denen anderer Jahrhunderte, Zielrichtungen und Horizonte vergleichen zu können. Hinzu kommt, dass mit Fortschreiten in der Geschichte die Forscher und Forscherinnen immer spezialisierter arbeiten. Wir verfügen heute nicht mehr über das disziplinübergreifende, oft beinahe enzyklopädische Wissen der Autoren und Forscher früherer Zeiten und müssen eine reiche Literatur und mehrere Kollegen hinzuziehen, um die Aussagen der alten Texte in ihrer vollen Bandbreite zu erfassen.
Die Texte verschiedener (sprachgeschichtlicher, kultureller und soziologischer) Epochen und Disziplinen (Linguistik, Kunst, Rhetorik) müssen daher zunächst gesichtet, interpretiert und homogenisiert werden, um sie in ihrer vollen Aussagekraft auswertbar zu machen (AurouxAuroux, Sylvain, 1980). Parallelen, Transmissionen, aber auch Vergessensprozesse werden so zu Tage gebracht. Nur ein umfangreicher Korpus kann gewährleisten, dass auch zu bestimmten Zeiten wichtige und einflussreiche, heute aber vergessene Texte berücksichtigt werden (Fournier & Raby, 2008). Eine Auflistung mit den nach Fächern geordneten Texten des für die vorliegende Studie verwendeten Korpus, ergänzt durch kurze bibliographische Erläuterungen, findet sich am Ende des 2. Kapitels.
In dem etablierten Arbeitskorpus müssen die wichtigen Objekte und Ideen identifiziert und „neutralisiert“ werden, da selbst die zu Beginn des 20. Jahrhunderts verfassten Texte oft noch stark von der Persönlichkeit, den Erfahrungen, Erwartungen und dem linguistischen und kulturellen Hintergrund des jeweiligen Forschers geprägt sind. Es gilt also, diese Eigenheiten zu berücksichtigen, zu bewahren, und doch vergleichbar zu machen. Dabei gilt das Interesse nicht nur dem Wissen selbst, sondern auch den entwickelten Arbeits- und Denkstrategien, die mit bestimmten Kenntnisständen einhergehen: Die Rekonstruktion ermöglicht die Identifikation der Theorien und die Verbindung der unterschiedlichen Forschungsobjekte, die zu verschiedenen Zeitpunkten prosodisches Wissen darstellen (AurouxAuroux, Sylvain, 1980). Durch dieses Verfahren wird nicht nur die innere Logik der chronologischen Abläufe und Entwicklungen verständlich, sondern die Ideen und Konzepte können auch kontextualisiert und in den verschiedenen ästhetischen Richtungen situiert werden.
Erst an dieser Stelle setzt der praktische Aspekt der Forschung ein. Eine Auswahl an Texten zu Kompositionstechniken und zur Verslehre, an Gedichten, musikalischen Kompositionen und Aufnahmen übernimmt dabei die Funktion einer „praktischen Überprüfung“ der identifizierten Konzepte. Dazu wurde in zwei Umfragen die Wahrnehmung prosodischer Phänomene anhand von aktuellen Aufnahmen rezitierter Gedichte, Slam-Versionen und verschiedener aktueller Musikrichtungen (Chanson und Rap) bei Personen getestet, deren Muttersprache Französisch ist oder für die das Französische eine mehr oder weniger gut bekannte Fremdsprache darstellt. Durch den Vergleich von theoretischen Konzepten und praktischer Überprüfung ergibt sich ein fruchtbarer Austausch, der zum Ziel hat, die Geschichte der Prosodie des Französischen in einer großen Bandbreite darzustellen.
Ich danke allen, die mir während der Arbeit an dieser Forschung Hilfe und Anregung vermittelt haben. Besonders ein Forschungsstipendium der Stiftung Fritz Thyssen in den Jahren 2020–2021 hat es mir erlaubt, meine Zeit ganz dieser aufwändigen Studie zu widmen.
Mein Dank gilt den Mitgliedern des Forschungsinstituts Praxiling in Montpellier, in dessen Rahmen die Forschung durchgeführt werden konnte. Die verschiedenen Gespräche und Diskussionen haben diese Arbeit maßgeblich gefördert. Besonders möchte ich hier Agnès Steuckardt erwähnen, die dieses Projekt unterstützt und wissenschaftlich betreut hat.
In einem Buch, in dem es um klingende Worte, Töne und Laute geht, wäre es schade, völlig auf akustische Beispiele zu verzichten. Um Lesern und Leserinnen Zugang zu einem Teil des reichen praktischen Materials zu geben, das in einer Buchausgabe nur bedingt Platz hat, wurden daher eine digitale Beilage mit zusätzlichen Materialien, Bilder und Verweisen auf Aufnahmen erstellt. Sie ist zugänglich unter
https://praxiling.cnrs.fr/livres/Die_Musik_der_Sprache.pdf
oder
www.meta.narr.de/9783823384939/Die_Musik_der_Sprache.pdf.
Im Text verweisen die durchnummerierten Beispiele („Bsp. 1“ …) auf ein sich in dieser Beilage befindliches Ton-, Bild- oder Textdokument.
1Prosodie und Musik: eine lange gemeinsame Geschichte
Die Etymologie des Wortes Prosodie weist bereits auf seine interdisziplinäre Ausrichtung hin: Im Altgriechischen bezeichnete ôdê einen Gesang mit Instrumentalbegleitung (Dodane, 2003: 28), prosôidia (griechisch) bezeichnet die melodische Akzentuierung des Altgriechischen und bezieht sich damit gleichermaßen auf Sprache und auf Musik. Die Musikwissenschaft spricht vom „Hinzusingen“ (Pöhlmann, 2016) und verweist damit ebenfalls auf beide Bereiche (je nach Auslegung ist der Text der Melodie hinzugefügt, oder umgekehrt). Der Begriff Intonation, der auf das lateinische Verb intonare zurückgeht, wurde laut Mario Rossi (1999) bis zum Beginn des 18. Jahrhunderts ausschließlich verwendet, um vom Anstimmen einer musikalischen Melodie zu sprechen. Aufgrund einer falsch verstandenen etymologischen Verwandschaftsbeziehung mit dem Wort tonus wurde der Begriff intonation in Frankreich mit Beginn des 19. Jahrhunderts als Synonym für musicalité und für die mélodie der Stimme gebraucht. Damit bahnte sich eine Bedeutungsverschiebung an, die dazu geführt hat, dass in der Linguistik der Begriff Intonation heute als das Zusammenwirken von Akzent (Intensität) und Tonhöhenverlauf verstanden wird. 1993 erklärte Flo Menezes die prosodische Intonation zum deutlichsten Element, an dem sich die Verwandtschaft von Sprache und Musik unverzüglich einem jeden Hörenden erschließt.1
Jahrhundertelang waren Rhythmus und Silbenlänge Hauptthema der Poeten, und die Beschäftigung mit der antiken Poesie hat zur Herausbildung eines raffinierten metrischen Systems geführt, in dem zahlreiche Kombinationen von langen und kurzen Silben katalogisiert sind. Die ursprünglich griechischen Namen dieser Metren, wie iambe ( ᴗ – ), trochée ( – ᴗ ), spondée ( – - ), tribraque ( ᴗ ᴗ ᴗ ), anapeste ( ᴗ ᴗ – ), dactyle ( – ᴗ ᴗ ), amphibraque ( ᴗ – ᴗ ), crétique ( - ᴗ - ), péon ( – ᴗ ᴗ ᴗ ), choriambe ( – ᴗ ᴗ – ) und pyrrhique ( ᴗ ᴗ ᴗ ᴗ )2 werden heute noch in französischen musiktheoretischen Texten zur Bestimmung der Sequenzierung musikalischer Grundrhythmen verwendet.
Prosodie und Musik blicken auf eine lange gemeinsame Geschichte zurück. Diese kommt heute allerdings hauptsächlich zwischen den Zeilen zum Ausdruck, zum Beispiel durch die Wahl musikalischer Notationen zur Verdeutlichung verschiedener Intonationsmuster.
1.1 Prosodie und stimmlicher Ausdruck
Wer von Prosodie spricht, denkt an Melodie, an Rhythmus, an Tempo, Intonation, Akzentuierung und/oder an Intensität. Diese Parameter sind untrennbar von (praktisch jeder) menschlichen vokalen Äußerung. „Betrachtet man die alltägliche Konversation, ist doch die Art und Weise wie eine Person etwas sagt – die Prosodie – oft ein scheinbar besserer Spiegel ihres Inneren, ihrer Einstellungen, Absichten und Emotionen, als der eigentliche Wortlaut selbst“, so Daniela SammlerSammler, Daniela (2014). Eine Stimme, der es an Variationen eines oder mehrerer der genannten Parameter mangelt, wird als ausdruckslos empfunden. Der Diskurs wirkt statisch und der Sprecher oder die Sprecherin machen einen unbeteiligten Eindruck, denn die Prosodie übermittelt „nicht nur wesentliche sprachliche Informationen, sondern ist auch Ausdruck der emotionalen und sozialen Befindlichkeit des Sprechers oder der Sprecherin“ (SammlerSammler, Daniela, 2014). Heute existiert eine reiche Literaturauswahl1 mit Erläuterungen und Übungen um zu lernen, ausdrucksvoll (und überzeugend) zu sprechen, das heißt, seine Stimme, und damit die prosodische Gestaltung des Gesagten, zu beherrschen und so den Eindruck, den der Hörer oder die Hörerin haben wird, zu beeinflussen.
Diese Bemerkungen gelten für jegliche Art stimmlicher Äußerung wie freies Sprechen, Vorlesen, Rezitieren, Deklamieren oder Singen gleichermaßen. Damit ist die Prosodie ein von Grund auf interdisziplinäres Phänomen.2 Diese Tatsache spiegelt sich deutlich in der Definition wider, die der Trésor de la langue française informatisé (TLFI) zu diesem Terminus gibt und in der drei Disziplinen angesprochen werden: Metrik oder Poesie (verstanden als die Regeln der Verskunst, das heißt, Vokallängen, Akzentuierung und Intonation), Linguistik (in der französischen Schule verstanden als Studie der prosodischen Parameter wie Melodie, Intonation und Dauer) und Musik (im Rahmen der Wort- Tonbeziehung).3
In allen Bereichen dient die Prosodie zum Ausdruck von linguistischen wie von extralinguistischen Elementen. Zur ersten Kategorie zählen Variationen, die typisch für eine bestimmte Sprache sind (wie der Wortakzent oder die Sprachmelodie im Allgemeinen, Versmuster, oder auch musikalische Floskeln, die für einen ganz bestimmten Stil typisch sind). Die zweite Kategorie umfasst all die Stimmvariationen, die zum faktischen Inhalt der Äußerung einen affektiven oder emotionalen Gehalt hinzufügen, wie zum Beispiel der Sprachduktus oder das spontan – bewusst oder unbewusst4 – gewählte Tempo eines deklamatorischen oder musikalischen Vortrags. Der französische Grammatiker Jean-Baptiste MontmignonMontmignon, Jean-Baptiste (1785) erwähnt im 18. Jahrhundert bereits diese beiden Dimensionen, wenn er Prosodie mit der Ordnung und Struktur des Diskurses ebenso in Verbindung setzt wie mit seinem Ausdrucksgehalt.5 Daniela SammlerSammler, Daniela (2014) weist der Prosodie sogar drei sprachliche Funktionen zu: Die erste ist linguistisch und betrifft die semantische, syntaktische und lexikalische Struktur der Aussage. Die zweite ist „selbstexpressiv“ und von den Emotionen und Einstellungen der Person sowie von der Sprechsituation bestimmt. Die dritte schließlich ist pragmatisch und an bestimmte Sprechakte in einer Kommunikationssituation gebunden (Kritik, Vorschlag, …).
All die Parameter, die unter dem Oberbegriff Prosodie zusammengefasst werden, machen eine Information zu dem, was wir wahrnehmen: Die Prosodie erlaubt es uns, anhand des melodischen, intonatorischen, rhythmischen und akzentuellen Verlaufs eine mit der menschlichen Stimme zum Ausdruck gebrachte Nachricht zu interpretieren, und dies aus inhaltlicher wie auch aus emotionaler Sicht.6 Damit kann die Prosodie als das musikalische Element der (gesprochenen) Sprache bezeichnet werden, als die Musikalität, die einer jeden Sprache, einem jeden Sprecher und einer jeden Sprecherin eigen ist.
Gemeinsamkeiten von Sprache und Gesang
Bis zum Ende des 17. Jahrhunderts taucht das Wort prosodie in französischen Grammatiken nur selten auf.1 Es sind vielmehr die Poeten und besonders die Rhetoriker,2 die sich für die ästhetische und affektvolle vokale Realisierung der Sprache interessieren. Dabei handelt es sich zunächst einmal nicht um freies Sprechen, sondern um die vorbereitete – und damit in einem gewissen Sinne wiederholbare – Realisierung vorformulierter Sätze und Texte.3 Claire Blanche-Benveniste (2010) bezeichnet das hier gemeinte Sprechniveau als eine sorgfältig kontrollierte und zivilisierte, für das öffentliche Reden bestimmte Sprache.4 Lange Zeit bleibt die Prosodie in Frankreich eng mit der art de (bien) parler verbunden.
Pierre de Ramée, genannt RamusRamus, Pierre de, ist der erste französische Grammatiker, der 1572 in seiner Grammaire das Wort prosodie verwendet. Dies geschieht in Gegenüberstellung zur Orthographie: Die Prosodie betrifft die Kunst des Sprechens und die Orthographie diejenige des Schreibens. Beide zusammen bilden die Grammatik.5 Rhythmus und Akzent sind lange Zeit die hauptsächlichen, die Theoretiker der verschiedenen Disziplinen interessierenden Themen. Dabei ist der Begriff rythme, Rhythmus, zunächst einmal gleichbedeutend mit quantité, Quantität, das heißt der Silbenlänge, wohingegen der Akzent eine hauptsächlich melodische Interpretation erfährt. Grammatiker wie Rhetoriker stehen hier in der antiken Tradition: Ein mit einem accent aigu gekennzeichneter Vokallaut wird in Analogie mit der in der griechischen Sprache üblichen melodischen Aufwärtsbewegung als aigu (hoch) bezeichnet, ein Vokal mit einem accent grave markiert infolge seiner melodischen Abwärtsbewegung im Griechischen einen Vokal, dessen Klang grave (tief) ist, und der accent circonflexe entspricht melodisch einer Kombination der beiden vorhergehenden Akzente und benötigt dazu eine Silbe mit einer gewissen Grundlänge oder quantité longue. Doch gegen Ende des 17. Jahrhunderts ist eine Umdeutung des Adjektivs aigu, hoch, spürbar, und der konkrete musikalische Anklang des Begriffspaares hoch–tief wird allmählich von einem Transfer in den Bereich des Vokaltimbres überlagert. Ein Vokal mit einem accent aigu (und besonders der Vokal e) wird nunmehr auch als fermé (geschlossen) und/oder masculin (männlich) bezeichnet und derjenige, der einen accent grave trägt, als ouvert (offen). Diese Tendenz, die sich bei den Autoren der Grammaire générale et raisonnée (ArnauldArnauld, Antoine & LancelotLancelot, Claude, 1660) anbahnt, ist bei François-Séraphin RégnierRégnier-Desmarais, François-Séraphin-Desmarais (1706) und Claude BuffierBuffier, Claude (1709) deutlich spürbar.6 Abbé BoullietteBoulliette, Abbé erklärt schließlich 1760 unmissverständlich, dass der französische Akzent nur in Namen und Schriftbild Ähnlichkeiten mit dem griechischen aufweise, keinesfalls aber in der Ausführung.7 Doch melodisch oder klanglich,8 der Akzent ist in jedem Fall als ein linguistisches, sprachtypisches Element betrachtet.
Zu Beginn des 18. Jahrhunderts bestätigt Jean-Léonor Le Gallois GrimarestGrimarest, Jean-Léonor Le Gallois die Verbindung von sprachlichem und musikalischem Ausdruck in seinem Traité du récitatif (1707). Der Terminus récitatif ist hier nicht mit der Gesangsgattung des Rezitativs zu verwechseln: Er ist direkt von dem Verb réciter (rezitieren) abgeleitet. Laut GrimarestGrimarest, Jean-Léonor Le Gallois bilden die Konversationssprache, das laute Lesen im privaten Kreis, das Sprechen in der Öffentlichkeit (Redner, Anwalt …), die Theaterdeklamation und der Gesang eine Art von Kontinuum. Stufenweise werden die ausdrucksstarken und expressiven Elemente wie das Volumen, die Betonung oder die Akzentuierung gesteigert, so dass der Gesang als letzte Stufe alle vorherigen Sprecharten enthält, aber durch die ihm eigenen zusätzlichen Ausdrucksfähigkeiten in besonderer Weise Gefühle übermittelt und hervorruft. Vokalmusik ist damit laut GrimarestGrimarest, Jean-Léonor Le Gallois „eine Art von Sprache“.9 Der Komponist kann als ein traducteur, ein Übersetzer angesehen werden, der Gedanken und Gefühle mittels seiner Kunst auszudrücken versteht.
Dass diese Bemerkung durchaus wörtlich zu nehmen ist, zeigt der bekannte Bericht, nach dem der Komponist Jean-Baptiste LullyLully, Jean-Baptiste seine Melodien genau nach der Sprechart der berühmten Schauspielerin Marie Desmares (1642-1698), genannt La Champmeslé, formte.10 Noch am Ende des 18. Jahrhunderts bestätigt André-Ernest-Modeste GrétryGrétry, André-Ernest-Modeste (1789) die Effizienz eines derartigen Kompositionsverfahrens: Für ihn gehört das Studium der Deklamation zum unabdingbaren Handwerkszeug des Komponisten.11
Knapp achtzig Jahre nach GrimarestGrimarest, Jean-Léonor Le Gallois und etwa zur selben Zeit wie GrétryGrétry, André-Ernest-Modeste bezeichnet Etienne de LacépèdeLacépède, Etienne de (1785: 32) die Musik als „la vraie langue des passions“, die wahre Sprache der Gefühle, eine Sprache, die mehr berührt als die gesprochenen Worte,12 und dies, da sie die klingenden und musikalischen Laute – das heißt die Vokale – in den Vordergrund stellt. Der gesangliche Anteil der Sprache ist damit der Kontinuität der Klänge gleichgesetzt. Noch der Grammatiker Napoléon LandaisLandais, Napoléon betont zu Beginn des 19. Jahrhunderts, dass die prononciation soutenue, der gewählte und eingeübte Vortrag, eine „Art von Gesang“ ist, in dem Stimmmodulation und Silbenlänge notiert sind.13
Mischformen
Heute erinnert an diese Gemeinsamkeit die Technik des 1897 von Engelbert Humperdinck begrifflich eingeführten und besonders seit der Wiener Schule (zum Beispiel bei Arnold Schönberg und Alban Berg) entwickelten Sprechgesangs,1 bei der sich Sprech- und Gesangsstimme einander annähern. Dazu werden feste Parameter wie ein exakter Rhythmus oder eine genaue Tonhöhe für die Sprechstimme fixiert, die damit Allusionen an die Gesangsstimme erhält. Für den Vortragsstil der Grande Dame des französischen Chansons, Juliette Gréco (1927-2020), sind effektvoll eingesetzte Passagen im Sprechgesang typisch (Wicke, 2016). Bei einer im März 2021 durchgeführten Umfrage zum französischen Chanson, an der sich 35 Personen mit französischer Muttersprache und 53, für die das Französische nicht ihre Muttersprache darstellt, beteiligten, bezeichneten die Befragten ihre Eindrücke der Stimme französischer Chansonniers wie folgt (Tabelle 1, vgl. auch Bsp. 1):
Gesangsstimme
Beinahe gesungen
Zwischen Singen und Sprechen
Eher gesprochen
Georges Brassens („Le bricoleur“, 1956)
23
21
33
8
Léo Ferré („Les Corbeaux“, 1964)
9
17
33
24
Maxime Le Forestier („San Francisco“, 1972)
65
12
2
5
Alain Bashung („Jamais d’autres“, 2002)
1
3
62
16
Eindrücke zur verwendeten Stimmart in französischen Chansons (Umfrage März 2021)
Ein signifikanter Unterschied der Wahrnehmung bei den muttersprachlichen und nicht-muttersprachlichen Personen ist nicht festzustellen. Neben klaren Tendenzen (gut 77 % bewerten die Stimme Maxime Le ForestierLe Forestier, Maximes2 als Gesang und weitere 14 % als „beinahe gesungen“, während nur eine Person für Alain BashungBashung, Alain3 von Gesang und drei Personen von „beinahe gesungen“ sprechen) ist auffällig, dass oftmals eine genaue Zuordnung schwierig erscheint, und dies unabhängig von der jeweiligen Muttersprache oder der Tatsache, dass Sänger und/oder Chanson bekannt oder unbekannt sind. Georges BrassensBrassens, Georges4 spricht nicht, aber wie weit seine Stimme sich dem Gesang nähert, scheint nicht eindeutig zu sein: 21 Personen bezeichnen seinen Chansonvortrag als „beinahe gesungen“ und 33 als „zwischen Singen und Sprechen“. Bei Léo FerréFerré, Léo5 und Alain BashungBashung, Alain tendieren die Befragten zu einer von der Sprechstimme zumindest deutlich geprägten Ausdrucksweise: Für FerréFerré, Léo wählen insgesamt 69 % die Antwort „zwischen Singen und Sprechen“ und „eher gesprochen“,6 bei BashungBashung, Alain sind es sogar 92 %. Die unterschiedlichen Eindrücke erklären sich ebenso durch verschiedene persönliche Wahrnehmungen wie durch unterschiedliche Erwartungen oder sogar Definitionen für eine Gesangsstimme. Wir haben hier einen weiteren Beweis für die fließenden Grenzen zwischen den Gattungen.
1.2 Das musikalische Ausdruckspotential der Sprechstimme
Für die Wahrnehmung von Sprache und Musik mobilisiert das menschliche Gehirn ähnliche Erkennungs- und Verarbeitungsprozesse. Laut Emmanuel BigandBigand, Emmanuel und Barbara TillmannTillmann, Barbara (2020) wird Sprache vom Embryo im Mutterleib wie eine musikalische Tonfolge wahrgenommen, und Musikhören bereitet seine zukünftigen sprachlichen Kompetenzen vor. Diese Aussagen beziehen sich zunächst einmal auf die strukturellen Ähnlichkeiten von Sprache und Musik,1 denen dieselben Gliederungs- beziehungsweise Sequenzierungsmuster zugrunde liegen: Minimaleinheiten kombinieren sich in sprachlichen oder musikalischen Sequenzen, die dann durch Variationen von Dynamik, Tonhöhe, Intonation und/oder Rhythmus modelliert werden.2 Dies Phänomen spricht zu Beginn des 19. Jahrhunderts bereits der Musiktheoretiker Jérôme Joseph de MomignyMomigny, Jérôme-Joseph de (1806) an, für den die Musik aufgrund der Tatsache, dass sie ein ihr eigenes System besitzt, eine eigene Sprache darstellt.
Neuere Untersuchungen haben gezeigt, dass Musik, ebenso wie Sprache, semantische Prozesse beeinflussen und die Bedeutung eines Wortes bestimmen kann. In einer Studie mit 122 Versuchspersonen konnten Stefan Koelsch et al. (2004) zeigen, dass die Reaktionen auf in gesprochenen Sätzen oder in Verbindung mit musikalischen Auszügen präsentierte Zielwörter weder signifikante Unterschiede im Verhalten noch in den Auswertungen der N400-Komponente des ereignisbezogenen Gehirnpotentials (ERP) aufzeigen.3
Doch nicht nur die Kognitionswissenschaften, sondern auch Psychologen und Linguisten interessieren sich vermehrt für das Studium der Kommunikation von Emotionen durch bestimmte Verhaltensmuster, Gesten, Stimm- und Sprachmodulationen,4 von denen besonders die letzteren für diese Studie interessant sind.
Kodifikation der Emotionen
Häufig werden die durch Emotionen ausgelösten Stimm- und Sprechmodulationen anhand von Aufnahmen mit Schauspielern studiert.1 Damit stehen Untersuchungen wie die Studie zur Prosodie de l’émotion von Tanja Bänzinger (Bänzinger et al., 2002) in direkter Weise in der alten Tradition der Rhetoriker. Schon die antiken Autoren formulieren Regeln, nach welchen die Ausdruckskraft der Stimme geformt werden kann. Laut CiceroCicero, Marcus Tullio ist eine wohlklingende Stimme das wichtigste Instrument des Redners. Die musikalische Metapher ist bereits angelegt, wenn CiceroCicero, Marcus Tullio erklärt:
Jede Gemütsbewegung hat von Natur ihre eigentümlichen Mienen, Töne und Gebärden, und der ganze Körper des Menschen und alle seine Mienen und Stimmen ertönen, gleich den Saiten der Lyra, so, wie sie jedes Mal von der Gemütsstimmung berührt werden. Denn die Töne sind, wie die Saiten, gespannt, so dass sie jeder Berührung entsprechen: hohe und tiefe, schnelle und langsame, starke und schwache; zwischen allen diesen liegt in jeder Art noch ein Mittelton. Und noch mehrere Unterarten sind aus diesen entstanden: der sanfte und der rauhe Ton, der gepreßte und der gedehnte, der mit gehaltenem und der mit abgestoßenem Atem hervorgestoßene, der stumpfe und der kreischende, der durch Beugung der Stimme entweder verdünnte oder angeschwellte. (CiceroCicero, Marcus Tullio [1873]: 299)
Die Stimme als Spiegel der Gemütsbewegung wird zu einem zentralen Thema in den an Schauspieler gerichteten französischen Texten der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts. Die Autoren sprechen ausführlich von den accents des passions, und jeder Emotion sind auf die Beobachtung realer Sprechsituationen zurückgehende,2 bestimmte stimmliche Attribute zugeordnet. Die Stimme des Traurigen ist sourde (dumpf, klanglos), languissante (schleppend), plaintive (klagend) und von häufigen Seufzern unterbrochen; diejenige des Zornigen ist aiguë (hoch, schrill), impétueuse (ungestüm) und violente (heftig) mit häufigen Atempausen. Freude macht die Stimme pleine (voll), gaie (munter) und coulante (fließend). Die Liste der kodifizierten Passionen kann problemlos fortgesetzt und die hier nach Le GrasLe Gras (1671) und Michel Le FaucheurLe Faucheur, Michel (1676) zitierten Attribute können mit Synonymen und ähnlichen Formulierungen anderer Autoren erweitert werden.3
Die Analyse der vokalen Mittel, die zum ausdrucksvollen Vortrag einer bestimmten Textstelle eingesetzt werden, war früher wie heute ein Mittel, um die vokale Übermittlung von Emotionen zu stilisieren und zu kodieren. Wenn früher allein das Ohr zur Beschreibung der Stimmmodulation eingesetzt werden konnte, so existieren heute neben Aufnahme und anschließender Reproduktion zusätzliche technische Analysemittel. Die Ergebnisse der auf der Basis dieser Möglichkeiten entwickelten Methode zur Studie der emotionsmotivierten Prosodie von Bänzinger et al. (2002) können, so die Autoren, für die vokale Synthese genutzt werden können. Am Anfang steht eine akustische Analyse der segmentierten phonetischen Einheiten, gefolgt von der Berechnung der Mittelwerte der verschiedenen akustischen Parameter (die Grundfrequenzen f°, Tondauern sowie verschiedene Verteilungs- und Proportionswerte). Zur Beschreibung der Intonation werden anschließend die Konturen der Kurven der Grundfrequenzen f° und der Energie stilisiert.
Die zur Studie der durch die Stimme ausgedrückten Emotion untersuchten Parameter entsprechen – wieder einmal – der „Musik der Sprache“, und der gewählte Ansatz erhält eine sinnvolle Begründung durch die Arbeiten im Bereich der Kognitionswissenschaft. Laut Brück et al. (2013: 265-266) scheint die Verarbeitung der emotionalen Prosodie im Gehirn einen doppelten Weg von der Signalaufnahme bis zur Verhaltenskontrolle einzuschlagen: Die explizite Sprachverarbeitung erfolgt in den frontalen Hirnregionen in drei Schritten, von denen jeder eine spezifische Aufmerksamkeitsfokussierung erfordert:
Die spezifischen akustischen Merkmale der emotionalen Prosodie werden herausgefiltert,
Die emotionalen Inhalte werden durch die Integration prosodischer Informationen der analysierten Aussage und anderer Kommunikationskanäle sowie durch Abgleich mit Assoziationen kompatibler Gedächtnisinhalte identifiziert,
Art und Ausprägung verschiedener, im analysierten Signal enthaltener Emotionen werden evaluiert.
Gleichzeitig werden die impliziten Signale auf einem schnelleren Weg, der Induktion emotionaler Reaktionen, in den limbischen und paralimbischen zerebralen Strukturen verarbeitet. Eine forcierte, den expliziten Sprachinhalten gewidmete Aufmerksamkeit kann allerdings die limbischen, emotionalen Strukturen hemmen „und somit zu einer Unterdrückung impliziter Verarbeitungsprozesse führen“ (Brück et al., 2013: 266). In diesem Zusammenhang ist interessant, dass das limbische System, das die impliziten Signale der emotionalen Prosodie verarbeitet, in besonderer Weise durch Musik angeregt wird. Wie Emmanuel BigandBigand, Emmanuel und Suzanne Filipic (2008) zeigen konnten, erfolgen die kognitiven Reaktionen, die emotionellen Antworten auf musikalische Ereignisse entsprechen, normalerweise unverzüglich, von der ersten Hunderstelsekunde der Wahrnehmung an, und dies bei musikalisch gebildeten oder unbedarften Versuchspersonen sowie für bekannte oder unbekannte musikalische Werke gleichermaßen.4 Die These, dass wir auf die Intonation der Sprechstimme wie auf eine fröhliche, traurige, melancholische oder anregende Melodie reagieren, und dass damit Melodien oder Intonationskurven stilisiert werden können, die automatisch und unbewusst bestimmten Emotionen zugeordnet werden, ist von Forschern wie Iván FónagyFónagy, Ivan untersucht worden.
1.3 Notation von Prosodie und Musik
Stilisierte Intonationskurven wie die oben von Bänzinger et al. angesprochenen, werden heute in Form von Diagrammen dargestellt. Bei diesen Autoren sind die beiden Diagrammachsen den Parametern Tonhöhe (y-Achse) und zeitlicher Verlauf (x-Achse) zugeordnet. Die einzelnen Punktwerte sind mit einer durchgängigen Linie derart verbunden, dass eine Kurve entsteht, die an eine melodische, in einer Partitur notierte melodische Linienführung erinnert (in der man sich ebenfalls die Notenköpfe durch eine Linie verbunden vorstellt), und in der die fünf Notenlinien vertikal den Tonhöhen entsprechen und horizontal den zeitlichen Verlauf wiedergeben. Dies ist nicht etwa ein ausschließlich auf moderne Gewohnheiten zurückgehender Eindruck eines Betrachters oder einer Betrachterin des 21. Jahrhunderts: Die Möglichkeiten der musikalischen Notation faszinierten die französischen Sprachtheoretiker bereits seit Langem. Besonders in den Bereichen Intonation und Melodie bildete die musikalische Partitur jahrhundertelang ein dankbares Medium für die Visualisierung von Höreindrücken, deren Vorteil zweifellos war, dass ein großer Teil der Bevölkerung (zumindest derjenige, der auch in der Lage war, Grammatiken und phonetische Texte zu lesen) sie beherrschte und zu entziffern verstand. Heutige Leser, Leserinnen, Forschern und Forscherinnen sind hier gegenüber den Zeitgenossen und Zeitgenossinnen der Autoren vergangener Jahrhunderte im Nachteil: Die jeweils gewählte Darstellung erschließt sich oft nur dann vollständig, wenn man die Notationsgewohnheiten der jeweiligen musikalischen Epoche und die dort vorherrschende Musikästhetik gut kennt.
Verwendung einer traditionellen Partitur
Zum Thema Intonation können zwei Notationsstränge unterschieden werden. Der Erste verwendet eine tatsächliche Partitur mit fünf Notenlinien, Noten mit Köpfen und Hälsen (oder notenähnlichen Figuren), sowie mit einem Notenschlüssel. Letzterer ermöglicht durch die Angabe realer Bezugstöne die Bestimmung der jeweiligen Tonhöhe und der Stimmlage der sprechenden Person.1 Rhythmische Details sind dabei, je nach Autor, mehr oder weniger relevant.
Ein bekanntes Beispiel für diesen Typ bilden – für das Französische – die Transkriptionen von Iván FónagyFónagy, Ivan und Klara MagdicsMagdics, Klara (1963). Tonhöhen und –dauer sind hier so in einem traditionellen Notensystem notiert, dass ein direkter melodischer Vergleich von Sprache und Vokalmusik möglich wird. Jeder Silbe entspricht eine genau festgelegte Note. Die gewählten Notenwerte (hauptsächlich Achtel und Sechzehntel) entsprechen nach dem heutigen Code einem schnellen Grundtempo. Dieses Tempo ist zu Beginn des Notenbeispiels durch eine Metronomangabe genau spezifiziert. Akzentzeichen ( > ) markieren die hervorgehobenen Silben (vgl. Bsp. 2).
Die Notationsmethode von Félix KahnKahn, Félix übernimmt Elemente, wie sie die Komponisten zeitgenössischer Musik vorsehen, um die gewünschten Details so genau wie möglich unter Beibehaltung der grundsätzlichen Elemente des traditionellen Notensystems zu notieren (vgl. Bsp. 3). KahnKahn, Félix verwendet ein System mit fünf Linien, verzichtet aber auf einen Notenschlüssel. Jeder Silbe des zunächst in normaler Orthographie sowie in einer zweiten Reihe in Lautschrift notierten Textes sind ein oder, bei Bedarf, mehrere notenkopfähnliche schwarz ausgefüllte Kreise zugeordnet. Die unterschiedliche Größe dieser Kreise gibt eine minimale Längung (großer Kreis) oder Kürzung (kleiner Kreis) im Verhältnis zur mittleren Dauer eines Klanges (mittlerer Kreis, wie eine gewöhnliche Viertelnote) an. Ein + (höher) oder ein – (tiefer) Zeichen vor der Note dient zur Angabe der Tonhöhe in Vierteltongenauigkeit.2 Die notierte Tonhöhe entspricht so genau wie möglich der reellen Frequenz des Vokals zum Zeitpunkt seiner höchsten Intensität.3
Auch wenn die musikalischen Beispiele, die Louis MeigretMeigret, Louis in seiner Grammatik von 1530 wählt (vgl. Bsp. 4), scheinbar eine analoge Lesart erlauben, so haben doch verschiedene neuere Studien gezeigt, dass sich die von ihm gewählte Notationsform nur auf der Basis der in der Renaissance üblichen Notation musikalischer Werke verstehen lässt.4 Nur zwei Tonhöhen alternieren in jedem Beispiel. Die jeweils höhere Note wird heute unterschiedlich entweder als melodischer Akzent interpretiert (eine Lesart, die dem Notenbeispiel eine direkte visuelle Abbildungskraft zuspricht), oder aber, globaler, als Akzent, der durch verschiedene Parameter (Tonhöhe, -dauer und Intensität) realisiert werden kann. Die den späteren Taktstrichen entsprechenden Längsbalken in den Notenbeispielen MeigretMeigret, Louiss zeigen bei dem Grammatiker noch keine metrischen Betonungsmuster an, sondern teilen den unterlegten Text in grammatikalische Einheiten (wie „Les Constantineopoliteins“, „en sa conservation“). Die verschiedenen gewählten Schlüssel bringen möglicherweise durch eine abweichende Grundtonhöhe einen emotionalen Hintergrund zum Ausdruck und haben damit eine semantische Funktion (Schweitzer, 2022).
Wenn die kleinen (schnellen) Notenwerte bei Ivan FónagyFónagy, Ivan und Klara MagdicsMagdics, Klara – und auch per Assoziation an die Viertelnote bei Félix KahnKahn, Félix – für heutige Leser und Leserinnen ein schnelles Tempo assoziieren, so ist dies bei dem (einzigen), von MeigretMeigret, Louis gewählten Wert, die der heutigen Halben Note ähnelnden Minima, nicht unbedingt der Fall. Die Renaissance verwendet als Basis die sogenannte notation blanche, das heißt weiße, nicht geschwärzte Notenköpfe (vgl. Bsp. 5). Von ca. 1485 bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts ist die Semibrevis der rhythmische Bezugswert. Wenn sie im Aussehen auch an unsere heutige Ganze Note erinnert, so entspricht das mit ihr verbundene Tempogefühl eher dem einer Viertelnote. Die Minima (die im Aussehen an die heutige Halbe Note erinnert) ist damit bereits ein schneller Notenwert (und vergleichbar mit der Achtelnote in moderner Notation).5 Der Blick in die 42 den Amours von Pierre de RonsardRonsard, Pierre de in den Ausgaben von 1552 und 1553 angefügten Vertonungen verschiedener Komponisten6 zeigt, dass trotz der selbstverständlichen Verwendung verschiedener Notenwerte in allen Kompositionen die Minima oder Halbe Note als Basisnotenwert für das Gerüst gewählt ist. Semiminima (Viertel) entsprechen kurzen ornamentalen Melismen, und Semibrevis (Ganze Noten) Kadenzen und Zielnoten. MeigretMeigret, Louis verwendet hier denselben „Notationscode“ wie die Komponisten, die mit den Autoren der im Jahre 1570 gegründeten Académie de poésie et de musique zusammenarbeiteten (vgl. Bsp. 6).
Jede musikalische Stilepoche bietet damit den Sprachtheoretikern eigene, im Großen und Ganzen vergleichbare, aber im Detail doch differenzierbare Möglichkeiten, prosodische Parameter mit den Mitteln der üblicherweise verwendeten Partitur zu visualisieren.
Stilisierte Formen
Eine zweite Gruppe von Abbildungen nutzt ebenfalls das musikalische System, verzichtet aber auf Notenzeichen. Dieses Verfahren haben in Frankreich die ersten Phonetiker des 19. Jahrhunderts entdeckt und genutzt, um entweder extrem genaue Angaben machen zu können (RousselotRousselot, Jean-Pierre, 1897; RoudetRoudet, Léonce, 1899; vgl. Bsp. 7), oder aber, in einer freieren Auslegung (Linie anstelle von Notenköpfen), um den kontinuierlichen Verlauf der Sprachmelodie zu akzentuieren (MarichelleMarichelle, Hector, 1897, vgl. auch Bsp. 8).
Im ersten Fall ist das traditionelle Notensystem an die Bedürfnisse der Phonetiker angepasst. Bei RousselotRousselot, Jean-Pierre entspricht jede Linie des Systems (und damit auch jeder Zwischenraum) einem Halbton, und nicht etwa einer festgelegten Folge von Ganz- und Halbtönen. Diese Änderung ermöglicht sicherlich das Lesen des Schemas für musikalische Laien, sie hat aber auch in besonderer Weise Einfluss auf den entstehenden Verlauf der melodischen Linie, die nunmehr die realen akustischen Vorgänge direkt, ohne Umweg über die Musiktheorie (das heißt, zumindest die Kenntnis der diatonischen Tonleiter), abbildet.
Bei Léonce RoudetRoudet, Léonce wie auch bei RousselotRousselot, Jean-Pierre sind die experimental gewonnenen Tonhöhen pro Silbe oder Phonem mittels einer mehr oder weniger gerundeten Linie verbunden. Der optische Eindruck ist der einer kontinuierlichen Stimmgebung, wobei die Tonhöhenentwicklung gewissermaßen stufenweise von einer Note zur nächsten erfolgt. Hector MarichelleMarichelle, Hector dagegen verzichtet auf die Angabe einzelner Tonhöhen. Seine Transkription in Form von durchgängigen Kurven hat zum Ziel, auf die kontinuierlichen und glissandoartigen (gleitenden) Intonationsvariationen hinzuweisen, die laut MarichelleMarichelle, Hector typisch für die Sprechstimme sind, und damit ein Unterscheidungsmerkmal von Sprache und Gesang (Musik) bilden.1 Trotz dieses nunmehr klar herausgearbeiteten Unterschieds von Sprache und Gesang bleibt MarichelleMarichelle, Hector dem Notensystem treu: Es bildet weiterhin einen festen Bezugspunkt, und selbst der Notenschlüssel ist bei ihm vorhanden.2
Der das graphische System in Ganz- und Halbtöne einteilende Notenschlüssel verschwindet in dem bekannten, von Pierre DelattreDelattre, Pierre (1966) gewählten System, das trotz der Reduzierung von fünf auf vier Linien deutlich an die musikalische Partitur erinnert. Bei DelattreDelattre, Pierre dienen die in dieses System gezeichneten Kurven der Schematisierung der zehn hauptsächlichen, im Französischen gebräuchlichen Intonationsmuster (siehe Tabelle 2).
Niveau 2 - 4+
Entscheidungsfrage
Question
Niveau 2 - 4
Integrierende Weiterweisung
Continuation majeure
Niveau 2 - 4_
Implikatur
Implication
Niveau 2 - 3
Nicht-integrierende Weiterweisung
Continuation mineure
Niveau 4 - 4
Hohe Nichtverweisung
Écho
Niveau 1 - 1
Tiefe Nichtverweisung
Parenthèse
Niveau 2 - 1
Aussage
Finalité
Niveau 4 - 1
Ergänzungsfrage
Interrogation
Niveau 4 - 1
Befehl
Commandement
Niveau 4 - 1
Ausruf
Exclamation
Die 10 Basis-Intonationen des Französischen nach Pierre DelattreDelattre, Pierre (1966). Deutsche Übersetzung nach Wunderli (1981)
Ergänzungsfrage, Befehl und Ausruf durchschreiten dieselben Niveaustufen (4–1), haben aber verschieden ausgeprägte Melodieverläufe (vgl. Bsp. 9a). Die vier Linien entsprechen bei DelattreDelattre, Pierre nicht mehr bestimmten Einzeltonhöhen, sondern Sprechniveaus. Sie bieten weiterhin einen Bezugspunkt und helfen beispielsweise, ähnliche Melodieformen, wie etwa die Aussage (abfallend von Niveau 2 auf Niveau 1) vom Ausruf (abfallend von Niveau 4 auf Niveau 1) zu unterscheiden (vgl. Bsp. 9b). Es handelt sich damit um eine „kombinierte Kontur-Niveau-Darstellung“ (Wunderli, 1981). Der visualisierte prosodische Parameter ist vor allem intonatorischer Natur.
Die melodische Bewegung der von DelattreDelattre, Pierre stilisierten Intonationsfloskeln ist auf den ersten Blick verständlich und interpretierbar. So entsprechen zum Beispiel in der Folge „Jean-Marie/va manger? malgré tout?“ sowohl die erste als auch die zweite Einheit („Jean-Marie/va manger?“) Aufwärtsbewegungen, während die dritte Einheit („malgré tout?“) auf einem hohen Niveau beharrt. Damit ist der melodische Verlauf annäherungsweise vorstellbar. Das genaue Studium zeigt anhand der Formen und angegebenen Sprechniveaus, dass es sich zunächst um eine continuation mineure oder nicht-integrierende Weiterweisung (2–3) handelt, die im Text durch den Slash ( / ) verdeutlicht ist. Das zweite und dritte Element sind durch eine continuation majeure oder integrierende Weiterweisung (2–4) verbunden und die Folge schließt mit einer hohen Nichtverweisung (écho, 4–4).3
Wenn die Diagramme und Schaubilder, wie sie die gängigen Programme wie Praat, Prosogramme, Winpitch oder ToBI zur Analyse von Grundfrequenz und Intonation generieren, auch deutlich an Abstraktion gewonnen haben, so bleibt doch die Assoziation einer Tonfolge, wie sie in einer musikalischen Partitur dargestellt wird, lebendig.4 Sie kommt übrigens automatisch zum Einsatz, wenn die generierten Skripte, wie von Jörg Mayer (2017) gefordert, mit dem Höreindruck verglichen werden („Stimmt der Höreindruck (steigender/fallender/gleichbleibender Stimmton) mit der ermittelten F0-Kontur überein?“ Mayer, 2017: 93).





























