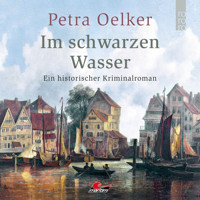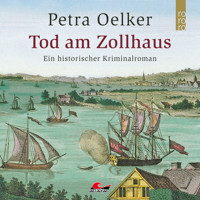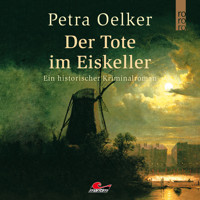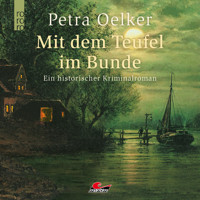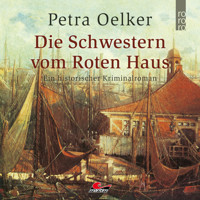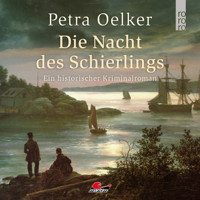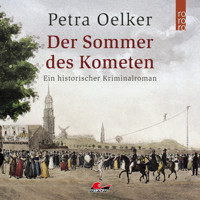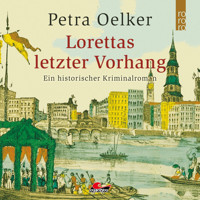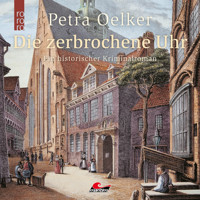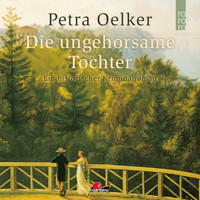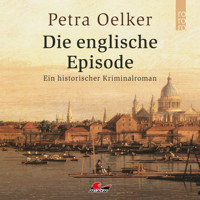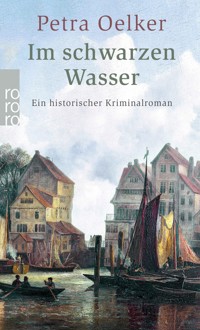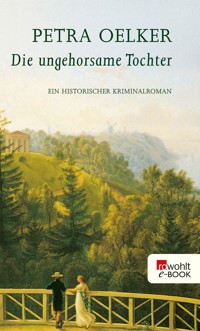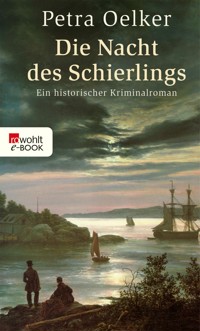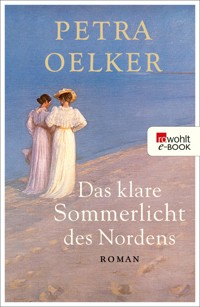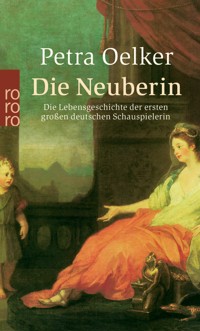
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
"Ein Kapitel Kulturgeschichte." (FAZ) Friederike Caroline Neuber wird 1697 als Bürgertochter geboren. Sie entflieht ihrer engen Welt und schliesst sich einer Gruppe von Wanderkomödianten an. Schon nach wenigen Jahren gilt sie als beste Schauspielerin Deutschlands. Als Prinzipalin wird sie gegen alle Widerstände zur Pionierin der deutschen Theaterkunst. Caroline Neuber ist die historische Vorlage für die Figur der Rosina in Petra Oelkers historischen Romanen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 186
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Petra Oelker
Die Neuberin
Die Lebensgeschichte der ersten großen deutschen Schauspielerin
Über dieses Buch
«Ein Kapitel Kulturgeschichte.» (FAZ)
Friederike Caroline Neuber wird 1697 als Bürgertochter geboren. Sie entflieht ihrer engen Welt und schließt sich einer Gruppe von Wanderkomödianten an. Schon nach wenigen Jahren gilt sie als beste Schauspielerin Deutschlands. Als Prinzipalin wird sie gegen alle Widerstände zur Pionierin der deutschen Theaterkunst.
Caroline Neuber ist die historische Vorlage für die Figur der Rosina in Petra Oelkers historischen Romanen.
Vita
Petra Oelker arbeitete als Journalistin und Autorin von Sachbüchern und Biographien. Mit «Tod am Zollhaus» schrieb sie den ersten ihrer erfolgreichen historischen Kriminalromane um die Komödiantin Rosina, zehn weitere folgten. Zu ihren in der Gegenwart angesiedelten Romanen gehören «Der Klosterwald», «Die kleine Madonna» und «Tod auf dem Jakobsweg». Zuletzt begeisterte sie mit «Das klare Sommerlicht des Nordens», «Emmas Reise» sowie dem in Konstantinopel angesiedelten Roman «Die Brücke zwischen den Welten».
Impressum
Der vorliegende Band ist eine Neufassung von «Nichts als eine Komödiantin» (Erstveröffentlichung 1993).
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, November 2024
Copyright (c) 2004 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
Covergestaltung any.way, Cathrin Günther
Coverabbildung (Abbildung: Hogarth)
ISBN 978-3-644-52541-2
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Vorwort
«Lieber Leser. Hier hast du was zu lesen. Nicht etwa von einem grossen gelehrten Manne; Nein! Nur von einer Frau, deren Namen du außen wirst gefunden haben, und deren Stand du unter den geringsten Leuten suchen musst: Denn sie ist nichts, als eine Comödiantin …»
So beginnt die Theaterprinzipalin Friederike Caroline Neuber, nach der Sitte ihrer Zeit «die Neuberin» genannt, im Juni 1734 in Leipzig ihre Vorrede zu einem allegorischen Spiel um die Wandlung des derben Hanswurst, das Theatergeschichte machen wird. Schon diese ersten Zeilen verraten ihre Stellung in der Männerwelt und der noch strikt ständisch gegliederten Gesellschaft ihrer Zeit. Trotzdem: Wenn sie behauptet, «nichts als eine Comödiantin» zu sein, untertreibt sie in koketter Bescheidenheit.
Schauspieler, insbesondere Schauspielerinnen, gehörten im 18. Jahrhundert tatsächlich zu ‹den geringsten Leuten›, doch die Neuberin war in jenem Jahr schon eine Berühmtheit, als Schauspielerin und als Dichterin, als Theaterreformerin und als ebenso eigenwillige wie strenge Prinzipalin. Sie ist die erste Frau, die eine Theatergesellschaft leitet, ohne sie nur von ihrem Ehemann «geerbt» zu haben. Ihre Truppe gehört zu den besten im Land; wo immer sie ihre Bretterbühne aufbaut, wird sie zum Stadtgespräch – bis in die Salons und Studierstuben der Bürger, der «aufgeklärten» Gelehrten und auch der Residenzen. Das Deutsche Vorspiel, dessen von den Leipzigern mit Spannung erwartete Premiere sie an jenem Juniabend ankündigte, war so etwas wie ein in Verse gesetztes Manifest ihrer Theaterarbeit und dokumentierte zugleich den Kampf mit ihren Widersachern, allen voran mit dem nicht minder berühmten Hanswurst-Darsteller Joseph Ferdinand Müller.
Die Frau Neuberin fiel aus dem gewohnten Rahmen, nicht nur, weil sie – «nur eine Frau» – ein verändertes, ein «gereinigtes» Theater bot. Anders als die meisten Wanderschauspielerinnen war sie auch nicht «auf dem Theaterkarren geboren» worden, sie stammte aus bürgerlichem Haus, sie war gebildet und zeigte schon als Mädchen einen «männlichen Charakter», womit damals Mut, Stolz, Selbstbewusstsein und Durchsetzungskraft gemeint waren. Unerlässliche Charakterzüge auf dem Weg zu einem großen Ziel, die ihr jedoch – im Verbund mit ihrem heftigen Temperament – auch viele Feinde machten.
Friederike Caroline Neuber, geboren 1697 im sächsischen Reichenbach als Tochter des Gerichtsinspektors Daniel Weißenborn und dessen stiller Frau Anna Rosine, war kein aufregendes Leben vorherbestimmt. Ein halbwegs behagliches Dasein in bescheidenem Wohlstand, mit Gottes Hilfe einen braven Gatten, gesunde Kinder und ein langes Leben – das war es, was ein Mädchen ihres Standes erwarten konnte. Doch sie floh aus ihrer engen Welt, schloss sich mit dem Studenten Johann Neuber einer Truppe von Wanderkomödianten an und galt schon nach wenigen Jahren als eine der besten Darstellerinnen Deutschlands. Als Prinzipalin verfolgte sie beharrlich und gegen alle Widerstände des Zeitgeistes und der auch über das Theater herrschenden Männerwelt ihr Lebensziel: die Reformierung des derben Stegreif- und Hanswursttheaters zur anspruchsvollen, zur «geregelten» Komödie und Tragödie. Sie hat sich zwischen alle Stühle gesetzt, wurde heute gefeiert, morgen verlacht und geschmäht, ihr Leben war reich an Triumphen wie an Niederlagen, an Freundschaft wie an Verrat.
Es stimmt, sie hat ihr Ziel nicht erreicht. Auch mögen ihre letzten Jahre oft bitter gewesen sein. Doch der Stolz auf ihre Arbeit und der Glauben an ihre Ziele haben sie nie verlassen.
Und zumindest für die ihr nachfolgende Generation der Theater-Enthusiasten blieb sie die bewunderte Künstlerin und Frau mit dem Mut zu Veränderung und Individualität. Schon in Wilhelm Meisters theatralischer Sendung, der 1777 begonnen Urfassung für den großen Gesellschafts- und Bildungsroman Wilhelm Meisters Lehrjahre (1795/96), gibt der junge Johann Wolfgang Goethe der Madame Melina Charakter und Schicksal der jugendlichen Friederike Weißenborn. Woher, von wem er davon wusste, ob er gar die Gerichtsakten kannte, ist ungewiss, doch er schildert die dramatischen Ereignisse mit großem Respekt für das Mädchen unverkennbar nach der Realität. Der Charakter der älteren, der Prinzipalin F.C. Neuber ist in der Endfassung des Romans in der Theaterdirektorin, der «Directrice» Madame de Retti, zu erkennen.
Heute, gut 240 Jahre nach ihrem Tod am 29. November 1760, ist Friederike Caroline Neuber beinahe vergessen. Zu Unrecht, denn als eine der wichtigsten Persönlichkeiten der frühen deutschen Theatergeschichte hat sie den Boden für das Theater der deutschen Klassik mit bereitet und die darstellende Kunst maßgeblich weiterentwickelt.
So ist das Abenteuer ihres Lebens nicht nur ein Spiegel ihrer Zeit, sondern zugleich eine Parabel für den Aufbruch des Theaters zur anerkannten bürgerlichen Institution. Es erzählt auch vom frühen Kampf der Frauen um ihre eigenen Ideale, um Selbstbestimmung und Führungspositionen.
Als ich mit der Recherche zu diesem Buch begann, wusste ich gerade genug über diese ungewöhnliche Frau und ihre Zeit, um neugierig zu werden. Nun weiß ich mehr, doch die Neugier ist immer noch lebendig. Das 18. Jahrhundert, das bewegte Zeitalter der Aufklärung, ist eine aufregende Epoche, in der jüngeren Kulturgeschichte vielleicht die aufregendste. Nachdem das Buch geschrieben war, blieben viele Bilder im Kopf, ließ sich die aufgeregte Phantasie nicht einfach abschalten, das Thema nicht zu den Akten legen. Dazu ist es viel zu spannend. Und so habe ich das Genre gewechselt, die Neuberin, ihre Erfahrungen und ihre Zeit wurden zur Grundlage für eine Reihe von historischen Romanen. Deren Heldin trägt den Namen Rosina – eine kleine Reverenz an Anna Rosine Weißenborn, die Literatur liebende früh verstorbene Mutter der Friederike Caroline Neuber.
Dies ist nur ein kleines Buch, es ist erstmals 1993 erschienen und kann trotz der aktuellen Überarbeitung nicht den Anspruch erheben, eine allumfassende Studie zu sein. Zur ergänzenden und vertiefenden Lektüre lege ich Ihnen unbedingt die beiden von Bärbel Rudin und Marion Schulz in der Schriftenreihe des Neuberin-Museums in Reichenbach herausgegebenen Bücher ans Herz, in denen zahlreiche Stücke, Gedichte und Schriften der Neuberin mit erläuternden Texten nach dem neuesten wissenschaftlichen Stand veröffentlicht sind: Friederike Caroline Neuber. Das Lebenswerk der Bühnenreformerin – Poetische Urkunden 1. und 2. Teil.
Petra Oelker
Hamburg, im März 2004
Fromme Wünsche
TAUFE IN REICHENBACH. Viel Volk drängt sich in der matten Frühlingssonne an diesem 9. März 1697 durch das Hauptportal der Peter-Paul-Kirche. Unter dem hohen Kreuzgewölbe des Gotteshauses ist es kalt. In den ersten Bankreihen, nahe dem Altar, sitzt in warme Tücher gehüllt die feine Gesellschaft der kleinen sächsischen Stadt. Zu diesem Gottesdienst zu erscheinen ist nicht nur ein Gebot der Neugier und der Frömmigkeit, Erscheinen ist heute gesellschaftliche Pflicht. Der Erb- und Lehnsherr, der hochedel geborene Adam Friedrich von Metzsch selbst, hält den Täufling über das heilige steinerne Becken. Es ist das erste Kind seines Gerichtsinspektors Daniel Weißenborn und dessen junger Ehefrau Anna Rosine.
Das Kind, erst am vorigen Tag in der elterlichen Wohnung im Gerichtshaus am Johannesplatz geboren, erhält den Namen Friederike Caroline. Anna Rosine hat ein Mädchen geboren. An diesem Frühlingsmorgen scheint sein Weg klar.
Was wünscht der gräfliche Pate der Tochter eines seiner ersten Beamten? Schönheit und Tugend? Vor allem Tugend. Ein braves, demütiges Herz, fleißige Hände. Dann ergibt sich der notwendige Rest von selbst: eine ehrbare Heirat in ein begütertes Haus. Wenn sie einst alt und im festen Glauben an das gute Reich Gottes im Sterbebett liegen wird – das scheint gewiss an diesem Tag –, werden Kinder und Enkel um sie sein, weinende Mägde, der Pfarrer in der ersten Reihe.
Am Ende nur ihr Name, eine Zeile auf dem Grabstein des Gatten. So ist es Brauch.
Die frommen Wünsche haben nichts genützt.
Friederike Caroline, die kleine Weißenbornin, wird den vorgezeichneten Weg verlassen. Sie wird sich für eine andere Zukunft entscheiden, für das Unvorhergesehene, das Überraschende. Jeder Tag ein neuer Kampf, Siege und Niederlagen. Als «die Neuberin» wird sie Theatergeschichte machen. Sie wird gefeiert werden als geniale Schauspielerin, als Poetin und als Theaterprinzipalin, sie wird verlacht und verachtet werden als eigenwillige Komödiantin. Und später, viel später, werden ihr sächsische Freunde der Theaterkunst ein steinernes Denkmal setzen.
Eine Kindheit in Zwickau oder Kerkerhaft macht flügge
FRIEDERIKES VATER, bei ihrer Geburt einundvierzig Jahre alt, ist Rechtsgelehrter. Er hat in Straßburg und Leipzig studiert, ein weit gereister Mann. Er entstammt einer begüterten Kürschnerfamilie. Schon sein Großvater Fabian, der um 1600 als wandernder Geselle aus der pommerschen Handelsstadt Stettin nach Zwickau gekommen war, hatte als Kürschnermeister die Bürgerrechte und ein großes Haus erworben.
Auch Mutter Anna Rosine, geborene Wilhelm, viele Jahre jünger als ihr Mann, kommt aus gutbürgerlichem Hause. Ihr Geburtsdatum ist unbekannt, als Jahr ihrer Eheschließung mit Weißenborn wird 1691 oder 1696 angenommen. Ihr Vater Johann Heinrich Wilhelm war in jungen Jahren Notar. Nun ist er Hochgräflich Reuß-Plausischer Gutsverwalter zu Rothenthal bei Greiz, einer kleinen Residenzstadt nur wenige Meilen von Reichenbach.
Seit 1692 lebt Daniel Weißenborn als Gerichtsinspektor in Reichenbach. Der Ort im Vogtland ist mit seinen zweitausendsechshundert Einwohnern keine große Stadt, aber doch von Bedeutung. Der Tuchhandel blüht, die Geschäfte gehen weit. Bis nach Hamburg, nach München und ins Schwäbische, in die österreichischen Erblande und in die Kurpfalz. Wichtige Verkehrsstraßen kreuzen sich hier, und der Handel bringt Nachrichten aus der weiten Welt. Dass in Leipzig ein Gesangbuch gedruckt wird mit fünftausend Liedern. Dass in den Städten Europas die Reichen sich neuerdings in überdachten Sesseln, Sänften genannt, von Dienern umhertragen lassen. Oder dass man in England die Salzsteuer verdoppelt hat und dass der russische Zar, der junge Peter I., in den Niederlanden das Schiffszimmern erlernen soll. Der Zar als Zimmermann? Eine unglaubliche Geschichte.
Die Welt, in die Friederike hineingeboren wird, ist im Aufbruch. Mitteleuropa erholt sich von den Verwüstungen des Dreißigjährigen Krieges. Deutschland oder besser: die deutschen Lande sind durch die Vereinbarungen des «Westfälischen Friedens» anno 1648 ein Flickenteppich auf der Landkarte. Hunderte von Territorialstaaten, selbständige Herrschaftsgebiete, manche nicht größer als ein Bauerngut, bilden das Heilige Römische Reich Deutscher Nation. Wer zum Beispiel den ganzen Rhein hinunterreisen will, muss zweiunddreißigmal die als Zollschranke dienende Eisenkette über dem Fluss lösen und seine Waren von den strengen Zöllnern kontrollieren lassen. Auch Maße und Gewichte sind in fast jedem Herrschaftsgebiet anders. Der Scheffel, ein Getreidemaß, bedeutete in der kleinen Grafschaft Hoya 14,6 Liter, im Herzogtum Lüneburg hingegen 124,6 Liter. Immerhin gibt es überall in den deutschen Ländern den Taler, aber auch das sagt nicht viel. Der Wert ist unterschiedlich, und in Hannover zum Beispiel wird er in Schillinge, in Lüneburg in Groschen und in Oldenburg in Mariengroschen unterteilt. Eine Reise ist ein kompliziertes Unternehmen.
Die Gesellschaft ist fest in Stände eingeteilt, die den Menschen ihren Platz in der Welt unverrückbar zuweisen. Noch herrschen die Fürsten uneingeschränkt, absolut. Aber die Kaufleute und Handwerksmeister in den Städten, als Bürger nach Adel und Geistlichkeit der aufstrebende Stand, werden durch die wieder erblühende Wirtschaft reich und bedeutend. Mit wachsendem Selbstbewusstsein wird das Bürgertum in den kommenden Jahrzehnten endgültig und unaufhaltsam auch zum Motor und Träger des Geisteslebens werden. Fast ein Jahrhundert noch, bis der Sturm auf die Bastille von Paris die große, blutige Revolution in Frankreich einleitet.
Das Geburtshaus (rechts) von F.C. Neuber in Reichenbach 1837, wie es nach dem Stadtbrand 1833 wieder aufgebaut wurde.
Jetzt, um die Wende vom 17. zum 18. Jahrhundert, ist der barocke französische Adel für die europäischen Fürsten, Grafen, Herzöge und ihre Satelliten in allem Vorbild. Die Bürger eifern zumindest der pompösen Mode nach. Nur für das «einfache Volk», etwa neunzig Prozent der Menschen, hat sich das Leben seit dem Mittelalter kaum verändert.
Das gilt auch in Sachsen. August der Starke, seit 1694 Kurfürst und in Friederikes Geburtsjahr auch zum Herrscher des katholischen Königreichs Polen gekrönt, lebt und regiert ebenso wie die anderen Fürsten und Monarchen Zentraleuropas nach dem Vorbild des «Sonnenkönigs»: Ludwig XIV. beherrscht seit fast vierzig Jahren Frankreich, aber sein Einfluss reicht weit über die Grenzen. Sein opulenter barocker Geschmack prägt ein Jahrhundert. Er ist der König der absoluten Macht, der Ausschweifungen und der nicht endenden rauschenden Feste. Die großen und kleinen Höfe Europas bis hinauf ins kalte Stockholm feiern ihm nach. Und wie er pressen sie für die Kosten dieser Pracht ihre Bauern aus: für Paläste und Gärten, für Feuerwerk, Wasserspiele und Statuen aus Marmor, für Goldbrokat und Seide, für den Traum vom Himmel auf Erden und italienische Primadonnen.
Ludwig liebt und fördert die Künste. Seine berühmten Feste lässt er von den größten Künstlern seines Landes ausrichten, unter ihnen Racine, Lully und – vor allem – Jean Baptiste Poquelin, der sich Molière nennt. Der berühmteste Organisator der Versailler Lustbarkeiten und bedeutendste Poet an Ludwigs Hof verändert das französische Theater – und beeinflusst in Friederikes Zeit, Jahrzehnte nach seinem Tod, grundlegend das deutsche.
Es ist ungewiss, wann Friederike seinen spitzen und so gar nicht gottesfürchtigen Meisterwerken zuerst begegnet ist. Sicher nicht in der Bibliothek des Vaters. Die ist zwar groß, ungewöhnlich für diese Zeit, aber nur voller gelehrter Juristerei und Philosophie.
Französische Theaterstücke können nur zu Anna Rosines heimlicher Lektüre gehört haben. Friederikes Mutter liebt – zum Ärger ihres strengen und herrschsüchtigen Ehemanns – die Literatur. Als Daniel Weißenborn ihr die Bücher nimmt, leiht sie sich heimlich Ersatz bei den Nachbarn. Sie spricht gut Französisch, sicher kennt sie Molières bittere Komödien.
Als Friederike fünf Jahre als ist, im Jahre 1702, verlässt die Familie Reichenbach und zieht nach dem nahen Zwickau um. Hier, in seiner Geburtsstadt, lässt sich Daniel Weißenborn als Notar nieder. Friederike ist immer noch das einzige Kind und wird es auch bleiben.
Das Leben in dem reichen dreigiebeligen Haus am Oberen Steinweg 56 ist keine Idylle. Vater Weißenborn ist ein jähzorniger Mann. Als Patriarch ist er unantastbar. Er tobt gegen Frau, Kind und Gesinde, flucht mit wüsten Worten. «Du Canaille», fährt er seine betende Frau an einem Bußtag an, «du wirst dich zum Teufel beten, nicht im Himmel». Oder später, kurz vor ihrem Tod: «Ich muß immer sehen, wenn der Teufel kömmt und deine verdammte Seele aus deinem verfluchten Körper herausreißet.» Er schlägt sie mit der Hundepeitsche, wirft mit dem, was gerade zur Hand ist, nach Frau und Tochter. Mal mit dem großen Stecken, den er stets bei sich trägt, einmal, als Anna Rosine die falsche Haube aufsetzt, mit einem «4pfündigen Hammer»[1]. Dass er diesmal nicht trifft, ist nur Glück.
Anna Rosine stirbt im November 1705, ziemlich plötzlich, und ganz Zwickau flüstert: «Daran ist der Weißenborn schuld.» Doch der Notar ist Herr in seinem Haus: Er kann in seiner Familie tun, was ihm beliebt. Gottvater, Landesvater, Hausvater. Jeder ein Herrscher in seinem Reich. So ist es Brauch in dieser Zeit.
An Anna Rosines frühem Tod ist der Weißenborn schuld! Dieses Gerücht wird viele Jahre lebendig bleiben, obwohl es dafür genauso wenig eine Grundlage gibt wie für ein anderes, das nach Friederikes Geburt auftaucht: Nicht Weißenborn sei der Kindsvater, sondern der hohe Pate selbst, der Adam Friedrich von Metzsch, Erb-, Lehns- und Gerichtsherr der kleinen Grafschaft Reichenbach-Friesen. Der Notar habe nur herhalten müssen damals, damit die Mutter in Ehren verheiratet und versorgt sei. Ob es denn nur ein Zufall sei, dass Weißenborn mit Frau und Kind gerade 1702, im Todesjahr des Adam Friedrich von Metzsch, seine gute Stellung in Reichenbach für eine unsichere Zukunft als Notar in Zwickau verlassen habe? Und habe er nicht oft den Körper seiner Frau verflucht, ihre tiefe Frömmigkeit und Demut verhöhnt? Nicht stets mit seinen Wurfgeschossen vor allem nach dem Gesicht des Kindes gezielt? Letzteres stimmt und ist bezeugt. Die Narbe auf Friederikes Wange, da, wo sein Schlüsselbund sich eines Tages in ihr Fleisch gegraben hat, wird sie ihr Leben lang an das hasserfüllte Wüten des Vaters erinnern. Was kann aus einem Kind werden, das unter solch zorniger, unberechenbarer Herrschaft heranwächst? Ein Duckmäuser. Oder ein Rebell.
Die Tochter ist jetzt mit dem Vater allein. Weißenborn, der Witwer, ist fast fünfzig, oft bettlägerig von der Gicht, und die Geschäfte gehen schlecht. Er hat Schmerzen und Sorgen – sein Regiment wird nun kaum milder gewesen sein. Was tun mit einem achtjährigen Kind? Wäre es ein Sohn, schickte er ihn auf die Lateinschule, dann auf die Universität nach Halle oder Leipzig zum Studium der Rechte oder der Theologie. Aber eine Tochter?
Auch wenn es noch keine Schulpflicht gibt, gehört für ein Mädchen aus dem Bürgertum Bildung zur Standespflicht: Rechnen, Lesen, Schreiben, ein wenig Französisch und feine Manieren. Auch nützliche Künste und genug Wissenschaften, damit es später ein großes Haus zu führen versteht, die Kinder im guten Geiste erziehen kann, dem Gatten eine gehorsame und unterhaltsame Gefährtin wird. Mehr gilt als verderblich. Aber über allem steht die Erziehung zur Frömmigkeit, aus der Gehorsam, Ehre und Gottesfurcht erwachsen. «Allerunentbehrlichst: Geduld, Sanftmuth, Nachgiebigkeit und Selbstverleugnung»[2].
Über Friederikes Bildungsweg ist wenig überliefert. Anna Rosine hatte, so wie es Brauch war, ihre aufgeweckte und wissbegierige Tochter unterrichtet. Die Achtjährige kann schreiben und lesen, rechnen und ein wenig Französisch parlieren. Sie weiß die Gebote Gottes und christliche Lieder vorzutragen, auf dem Globus in der Studierstube des Vaters hat sie entdeckt, wie unendlich groß die Welt ist. In die «Maidlein-Schule» am Zwickauer Klosterplatz, im Schulgebäude des ehemaligen Barfüßerklosters, kann Weißenborn Friederike also nicht mehr schicken, denn dort werden außer Beten nur Grundkenntnisse geübt. Vielleicht hat sie Hauslehrer gehabt, aber wahrscheinlich wird sie nun Schülerin und bald auch Gehilfin des strengen Vaters. Denn später, als Leiterin ihrer Theatertruppe, als Prinzipalin, zeigt sie in zahllosen Streit- und Bittbriefen an Behörden und Fürsten, dass sie auch Latein und die juristische Sprache beherrscht. Wenn ihre Pflichten in Haushalt und Notariat ihr Zeit lassen, liest sie in den gelehrten Büchern ihres Vaters und schreibt ihre ersten kindlichen Gedichte.
Das sind vor allem Rückschlüsse, Vermutungen – es ist wenig verbrieft über das Kind Friederike.
Bis zu ihrem fünfzehnten Lebensjahr: 1712, im Frühling, wird Friederike Caroline Weißenborn aktenkundig. Das Gericht zu Zwickau erlässt am 13. Mai auf Antrag ihres Vaters einen Steckbrief:
«Wir, Stadtvoigt und Beisitzer der Stadt- und Osterweyhen Schultesgerichte zu Zwickau fügen nächst Entbietung unserer nach Standesgebühr geziehmenden Dienste, Jedermännigliche denen dieses zukommt, hiermit zu wissen, was maßen bei Uns Hr. Daniel Weißenborn vormaliger Hochadl. Mezschischer Gerichts-Inspector zu Reichenbach gebührend anbringen lassen, wie daß ihm Gottfried Zorn, ein Studiosus Juris seine einzige Tochter Fridericam Charlottam, so zur Zeit nicht weit über 14 Jahr alt sei, aus seinem Hause entführet auch dem Verlaut nach wirklich geschwängert habe …»[3]
Friederike ist am 14. April geflohen. Das Maß war voll. Der Vater hat sie oft geschlagen. Bestie hat er sie genannt, Canaille, Aas, nie bei ihrem Namen. Sie hat ihn all die Jahre ertragen und immer wieder versucht ihn zu versöhnen. Aber nun ist sie kein Kind mehr, sondern eine mutige junge Frau von «männlichem Charakter», das meint in dieser Zeit klug, entschlossen und selbstbewusst – Eigenschaften, die ihr in den kommenden bewegten Jahrzehnten immer wieder zugeschrieben werden. Sie ist auf und davon mit Gottfried Zorn, vierundzwanzig Jahre alt, Schuhmacherssohn, Student der Rechte und ehemals Gehilfe Daniel Weißenborns.
Es ist schon Friederikes zweite Flucht. Am vergangenen Neujahrstag hatte sie vor den wüsten Drohungen des Vaters das Haus verlassen. Nachdem ihre Tante, die gehorsame Schwester des Vaters, ihr die Aufnahme verweigerte, hatte sie Unterschlupf bei der Familie einer früheren Magd gefunden. Fast drei Monate hatte sie dort gelebt und darauf gewartet, dass Gottfried Zorn die Zukunft für sie beide in die Hand nimmt. Ein Dreivierteljahr hatte der zuvor ohne Lohn als Weißenborns Gehilfe gearbeitet. Die Tochter war ihm für die Zukunft versprochen, dazu die Bibliothek und das dreigiebelige Haus. Friederike war von Anfang an in ihn verliebt gewesen, endlich ein freundlicher Mensch, endlich eine Hoffnung, dem Vater zu entkommen. Hoffnung macht Liebe groß. Aber, so steht es in den Zwickauer Akten, Weißenborn stritt sich mit Zorns Mutter. Wer weiß warum, aber er stritt bitter, schlug sie «mit der Karepritsche» und verbot ihr samt ihrem Sohn das Haus.
Zorn, so teilte er seiner Tochter mit, sei umgehend zu vergessen. Sofort. Aber Friederike ist keine, die Hoffen und Lieben vergisst. Also hatte sie Heimlichkeiten, traf sich mit ihrem «allerliebsten Engel», schrieb ihm, dem ewig Zögernden, verzweifelte Briefe:
« … ich bitte Dich nochmahls um Gottes Barmherzigkeit Willen, ich kann Dich nicht höher bitten, lasse mich verlassene Seele nicht in Angst und Jammer vergehen, wen Du mich volt verlassen würtest, so würte ich als ein Schaff welches von Herte und Hirten verlassen, in der Irre gehen und mit Schmertzen mein jammervolles Ende erwarten …»[4]
Weißenborn hatte seine Spione. Noch einmal, drohte er, und er werde sie erschießen. Lichterloh werde sie in der Hölle brennen wie ihre Mutter. Die Kammer neben seiner Schreibstube ist voller Pistolen, auch eine Armbrust ist da. Grund genug, die Drohung ernst zu nehmen. Also war sie geflohen und erst nach einem Vierteljahr durch die Vermittlung eines Diakons zum Vater zurückgekehrt.
Das ist erst wenige Wochen her, doch Weißenborn ist der alte Tyrann geblieben und das Leben mit ihm die alte Hölle. Und weil der ängstliche Zorn auch jetzt nicht kommt, sie zu retten, rettet sie sich selbst. Am Abend des 14. April 1712 läuft sie nach der wilden Schimpferei des Vaters fort, ohne auch nur ein Schultertuch mitzunehmen. Dann steht sie in Zorns Stube, voller Hoffnung und Freude. Entkommen! Nun endlich beginnt das Leben.