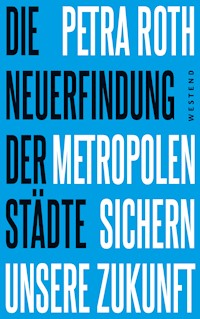
13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Westend
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Schafft die Länder ab! Unsere Schulen sind marode, die Kitas überfüllt, Bibliotheken und Theater werden geschlossen, Buslinien eingestellt - kurzum: Unsere Städte bluten aus. Gleichzeitig zieht es immer mehr Menschen in die Städte und Metropolen. Wie geht das zusammen? Petra Roth zeigt, warum Länder immer überflüssiger werden und es zukünftig stattdessen vielmehr heißen muss: Alle Macht den Städten!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 297
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
PETRA ROTH
DIE NEU-
ERFINDUNG
DER STÄDTE
Metropolen sichern unsere Zukunft
Unter Mitarbeit von Dr. Matthias Arning
ebook Edition
Mehr über unsere Autoren und Bücher: www.westendverlag.de
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Dies ist die komplett überarbeitete Neuausgabe des Buches Aufstand der Städte.
ISBN 978-3-86489-581-4 Westend Verlag, Frankfurt/Main 2014 Satz: Publikations Atelier, Dreieich Druck und Bindung: CPI – Clausen & Bosse, LeckPrinted in Germany
Inhalt
Vorwort
Aufstand, nicht Revolution – was in den Städten los ist
1 Mit Fortunas Hilfe – Herausforderungen der Gegenwart
Im Rausch der Freiheit – was von 1989 bleibt
Botschaft der Paulskirche – was Demokratie braucht
Gesichertes Terrain – was Städte erwarten können
Unsere Moderne – ein unvollendetes Projekt
Elsaesser, May, Behrens, Poelzig – Spurensuche in Frankfurt am Main
Mit neuen Ideen – politische Koordinaten nach 1989
Revision der Postmoderne – wo wir heute stehen
Vermessung der Metropolregionen – ein Vorrat an Möglichkeiten
Große Pläne – Stadtvisionen 1910 und 2010
2 Aufbruch in eine andere Moderne – über den Glauben an eine gesellschaftliche Entwicklungsperspektive
Abkehr von der Skepsis – die Chancen der Globalisierung nutzen
Leiden an der Risikogesellschaft – über die Faszination der Idee des Fortschritts
Riskante Moderne – über Bedrohungen und Herausforderungen
Demokratischer Aufbruch – über die politische Erfahrung, dass es auch anders kommen könnte
Mit Emphase für den Fortschritt – über das, was eine Stadt ausmacht
Bedeutende Städte – über das Paradoxon des Nationalen
Modernitätsbewusstsein – über einen Imperativ des Wandels
3 Welten der Bürger – was in unseren Städten los ist
Eine Art Schadensbilanz – wie sich der Rand des Zusammenbruchs markieren lässt
Alarm in Ostdeutschland – wenn die Städtebauförderung ausbleibt
Streitpunkt Gewerbesteuer – warum die Abgabe der Kommune wie der Wirtschaft nützt
»Ossis« und »Wessis« – wenn die Kassen ganz knapp sind
Fürsorge und Vorsorge – wenn die Kosten explodieren
Nicht arm, aber geliebt – was in Frankfurt los ist
Heimat Frankfurt – wie Integration gelingen kann
Heimat Hauptwache – warum aus dem Nebeneinander ein Miteinander werden sollte
Im Streit um die Moschee – was das wohl für eine Stadt ist?
Kultur für alle – warum diese Maxime heute aktueller denn je ist
Das Deutsche Romantikmuseum – ein Geschenk der Bürger
Vernetzung im Sinne des kooperativen Föderalismus
Heiße City – wie man mit dem Klimawandel umgehen kann
4 Nicht Utopie, Modell – Städte in Europa
Ein neues Leitbild – über die Zukunft der Stadt
Querschnitt Klimaschutz – was zu tun ist, um 2050 so weit zu sein
Aktuelle Rahmenbedingungen I – Klimawandel beginnt in der Stadt
Aktuelle Rahmenbedingungen II – über kooperativen Föderalismus in der Bildungspolitik
Irritationen nach 1866 – über Entwicklungsschübe in Bad Frankfurt
»Das ist doch der Benjamin« – wo Frankfurt Schule macht
Botschafter in der Welt – über Erwartungen an Studenten
Blinde Flecken – über den Fokus der Bildungspolitik
Global denken, lokal handeln – über die Bestimmung des Politischen
Lokale Räume in globalen Dimensionen – das Beispiel Ludwigsburg
5 Schnell, konkret, modern – was kommunale Politik perspektivisch leisten muss
Konkret – wie Kommunalpolitik gelingen kann
Modern – Schwarz-Grün und die Frauen
Experiment Schwarz-Grün – vom Wagnis zum Modellprojekt
Das Prinzip der Politik I – über Partizipation in schwierigen Zeiten
Frohgemut zum Ende der Unübersichtlichkeit – über den Verlust der Barbaren
6 Das Jahr 2030 – geräuschlose Flugzeuge und zornige Rebellen
Frankfurt 2030 – Bioerdgas und Ganztagsschule
Im Sinne der Multizentralität – die Europäische Zentralbank am Main
Modell für die Stadt des 21. Jahrhunderts – der Kultur-Campus in Bockenheim
Modell für die Wirtschaft des 21. Jahrhunderts – das Green Building der Deutschen Bank
Das Prinzip der Politik II – was Hand und Fuß hat, lässt sich auch plausibel machen
Zukunft der Stadt – die »Post Oil City« im demografischen Wandel
Leitbild 2030 – Lebenswelt, Wirtschaftsraum, Forum
Wegweiser Kommune – gelingende Integration und Reform des Föderalismus
Die Neuerfindung der Städte – Ansprüche der Metropolregionen
Berliner Versuche – die Neuerfindung der Länder
7 Unvollendete Moderne – im Salon keine Gespräche über Courbet
Soziale Stadt – neue Akzente im föderalen Gefüge
Florierender Ballungsraum – Netze neuer Verflechtungen
Frankfurt I – kommunale Klimapolitik
Frankfurt II – vorsorgende Sozialpolitik
Erneuerung der Politik – was auf die Städte zukommt
Herausforderung Moderne
Literatur
Vorwort
Aufstand, nicht Revolution – was in den Städten los ist
Der König wirkte alarmiert. Ob das, was aus allen Ecken seines Landes über das lautstarke Aufbegehren der Bauern und manche Aufregung der Städter berichtet werde, ob das etwa eine Revolte sei, wollte Ludwig XVI., Frankreichs Alleinherrscher, von einem Vertrauten wissen. Nein, Sire, erwiderte dieser, was sich gegenwärtig überall in seinem Reich abspiele, sei keine Revolte, es sei eine Revolution.
Seitdem gilt die Revolution, anders als die Revolte, als furchteinflößend: Eine Revolte würde man womöglich beherrschen können, aber was würde eine Revolution bringen? Zumindest Ungewissheit. Die Mehrheit der Nationalversammlung in der Paulskirche wollte das nicht und folgte 1848 dem leidenschaftlichen Werben Friedrich Daniel Bassermanns, das der Abgeordnete in einer Rede am 19. Juni 1848 entfaltete: »Wir haben keine Tabula rasa in Deutschland, wir haben gegebene Verhältnisse, und es gilt zu reformieren, uns nicht zu revolutionieren.«
Um allerdings eine Reform in Gang zu bringen, muss man gelegentlich einen Aufstand wagen. Als Bürger wie als Bewohner der Städte. Der Ansiedlungen also, zu denen sich die Menschen gerade im 21. Jahrhundert wieder hingezogen fühlen: Die meisten von ihnen leben bereits in großen Kommunen, von denen sie erwarten, dass sie ihnen Entwicklungsmöglichkeiten bieten, ihre Kinder gut versorgt werden und sie täglich aus einem reichen Kulturprogramm auswählen können.
Die Ansprüche an die Städte wachsen, allein die Gestaltungsspielräume der Kommunen werden ständig enger. Deswegen braucht dieses Land dringend eine Reform des Föderalismus, die der sich rasant verändernden Lage in der Republik gerecht wird und die auf die sich zügig wandelnde Realität zu reagieren vermag. Bund und Länder trauen sich nicht heran. Vielmehr halten sie die Städte knapp. So aber kann das nicht weitergehen. Schließlich sind die Metropolregionen mit ihren großstädtischen Zentren entscheidend, wenn es um die großen politischen Weichenstellungen im Zusammenhang mit dem demografischen und klimatischen Wandel geht. Auch wenn Politik heute über das Problem der sozialen wie politischen Partizipation nachdenkt, finden sich die Anknüpfungspunkte in den Städten und Gemeinden: Teilhabe lässt sich vor allem kommunal buchstabieren. Den Regionen gehört die Zukunft. Sie sind die Motoren jeder weiteren Entwicklung. Also müssen alle weiteren Überlegungen grundsätzlich angestellt werden: Orientieren wir uns in dieser Republik perspektivisch weiterhin an der Verfasstheit über die 16 Bundesländer oder nutzen wir die im Wettstreit der Metropolregionen freigesetzte Dynamik zur weiteren Entwicklung des Landes?
Im Namen der Kommunen habe ich als Präsidentin des Deutschen Städtetages während meiner Amtszeit als Frankfurter Oberbürgermeisterin bis 2012 der Bundesregierung immer wieder öffentlich widersprechen müssen. Ob bei den Streichungen für die kommunalen Krankenhäuser oder der Benachteiligung der örtlichen Stromversorger gegenüber den großen Konzernen durch das neue Energiekonzept, ob bei der Finanzierung der Jobcenter oder auch im Zusammenhang mit der angestrebten Abschaffung der Gewerbesteuer – immer wieder musste ich in Berlin deutlich machen, dass den ohnehin notleidenden Städten und Gemeinden nicht noch mehr zugemutet werden kann. Wenn man das weitsichtige Diktum des früheren UN-Generalsekretärs Kofi Annan ernst nimmt, dass Städte die gesellschaftlichen Entwicklungsmotoren des 21. Jahrhunderts seien, dann kann man ihnen den Betriebsstoff dazu nicht entziehen. Eine wirkliche Föderalismusreform in der Bundesrepublik Deutschland hätte von diesem Bedeutungszuwachs der Kommunen auszugehen mit dem Ziel, dass sich Bund, Länder und Gemeinden gemeinsam der großen Themen unseres Jahrhunderts annehmen.
Eigentlich hatte ich die Hoffnung, manche Auseinandersetzungen der Vergangenheit hätten sich erledigt. Aber nein, weit gefehlt – erst der nordrhein-westfälische Verfassungsgerichtshof vermochte Mitte des Jahres 2010 dem Land deutlich zu machen, was »Konnexitätsprinzip« eigentlich heißen soll: »Wer bestellt, zahlt.« Wenn man also mehr für die frühkindliche Förderung tun möchte, hat man den Bau von Krippenplätzen auch zu finanzieren, kann man also das Zahlen der Zeche nicht einfach an die Kommunen delegieren. In der politischen Praxis sollte dieser Grundsatz nicht allein ein Prinzip, sondern die Regel sein. Große Städte wie kleine Gemeinden atmen auf ob dieser Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs, die auch der Deutsche Städtetag als wegweisend sieht. Doch die Durchsetzung berechtigter Interessen wird immer schwieriger, weil das föderale Gefüge nicht mehr stimmt. Dessen Reformbedürftigkeit ist zwar im Grundsatz anerkannt, aber niemand wagt sich daran, eine solche Reform richtig anzugehen. Das Ziel müsste es sein, den Kommunen mehr Spielräume zu eröffnen, ihnen finanzielle Standards verlässlich zuzugestehen, sie zu motivieren, sich entschlossen auf die neue Lage einzustellen angesichts von Alterung der Bevölkerung und Erwärmung der Erde.
Die Städte machen Tempo. In ihrer Vorbildfunktion erweisen sich Kommunen als gesellschaftspolitische Impulsgeber. So finden sich in Ludwigsburg, München und Frankfurt am Main beispielsweise nachahmenswerte Projekte, um den Klimawandel grundlegend anzugehen. Jede kommunalpolitische Entscheidung orientiert sich in Ludwigsburg am Primat des Klimaschutzes. Oder das Beispiel München: Bis zum Jahr 2020 sollen die Emissionen von Kohlendioxid auf die Hälfte des Niveaus von einem Vierteljahrhundert zuvor sinken. Ein Exempel aus der Sozialpolitik: Während der Bund noch über die Bildungschipkarte gestritten hat, ist der gezielte Ansporn benachteiligter Kinder in Städten wie Frankfurt am Main mit Einführung der Frankfurt Card längst Realität geworden. Dort hatte man eher die Sorge, mit der Initiative aus Berlin könnte manche Familie künftig finanziell schlechter stehen.
Die Städte erheben sich, weil sie sich mit ihren guten Ideen für die Zeit des Wandels nicht ernst genommen fühlen. Zu ihren weiteren Perspektiven gehört die Regionalisierung der Stadt. In diesem Sinne hat Brüssel nach dem Fall der Mauer eine neue politische Topografie für Europa entworfen – als Landschaft gewichtiger, weil auch ökonomisch starker Metropolregionen, in deren Zentren sich große Städte finden. Diese Sicht der Dinge ist heute eigentlich selbstverständlich. Zumindest in den Metropolregionen selbst. In der Bundesregierung allerdings kann das noch dauern. Berlin und vor allem die Länder bestehen auf einer am Föderalismus orientierten Sicht. Vielleicht aber vernimmt man dort demnächst die Signale des Aufstands. Der französische König Ludwig XVI. erkannte in den Sommermonaten des Jahres 1789 zumindest die Zeichen der Zeit. Nur wahrhaben wollte er sie nicht. Vielleicht wäre eine Reform noch möglich gewesen.
Über diese Zeichen der Zeit denke ich seit dem Epochenwandel, den Europa seit 1989 erlebt, immer wieder nach. Vielleicht haben wir das Ausmaß dieser Veränderungen noch nicht richtig verkraftet, nennen die Zäsur deshalb auch nur wenig liebevoll einfach »Wende«. 1989 aber steht für eine Revolution, wenngleich dieser Begriff nach einer Beobachtung des Historikers Reinhart Koselleck doch »mehr verschlissen ist, als ihre Verwender wahrhaben können«. 1989, das ist der Beginn einer neuen Zeit, die wir mit weniger Verzagtheit als vielmehr gutem Mut angehen sollten. Zuversicht lässt sich aus einem historischen Bezugsrahmen schöpfen, den ich in Frankfurt um das Jahr 1910, eine Markierung des Aufbruchs, festmache: In dieser Zeit entsteht eine Vorstellung von Moderne, an die ich anzuknüpfen suche. Damals sehnten sich die Menschen im Land danach, es möge besser werden, vor allem aber glaubten sie daran, es könne besser werden. Auch heute könnte dieses Land einen Aufbruch der Ideen gut gebrauchen. Demokratie braucht eine Entwicklungsperspektive. Sie muss sich aus der Mitte der Gesellschaft heraus entwickeln und die humane Qualität dieser Gesellschaft zu ihrem zentralen Maßstab machen.
Auch diese Einsicht gehört zu den Konsequenzen, die wir aus der aktuellen Finanzkrise der Gegenwart nach 2008 ziehen sollten, von der der Bielefelder Sozialforscher Wilhelm Heitmeyer glaubt, sie führe zu einer »Radikalisierung der Unübersichtlichkeit«, weil wirtschaftliche Systeme und staatliche Strukturen unter starken Druck geraten seien. Andere Autoren gehen noch viel weiter: Für sie ist die Demokratie als politische Verfasstheit an einen Endpunkt geraten. Noch einmal, notiert Wolfgang Streeck, der Direktor des Max-Planck-Instituts für Gesellschaftsforschung in Köln, gebe es durch die Rettungsaktionen des Staates für den demokratischen Kapitalismus in unserer Gegenwart einen Zeitgewinn, »gekaufte Zeit«.
Wir leben, nicht anders als unsere Urgroßeltern ein Jahrhundert zuvor, in überaus spannenden Zeiten, weil sich in zentralen Fragen neue Leitvorstellungen ergeben müssen: Wie stellen wir uns gesellschaftliche Zukunft vor, deren Veränderungen wir auf einer weit gefassten Zeitachse übersehen können, wie also bereiten wir vor, dass verschiedene Generationen miteinander auskommen, die Lebensentwürfe von Partnern miteinander korrespondieren können und Gemeinwesen in mitunter schwierigen Zeiten zusammenhalten? Fragen wie diese brauchen ein überschaubares Experimentierfeld, auf dem Antworten auszuprobieren sind. Die Probe auf das berühmte Exempel lässt sich in den Städten machen. Dort können und sollten wir intelligente Lösungen finden. Von den Städten aus lässt sich den Bürgern ein Kompass für das 21. Jahrhundert an die Hand geben.
In insgesamt sieben Kapiteln will ich in diesem Buch für diese Sicht der Dinge werben. Zunächst charakterisiere ich die Herausforderungen, denen sich die Städte der Zukunft gegenüber sehen, bemühe mich dann um eine Bestandsaufnahme zum augenblicklichen Zustand der Kommunen, um schließlich einen Ausblick zu wagen: auf die energieeffiziente, gute Lebensqualität bietende und ein reichhaltiges Bildungsangebot vorhaltende Stadt der Zukunft, die sich im Kern der Metropolregionen findet, die für das Europa der Gegenwart konstitutiv sind. Über die Metropolregionen erschließt sich für Europa heute eine von Optimismus und Zuversicht geprägte Entwicklungsperspektive, auf deren Grundlage sich die politische Agenda des 21. Jahrhunderts abarbeiten lässt. Der europäische Kontext der Konkurrenz ist für die Metropolregionen ein steter gegenseitiger Ansporn, die eigene gesellschaftliche Dynamik fortwährend in Gang zu halten. Meine Überlegungen zu den Entwicklungsperspektiven der Metropolregionen stütze ich stets auf historische Bezüge. Dafür greife ich immer wieder auf die Chiffren »1789« und »1989« zurück, weil die Frage grundlegend ist, was wir von »1789« in die Zeit nach »1989« mitnehmen wollen, worauf wir uns, mit anderen Worten, stützen können, wenn wir in der globalen Welt unterwegs sind.
Wertvolle Anregungen für die Diskussion über viele große Zukunftsthemen habe ich in vielen Gesprächen mit Dr. Matthias Arning, Peter Heine, Bernhard Messinger und Dr. Thomas Scheben aus ganz unterschiedlichen Perspektiven in meinem Büro als Oberbürgermeisterin der Stadt Frankfurt am Main bekommen. Ihnen gebührt mein großer Dank, weil ohne sie dieses Buch, zumal mit den Überarbeitungen für diese Neuauflage, nicht so entstanden wäre, wie es entstanden ist.
Frankfurt am Main, November 2014
1 Mit Fortunas Hilfe -Herausforderungen der Gegenwart
Michail Sergejewitsch Gorbatschow brachte es auf den Punkt. Die Europäer haben die Zeitenwende zum Ende des 20. Jahrhunderts erlebt. Sie haben auch die Gunst der Stunde mit dem Fall der Mauer und der zügigen Vereinigung der beiden deutschen Staaten genutzt. Und doch vermochten sie es aus der Sicht Gorbatschows nicht, die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts nachhaltig anzugehen: die Armut, die Demografie, das Klima. Allesamt Herausforderungen, die vor uns liegen.
In den Städten entscheidet sich, ob der Wandel gelingt. In den großen Städten und den Metropolregionen müssen die Bürger ihn angehen. Deswegen wächst den Städten eine nicht zu unterschätzende Bedeutung im Zusammenhang mit diesen weit über unsere eigene Gegenwart hinausweisenden Megathemen des klimatischen wie des demografischen Wandels sowie der Integration zu. Gelingt es dort, die Weichen richtig zu stellen, muss es uns für die weitere Zukunft, die es aufzustoßen gilt, nicht bange sein. Aber momentan machen die deutschen Städte nicht den Eindruck, dafür gerüstet zu sein, also zukunftsfest zu sein. Ganz im Gegenteil: Wieder stehen sie im Rahmen des föderalen Systems der Republik als Bittsteller da. Den Städten muss endlich die gebührende Bedeutung zukommen, denn die Energiewende wird nicht ohne ihre Verkehrspolitik, ohne ihre Bildungspolitik und ohne ihre Umweltpolitik gelingen. Alles andere wäre eine Verkennung von Tatsachen. So wie man früher gesagt hat, dass Rüsselsheim, die Stadt der Autobauer, einen grippalen Infekt habe, wenn Opel huste, muss man heute wohl sagen: Wenn die Städte nicht in die Lage versetzt werden, sich den zentralen Anforderungen des 21. Jahrhunderts zu stellen, muss man sich um die Zukunft der Republik sorgen.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!





























